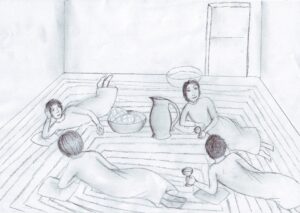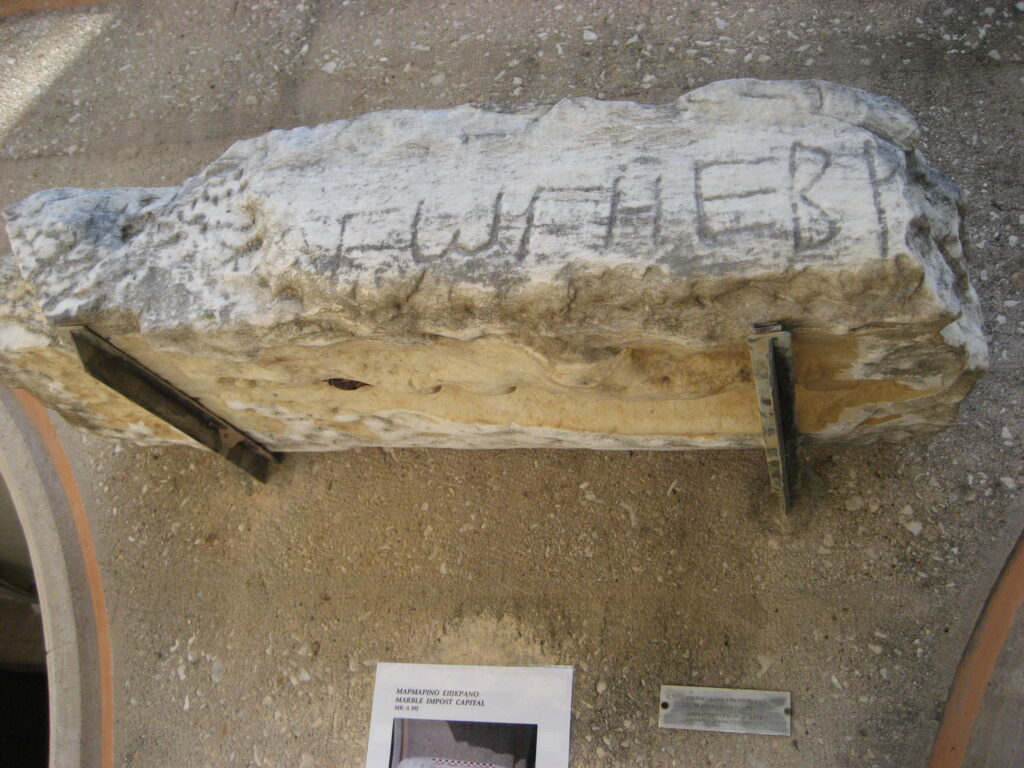Abbildung 1 „Mose redete, und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der HERR stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges, und der HERR rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Und der HERR sprach zu Mose“ (2Mose 19,19b-21a). Ein Berg aus schwarzem Basalt in der Sandwüste des Wadi Rum im Süden Jordaniens (Foto: P. Schüle 6. November 2014).
Eine 12-teilige Bibelstudie über die Gabe der Sprachenrede und deren Bestimmung
Einleitung
Es gibt kaum einen anderen Bereich in der Ausübung der Frömmigkeit unter den Christen, der mehr Aufsehen erregt, als die sogenannte `Zungenrede`. Warum ist die Äußerung dieser Geistes- und Gnadengabe für die einen ein Muss als Zeichen der Geistestaufe, während diese von anderen völlig abgelehnt wird? Während die Kontraste innerhalb der Gottesdienste oft nicht größer sein können, ist die Lebensführung im Alltag, sowohl bei den einen als auch bei den anderen, sehr ähnlich – von geistvoll bis geistleer. Die vorliegende Studie ist ein Versuch, die biblischen Texte und die damit verbundenen Geschichten sorgsam zu erforschen und wenn möglich Schlüsse daraus zu ziehen. Die Reihenfolge der einzelnen Textabschnitte ist grundsätzlich chronologisch, ebenso wie sie in den Schriften des Alten- und Neuen Testamentes aufgeschrieben wurden. Diese Bibelstudie erhebt nicht den Anspruch einer Forschungsarbeit zu dem genannten Thema.
Begriffe erklärt:
- glössa – a) Zunge als Körperglied mit Mehrzweckbestimmung, b) Zunge als Sprache.
lalia – die Rede, Redensart, Sprache, Aussprache, das Gesagte, das Gesprochene.
- eteroglössois – in/mit anderen Zungen/Sprachen (anderssprachig).
- cheileön – (im Pl.) – Lippen (oft auch als Synonym für Sprache gebraucht).
- etero – das andere.
- dialektos – Dialekt – Mundart (der Begriff wird gebraucht, um eine deutlichere Unterscheidung oder Eingrenzung bei einer bestimmten Sprache auszudrücken. Z. B. `ebraidi dialektö – im hebräischen Dialekt).
Machen wir uns nun auf den Weg und erforschen die Bibel auf die oben gestellte Frage hin.
1. Teil: Die Sprache – Gottes Gabe an die Menschen und deren Verlust
Die Sprache und Sprechfähigkeit kommt von Gott (1Mose 1-4; 2Mose 4,11). Diese Sprache war vollkommen, verständlich und durch sie konnte der Mensch alles ausdrücken, was er dachte, empfand, sah und anderen mitteilen wollte. In dieser Sprache verständigte sich Gott mit Adam, Eva und auch deren Kindern und späteren Nachkommen (1Mose 2; 3; 4; 6-9). Noah und seine Familie verständigten sich in dieser Sprache auch noch Jahrzehnte wenn nicht gar Jahrhunderte nach der Sintflut.
Beim ersten Städte- und Turmbau hatten alle Menschen nur eine Sprache, so in 1Mose 11,1 nach LXX: „Und die ganze Erde war (und es hatte die ganze Erde) eine Lippe und eine Stimme überall“. Diese Tatsache eröffnete den Menschen fast grenzenlose Möglichkeiten zur schöpferischen Entfaltung. Und sie machten Gebrauch davon, indem sie beschlossen eine Stadt und einen Turm zu bauen um zusammenzubleiben, anstatt sich zu zerstreuen und die Erde in Besitz zu nehmen, wie Gott es angeordnet hatte (1Mose 1,22. 29; 9,1.7). Der Anführer war Nimrod, ein Enkel von Ham und Urenkel von Noah, der in der Bibel als erster Herrscher bezeichnet wird. Er hatte die Idee zum Städtebau verwirklicht (1Mose 10,6-10). Die Reaktion Gottes ließ nicht lange auf sich warten. So lesen wir in 1Mose 11,6 nach der LXX: „Und der Herr sprach: siehe, ein Geschlecht und eine Lippe bei allen.“
Nach dieser Feststellung reagiert Gott mit einer Veränderung im Bereich der Sprache. 1Mose 11,7 nach LXX: „Kommt (auf) und herabgefahren, verwirren wir dort ihre Zunge/Sprache, damit keiner die Stimme seines Nächsten höre (verstehe).“ Der griechische Begriff `syncheömen` wird meist mit `verwirren‘ übersetzt. Da dieser Begriff in dieser Schreibweise und grammatischen Form nur ein einziges Mal vorkommt, suchen wir des besseren Verständnisses wegen nach der gleichen Wortwurzel in anderen Texten. Wir finden im Propheten Joel (3,1-2) das Verb `ek-cheö – aus-gießen, aus-schütten`. Genau so bei der Erfüllung dieser Prophetie in Apostelgeschichte 2,17.18.33. Bemerkenswert ist, dass gerade an Pfingsten für die Ausgießung des Heiligen Geistes dieselbe Wortwurzel `ek-cheö ` gebraucht wird, wie bei der Verwirrung der Sprache zur Zeit des Nimrod. In der Geschichte mit dem Verschütten/Ausschütten des Wechselgeldes im Tempel durch Jesus, wird das gleiche Verb benutzt wie bei der Sprachverwirrung, nur im Singular und der Vergangenheitsform.
In Johannes 2,15 steht: `ex-echeen to kerma – er schüttete das Geld aus`. In 1Mose 11,9 steht: `ekei syn-echeen – dort verwirrte er` ebenfalls im Singular undVergangenheitsform. Bei dem Begriff `syn-cheö-men` (1Mose 11,7) deutet die Endung `men` auf den Plural des Verbes (auch Plural des Handelnden hin, hier ist es Gott und die Vorsilbe `syn` auf ein Zusammenschütten, also vermischen, verwirren. Auch das hebräische Verb `balal` bedeutet `durchmischen`. Gott hat also damals nicht viele verschiedene und neue Sprachen gegeben (wie ‚Neues Leben‘ übersetzt), sondern die eine, für alle Menschen verständliche Sprache verwirrt, vermischt, vermengt, unkenntlich unverständlich gemacht.
Vorstellbar wäre, dass er das grammatische Gerüst/System, die sprachliche und logische Gesetzmäßigkeit dieser einen Sprache entzogen hat. Vergleichbar mit: wie wenn ein großes, schönes zweckmäßig ausgestattetes, bewohnbares Gebäude durch Einsturz zu einem Schutthaufen zusammenfällt. Weil die Menschen in ihrem Hochmut, Größenwahn, Stolz und Überheblichkeit, Gottes Sprache-Gabe für ihre eigenen Ziele missbrauchten, entzog er ihnen diese Gabe der Verständigung. Daher wurde diese Stadt `Babel` genannt (1Mose 11,9), weil daselbst der Herr ihre Sprache/Lippe verwirrte (LXX: `syn-echeen kyrios ta cheil¢ `.
Nun formten die Menschen in ihren jeweiligen Wohngebieten neue Hilfsmittel zur Verständigung in Sprache und Schrift.
2. Teil: Die Entstehung der hebräischen Sprache und Schrift
Die Ausführungen in diesem Abschnitt beruhen nicht auf wissenschaftlichen Forschungen, sie sind lediglich Beobachtungen, welche aus den Texten des Alten Testamentes abgeleitet werden können. Sie tragen jedoch wesentlich dazu bei, die geistliche Dimension der von Gott geschaffenen und an die Menschen geschenkten Gabe der Sprache und Schrift, zu erkennen. Denn wie das Volk Israel selbst aus den Völkern herausgerufen wurde, so bildete/formte Gott für dieses Volk eine eigene Sprache/Dialekt, welche sich schon deutlich von den anderen abgrenzte. Diese Abgrenzung war nicht so sehr im Vokabular selbst (ist sie doch der Aramäischen und Arabischen verwandt), sondern vielmehr im Inhalt der Begriffe.
Der besondere kollektive, aber auch persönliche Gottesbezug durchdrang die Sprache der Israeliten. Denn wie die Schrift, die Gott Mose auf dem Sinai gab, heilig war, sollte auch die Sprache seines Volkes gereinigt werden, bzw. frei sein von Elementen, welche den Götzendienst, Aberglauben und die sittenlose Lebens- und Ausdrucksweise der Völker durchdrang. Natürlich blieb zwischen den Heiligen Schriften und der Sprache des Volkes Israel immer wieder eine gewisse Diskrepanz, doch bestand immerhin die Möglichkeit einer Rückbesinnung auf die Schrift und die daraus fließende Reinigung der Sprache im Alltag.
Abraham war Semit (Nachfahre Sems) und brachte aus Ur in Chaldäa die dortige Sprache (wahrscheinlich Chaldäisch) mit nach Haran (Nordwestmesopotamien). Da Abraham und seine Familie dort längere Zeit lebten (bis zum Tod seines Vaters Terach, Apg 7,4), lernten sie auch noch den ostaramäischen Dialekt. In Kanaan wohnte er mit seiner Familie unter den Nachkommen Hams. Und auch hier lernten sie noch aus örtlichen Dialekten dazu. Es fällt auf, dass sie sich relativ gut mit der einheimischen Bevölkerung verständigen konnten (1Mose 14,13. 18ff; 20,1ff). Sogar in Ägypten konnte Abraham sich mit Pharao und seinen Untertanen verständigen (1Mose 12,15-19).
Zur Zeit Josefs unterschied sich die hebräische Sprache eindeutig von der ägyptischen, denn Josef verständigte sich mit seinen Brüdern mittels eines Dolmetschers (1Mose 42,23). Die hebräische Sprache formte sich wohl erst richtig in der Wüste, fern von anderen Volksgruppen. Gott redete mit Mose in der für ihn bekannten Sprache. Natürlich verstand Mose außer Ägyptisch und Hebräisch auch noch andere Sprachen, war er doch gelehrt in aller Weisheit der Ägypter (Apg 7,22). Durch das Reden Gottes auf dem Berg Sinai und die von Gott selbst hergestellten und beschriebenen zwei steinernen Tafeln des Zeugnisses mit den Zehn Geboten formte sich die hebräische Sprache und Schrift weiter (2Mose 31,18; 5Mose 9,10).
Aber nicht nur die Zehn Gebote, sondern auch alle weiteren Gesetze und Anordnungen für den Gottesdienst und den Alltag, die Gott dem Mose in mündlicher Form mitteilte, schrieb dieser auf Anordnung Gottes in ein Buch (wahrscheinlich Papyri) – das Buch des Gesetzes (2Mose 17,14; 24,4; 34,1. 22; 4Mose 33,2; 5Mose 5,22; 10,4; 31,9. 24). Die direkte und aktive Einflussnahme Gottes auf Sprache und Schrift, trug wesentlich zu deren Reinigung und Abgrenzung von anderen Sprachen bei. Zeitgleich vollzog sich auch eine Klärung der Identität dieses Volkes:
- Sie hatten Gottes Berufung in einen Sonderstatus unter den Völkern,
- Sie hörten mit ihren Ohren Gottes Stimme vom Berg Sinai,
- Sie hatten eine Sprache und Schrift, die sie mit Gottes Offenbarung am Sinai verband.
Die Berufung durch Gott aufgrund der Verheißungen an die Väter, die Schriftoffenbarung und die einheitliche Sprache begründeten ihre Identität. Auf diesem Hintergrund können wir die folgenden Geschichten im Zusammenhang unseres Themas besser verstehen. Zwei Beispiele:
- Der Verlust bzw. die Beeinträchtigung der hebräischen Sprache zum Beispiel durch Heirat mit ausländischen Frauen stellte für den Reformer Nehemia ein großes Problem dar (Neh 13,26-27). Er erinnert seine Landsleute an den Gesetzesbruch Salomos, der es liebte, ausländische Frauen nach Jerusalem in seinen Harem zu holen (1Kön 11,1-8). Diese Frauen brachten nicht nur ihre kulturellen und religiösen Elemente mit sich in die israelitische Oberschicht, sondern auch ihre Sprachen, welche mit vielen verderblichen Elementen durchsetzt waren.
- Als Rapschake, der syrische Feldherr, vor den Mauern Jerusalems den Gott Israels in hebräischer (jüdischer) Sprache verhöhnte, baten ihn die Verantwortlichen aus Juda: „Rede mit deinen Knechten Syrisch (Aramäisch), denn wir verstehen‘s und rede nicht Jüdisch (Hebräisch) vor den Ohren des Volks, das auf der Mauer ist.“ (2Kön 18,26; Jes 36,11).
Zum einen wird hier deutlich, dass die Oberschicht in Juda durchaus sprachgewandt war, denn sie verstand das Aramäische. Zum anderen war das Hebräische für das gemeine Volk die Muttersprache. In diesem Fall handelte es sich um Missbrauch der hebräischen Sprache gegen Gott und die Einwohner von Juda (Jerusalem) von Seiten der Assyrer.
Im Jahre 722/21 wurde das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria durch Salmanassar nach dreijähriger Belagerung erobert (2Kön 18,9-12). Die Bewohner wurden nach Medien weggeführt und dort angesiedelt. In der Fremde verlor sich auch bald ihre Sprache. „Der König von Assyrien aber ließ Leute von Babel kommen, von Kuta, von Awa, von Hamat und Sefarwajim und ließ sie wohnen in den Städten von Samarien an Israels statt. Und sie nahmen Samarien ein und wohnten in seinen Städten“ (2Kön 17,24). Von dort stammen die Samariter, welche unter Druck Teile des jüdischen Kultes übernommen hatten, gleichzeitig aber auch den Göttern ihrer Herkunftsländer opferten (2Kön 17,33). Diese Neusiedler sprachen natürlich ihre eigenen Sprachen oder Dialekte.
Im Jahr 586 wurde Jerusalem nach etwa zweijähriger Belagerung durch Nebukadnezar erobert. Dabei wurde insbesondere die Oberschicht aus Juda nach Babylon und Umgebung weggeführt und dort angesiedelt. Nach dem Edikt des Kyrus (539) sind rund 50 Tausend Judäer, Benjaminiten, Leviten und Priester (einschließlich deren Sklaven und Bediensteten) nach Jerusalem (Judäa) zurückgekehrt (Esra 2,64). Inzwischen setzte sich im Kanaanäischen Raum als Amtssprache das Aramäische durch (Esra 4,7). Doch das Hebräische hörte nicht auf, denn gerade in der Diaspora pflegten die frommen Juden die Schriftlesung und Schriftauslegung.
Auch im Heimatland konkurrierte das Hebräische mit dem Aramäischen. Als Esra, der Schriftgelehrte und Priester (ca. 458), aus dem Buch des Gesetzes Moses vor allem Volk vorlas, verstanden die Menschen, was gelesen und ausgelegt wurde (Neh 8,1-8). Es heißt im Text nicht, dass es übersetzt wurde, sondern dass es erklärt wurde. Natürlich kann man annehmen, dass nicht alle vom Volk die gleichen Sprachkenntnisse des Hebräischen besaßen.
Nehemia (444-433) stellt fest, dass sich einige Juden ausländische Frauen genommen hatten und die Hälfte ihrer Kinder die jüdische (hebräische) Sprache nicht mehr verstand oder sprach (Neh 13,24-27). Daraus geht hervor, dass der Großteil der jüdischen Bevölkerung um die Mitte des 5. Jh. v.Chr. immer noch Jüdisch (Hebräisch) verstand und sprach. Gerade in der nachexilischen Zeit strebten die Juden nach einer Rückkehr zu ihren Wurzeln, auch den sprachlichen.
3. Teil: Die Bedeutung der hebräischen Sprache und Schrift
Es ist erstaunlich, welchen Einfluss gerade die hebräische Sprache bzw. hebräische Schrift auf die Gesetzgebungen großer Teile der Welt hatte, sozusagen richtungsweisend für eine ganze Zivilisation wurde. Diese Popularität sagte Mose voraus, wie in 5Mose 4,5-8 geschrieben steht:
Sieh, ich habe euch gelehrt Gebote und Rechte, wie mir der HERR, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie! Denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass, wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen: Ei, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk! Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist wie uns der HERR, unser Gott, sooft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege?“
Doch wie fand diese Schrift und Sprache solch eine Verbreitung und Einfluss unter den Völkern? Schon unter Salomo wusste man weit über die Grenzen des Landes hinaus von dem Gott Israels (1Kön 10,1-14). Durch die leidvolle Entwicklung des Abfalls von dem lebendigen Gott bereits unter Salomo und in größerem Ausmaß nach dessen Tod, wurde Israel zunächst im Gebiet des Zweistromlandes angesiedelt (721-538). Damit vollzog Gott, was er im Falle von Ungehorsam angedroht hatte. „Und der HERR wird euch zerstreuen unter die Völker, und es wird von euch nur eine geringe Zahl übrig bleiben unter den Heiden, zu denen euch der HERR wegführen wird.“ (5Mose 4,27). Mit der Expansion der Makedonier/Griechen unter Alexander dem Großen (333-322) und seiner Generäle nach ihm gingen weitere Juden in die Diaspora, diesmal auch in Richtung Westen (Ägypten, die Inseln des Mittelmeeres und in den griechisch-hellenistischen Raum). Natürlich nahmen sie Abschriften ihrer Heiligen Schriften mit sich. Schon in der Zeit des babylonischen Exils bildeten sich die sogenannten Synagogen (Zusammenkünfte/Versammlungen). Dies war ein Ersatz für den Gottesdienst im Tempel in Jerusalem, der damals längere Zeit nicht in Funktion war. Auch später hatte ein Großteil der Diasporajuden zum wiederaufgebautem Tempel in Jerusalem keinen Zugang mehr.
Mit der Ausbreitung der griechischen Sprache in Kleinasien, Syrien, Mesopotamien und Ägypten sowie der gleichzeitigen Entfremdung der jüdischen Sprache unter den Juden in der Diaspora, entstand das Bedürfnis nach einer griechischen Übersetzung der hebräischen Heiligen Schriften. So entstand in der Mitte des 3. Jh. v.Chr. die griechische Fassung des Alten Testamentes – Septuaginta genannt (die lateinische Abkürzung dafür ist LXX für `siebzig`). Diese fand rasche Verbreitung nicht nur unter den Exiljuden. Viele suchende Menschen aus den Völkern staunten über den Ein-Gott-Glauben der Juden, über die klaren Gesetze und Gebote für das Leben und den Gottesdienst. Es konvertierten viele zum Judentum, diese Konvertiten wurden griechisch Proselyten genannt, das heißt: die Hinzugekommenen.
Zur Zeit von Jesus existierten im Kernland der Juden mehrere Versionen des hebräischen Alten Testamentes, die nur geringfügig voneinander abwichen. Es ist auffallend, dass Jesus auf dieses Thema in seinem Dienst nicht eingeht. Die Abweichungen müssen unwesentlich gewesen sein, der Hauptinhalt der Heiligen Schriften war übereinstimmend. Ungewöhnlich oft stützt Jesus sich auf die Schriften des Gesetzes, der Psalmen und Propheten. Und dies wirkte sich entsprechend nachhaltig auf die Abfassung, Verbreitung und Auswirkung der vier Evangelien aus. Auch der Heidenapostel Paulus scheint sich nicht an den geringen Unterschieden in den hebräischen Texten des Alten Testamentes oder den Abweichungen im griechischen Text zu stören. Als ausgezeichneter Theologe seiner Zeit benutzte er in seinen in Griechisch verfassten Briefen sogar die griechische Übersetzung des Alten Testamentes (LXX), wenn er daraus zitierte (Röm 14,11 aus LXX Jes 45,23). Somit konnten ihn die griechischsprachigen Hörer und Leser in seinen Argumentationen prüfen bzw. die Zitate nachlesen.
Auf diese Weise breitete sich der Einfluss göttlicher Inhalte von der hebräischen Sprache und Schrift weiter über die griechische Sprache und Schrift im damaligen Orient und Mittelmeerraum rasch aus. Dazu kamen Übersetzungen der Heiligen Schriften ins Koptische, Syrische, Lateinische und andere Sprachen. Bis heute sind diese Heiligen Schriften weltweit verbreitet und haben reinigende Wirkung in verschiedenen Lebensbereichen. Hier einige Begriffe und Namen, die aus dem hebräischen Sprachgebrauch unübersetzt in andere Sprachen übernommen wurden.
Namen: Adam, Eva, Henoch, Noah, Abraham, Sara, Isaak, Rebekka, Jakob, Lea, Rahel, Josef, Benjamin, Ruben, Simon, Mose, Mirjam, Aaron, Joschua, Deborah, Jael, Samuel, Isai, Ruth (moabitisch), David, Jonathan, Nathan, Salomon, Elias, Elisej, Micha, Amos, Jonas, Joel, Josia, Jeremias, Nathanael, Zacharias, Elisabet, Johannes, Matthäus, Matthias, Thomas, Maria, Anna, Talita, Tabita.
Begriffe und Orte: Abba, Eli, Messias, Rabbi, Nehuschta, Eben-Ezer, Bethesda, Siloah, Gabbata, Golgatha, Amen, Halleluja, Hosianna, Maranata, Korban, Satan, Gehenna, Beelzebul, Cherubim, Seraphim, Thora, Sabbat, Passah, Schalom, Eben Ezer, Bet El, Bethesda.
Mit dem Gebrauch dieser Begriffe und Namen, werden mehr oder weniger auch die damit verbundenen biblischen Geschichten assoziiert.
Durch die Funde in Qumran haben die Schriftforscher die Möglichkeit, anhand hebräischer Texte aus den Jahrhunderten vor Christus dem Originaltext der Heiligen Schriften des Alten Testamentes sehr nahe zu kommen. Auch dies ist eine besondere Gabe Gottes an die Menschen. Kein Buch der Welt wird von so vielen Menschen gelesen wie die Bibel (die Schriften des Alten und Neuen Testamentes). Und keine Schriften der Antike haben solche Auswirkungen auf das Denken, Reden und Handeln der Menschen wie die Bibel. „Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt.“ (2Tim 3,16-17).
4. Teil: Warum wird Gott zu Israel in anderen Sprachen reden?
So wie die Überschrift sehr ungewöhnlich klingt, so ungewöhnlich ist auch die Tatsache, dass Gott sich dem Volk Israel in einer fremden Sprache bzw. Sprachen/Lippen mitteilen will. Diese Aussage lesen wir in dem Propheten Jesaja: „Ja, durch stammelnde (gr. φαυλισμὸν – faulismon – eigentlich: faule, unreine, verdorbene) Lippen (gr. χεcheileön) und durch eine fremde (andere) Sprache (glöss¢s eteros) wird er zu diesem Volk reden, er, der zu ihnen sprach: Das ist die Ruhe! Schafft Ruhe dem Erschöpften! Und das ist die Erquickung! Aber sie wollten nicht hören. Und das Wort des HERRN für sie wird sein: Zaw la zaw, zaw la zaw, kaw la kaw, kaw la kaw; hier ein wenig, da ein wenig; damit sie hingehen und rückwärts stürzen und zerschmettert werden, sich verstricken lassen und gefangen werden. Darum hört das Wort des HERRN, ihr Männer der Prahlerei, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist! (Jes 28,11-14).
Durch die Jahrhunderte redete Gott zu Israel durch die Propheten in der Klarheit und Verständlichkeit der von Gott gereinigten und geheiligten Hebräischen Sprache. Doch besonders die reiche, wohlhabende und regierende Oberschicht im Volk wollte nicht darauf hören. Deswegen kündigt Gott an, dass er ein Mittel der Verständigung gebrauchen wird, welches sehr ungewöhnlich ist. Der griechische Text in Jesaja 28,13-14 (eingeschlossen eine freie Übersetzung) lautet: „und sein wird an sie das Wort des Herrn des Gottes θλῖψις ἐπὶ θλῖψιν (Drangsal auf/über Drangsal) ἐλπὶς ἐπ‘ ἐλπίδι (Hoffnung auf/über Hoffnung) ἔτι μικρὸν ἔτι μικρόν (so ein kleinwenig, so ein kleinwenig) ἵνα πορευθῶσιν καὶ πέσωσιν εἰς τὰ ὀπίσω (dass sie hingehen und nach hinten fallen) καὶ κινδυνεύσουσιν καὶ συντριβήσονται καὶ ἁλώσονται (und zerschmettert werden, sich verstricken lassen und gefangen werden) διὰ τοῦτο ἀκούσατε λόγον κυρίου ἄνδρες τεθλιμμένοι καὶ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ τούτου τοῦ ἐν ιερουσαλημ (deswegen hört dies Wort des Herrn, Männer der Prahlerei und Beherrscher dieses Volkes, welches in Jerusalem wohnt).
Da wo die deutschen Übersetzungen im Vers 13 „zaw la zaw, kaw la kaw“ haben, übersetzt die LXX mit: „θλῖψις ἐπὶ θλῖψιν“ (Drangsal auf Drangsal) „ἐλπὶς ἐπ‘ ἐλπίδι“ (Hoffnung auf Hoffnung). Der Text im Griechischen lässt sich zwar leichter übersetzen, bleibt aber, wie auch der Hebräische, in seiner Deutung und Anwendung schwer verständlich. Eindeutig ist, dass Gott mit dieser boshaften Führung des Volkes ins Gericht gehen wird, denn er hört sehr wohl, was sie sagen, ja, er zitiert sogar ihre boshaften, frechen Aussagen (Jes 28,14-15). Doch worauf sie ihre Sicherheit bauen, wird einstürzen, sie werden fallen und gefangen weggeführt werden.
Lesen wir weiter, was Gott sagt: „So höret nun des HERRN Wort, ihr Spötter, die ihr herrscht über dies Volk, das in Jerusalem ist. Ihr sprecht: Wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich einen Vertrag gemacht. Wenn die brausende Flut daherfährt, wird sie uns nicht treffen; denn wir haben Lüge zu unsrer Zuflucht und Trug zu unserm Schutz gemacht. Darum spricht Gott der HERR: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht“ (Jes 28,14-16). Sicher ist, dass die Verheißung Gottes, in Zion einen auserwählten Eckstein zu legen, von den Aposteln auf den Christus bezogen wurde (Röm 9,33; 1Petr 2,6-7). Ja, selbst Jesus bezog ihn auf sich in der Diskussion mit den Juden in Jerusalem (Mt 21,42-44; Ps 118,22). Nicht von ungefähr steht diese Verheißung im Textzusammenhang unseres Themas.
Der Prophet Jesaja wurde etwa um das Jahr 770 geboren und 739 (im Todesjahr des Königs Asarja/Usija) also mit etwa 30 Jahren vom Herrn zum Propheten berufen (Jes 6,1). Er übte großen Einfluss auf die Königsfamilien aus, beriet und ermahnte die Könige und Oberen in Jerusalem. Mit zum Teil harten Worten brandmarkte er das ungerechte Handeln der reichen Oberschicht in Jerusalem, aber auch in Samaria, dem Nordreich, wo etwa zur gleichen Zeit der Prophet Hosea im Auftrag Gottes wirkte.
Der oben zitierte Text gibt Einblick in die Situation und den geistlichen bzw. sehr ungeistlichen Rede- und Lebensstil der regierenden Oberschicht in Juda und Jerusalem. Das Hauptproblem kann mit folgenden Worten beschrieben werden: „Sie wollten nicht hören, was Gott ihnen in ihrer, für sie sehr verständlichen hebräischen Sprache sagte“. Auf diesem Hintergrund stechen folgende Worte geradezu heraus: „Ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Zunge wird er (der Herr) zu diesem Volk reden, … Aber sie wollten (oder werden) nicht hören.“
Der Apostel Paulus zitiert als Einziger im Neuen Testament dieses Prophetenwort, und zwar in einem ganz bestimmten thematischen wie auch praktischen Zusammenhang, auf den später noch im Detail eingegangen wird. Hier nur das Zitat aus 1Korinther 14,21 mit einer wesentlichen Wahrheit, die zum besseren Verstehen unseres Themas beitragen kann. „Im Gesetz steht geschrieben (Jesaja 28,11-12): »Ich will in andern Zungen und mit andern Lippen reden zu diesem Volk, und sie werden mich auch so nicht hören, (eis-akou-sontai) lalian – Rede) nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt!“ (Joh 8,43; nicht hören – 6,60: nicht verstehen – 10,20; was anderes verstehen als gesagt wurde – 12,37).
Nach der Aussage des Propheten Jesaja und auch dem Zitat des Paulus, geht es um Menschen, die nicht hören wollen, was Gott sagt (Jes 28,12b). Und das „nicht hören wollen“ ist einer der Gründe, warum Gott zu diesem Volk in anderen Sprachen reden wird. Sicher nicht um sie zu ärgern, sondern um sie aufzurütteln, um sie zum Staunen zu bringen und damit zum Hinhören. Doch gleichzeitig wird vorausgesagt, dass sie auch so nicht hören werden (Jes 28,12b; 1Kor 14,21b). Solch eine ablehnende Haltung gegenüber Gottes Reden wird besonders der führenden Schicht in Juda und Jerusalem zugeschrieben. Es gab jedoch immer eine Minderheit, welche auf Gott hörte und ihn suchte.
Doch das „nicht hören wollen“ begann schon in Ägypten (2Mose 6,9: „aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut und harter Arbeit“).
– Im Rückblick der Geschichte Israels aus der Zeit der Wüstenwanderung, beklagt und bekennt Nehemia in seinem Gebet zu Gott (um die Mitte des 5. Jh.): „und weigerten sich zu hören und gedachten auch nicht an deine Wunder, die du an ihnen tatest, sondern sie wurden halsstarrig und nahmen sich fest vor, zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren.“ (Neh 9,17).
– Durch den Propheten Jesaja hält Gott seinem Volk vor: „Denn ich rief und niemand antwortete, ich redete und sie hörten nicht und taten, was mir nicht gefiel, und hatten ihre Lust an dem, woran ich kein Wohlgefallen hatte.“ (66,4).
– Und auch durch den Propheten Jeremia beklagt Gott: „Aber sie wollten nicht hören noch ihre Ohren mir zukehren.“ (7,24). „Aber sie hörten nicht und kehrten mir ihre Ohren nicht zu, sondern blieben halsstarrig, dass sie ja nicht auf mich hörten noch Zucht annähmen.“ (Jer 17,23).
– Und Sacharia beklagt: „und machten ihre Herzen hart wie Diamant, damit sie nicht hörten das Gesetz und die Worte, die der HERR Zebaoth durch seinen Geist sandte durch die früheren Propheten. Daher ist so großer Zorn vom HERRN Zebaoth gekommen. Und es ist so ergangen: Gleichwie gepredigt wurde und sie nicht hörten, so wollte ich auch nicht hören, als sie riefen, spricht der HERR Zebaoth.“ (Sach 7,12-13).
Diese Texte heben die Bedeutung des Hörens auf Gott hervor. Und sie machen deutlich, dass im Laufe der Geschichte des Volkes Israel, das „nicht hören auf Gott“ bei den meisten die Regel war und das „Hören auf Gott“ sich meistens nur auf eine Minderheit bezog. Der Apostel Paulus schreibt, dass der Glaube aus dem `Hören` (kommt), das Hören aber durch das Wort (die Aussprüche) Christi (kommt) (Röm 10,17). Das griechische Wort für hören ist `ako¢`, für die Verbform `ich höre – ακούω – akouö`. Das uns bekannte Wort `Akustik` kommt aus dem Griechischen – Hören.
Gott hat das Gehör, das Hörvermögen beim Menschen geschaffen und auf diesem Wege kommuniziert er mit dem Menschen. Dem Hören, Hinhören, Horchen, Aufhorchen folgt dann das Gehorchen. Das Annehmen oder Aufnehmen des Gehörten bezeichnet die Bibel als `glauben`. Weil jedoch die Israeliten so oft nicht hörten, blieb auch der Glaube aus. Weil sie nicht glaubten, verfielen sie in allerlei Arten von Aberglauben und Götzendienst.
Schon durch Mose ließ Gott sagen:
Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern; dem sollt ihr gehorchen. (in der LXX: akouseste – hört, Imp.) Ganz so wie du es von dem HERRN, deinem Gott, erbeten hast am Horeb am Tage der Versammlung und sprachst: Ich will hinfort nicht mehr hören die Stimme des HERRN, meines Gottes, und dies große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der HERR sprach zu mir: Sie haben recht geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben; der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde. Doch wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen redet, von dem will ich’s fordern. (5Mose 18,15-19).
Der Hebräerbriefschreiber macht deutlich: „Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn.“ (Hebr 1,1-2). Wird Israel auf diesen Propheten hören? Und es kam so, dass ein Großteil des Volkes unter der Führung der Priesterschaft und religiösen Elite, auf diesen von Gott gesandten und beauftragten Propheten Jesus nicht hörte. Dadurch erfüllte sich die Voraussage zum Fall, der Gefangenschaft und Zerstreuung (Jes 28,11-14; Lk 19,41-44). Doch dies kam später. Zuvor jedoch bekam Israel das Zeichen der fremden Sprachen von Gott und dies geschah am Pfingsttag, völlig unerwartet zum großen Erstaunen und zur Bestürzung des Volkes Israel.
5. Teil: Die Sprachen-Gabe am Pfingsttag – ein ZEICHEN für Israel?!
Einleitend zunächst folgende Fragen und Anmerkungen:
- Das Sprachenwunder an Pfingsten ist nach den Worten von Petrus ausdrücklich die Erfüllung der Prophetie aus dem Propheten Joel Kapitel 3,1-3.
- Ist das Sprachenwunder am Pfingsttag vielleicht auch die Erfüllung der Prophetie aus Jesaja 28,11-12, obwohl der Apostel Petrus keinen Bezug darauf nimmt?
- Benutzt Gott nun als neuen Kommunikationsweg zu Israel am Pfingsttag fremde/andere Sprachen, um ihnen die Frohe Botschaft der Erlösung mitzuteilen?
- Besteht da ein Zusammenhang zur Sprachverwirrung, indem er nun die bestehenden Sprachen zur Ausbreitung der Frohbotschaft unter alle Nationen einsetzt?
- Oder ist es Gottes Antwort auf mehrere Fragen bzw. Verheißungen, die in seiner Heilsgeschichte bis dahin noch nicht erfüllt waren?
- Was war der Inhalt der verschiedenen Sprachen am Pfingsttag?
Wir wollen die Inhalte des Textes aus der Apostelgeschichte 2,1-18 im großen Zusammenhang der Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk kennenlernen. Dies trägt zum besseren Verständnis unseres Themas bei. Erst danach versuchen wir ,daraus bestimmte Schlüsse zu ziehen. Der deutsche Text ist der Elberfelder Bibelübersetzung entnommen. „Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen.“ (2,1). Wer war wann und wo einmütig beieinander? Durch Mose ordnete Gott an: „Dreimal im Jahr soll alles bei dir, was männlich ist, vor dem Angesicht des Herrn, HERRN, des Gottes Israels, erscheinen.“ (2Mose 34,23; vgl. 5Mose 16,16). Allerdings sind weit nicht alle diesem Gebot nachgekommen, sogar von Josef und Maria lesen wir, dass sie lediglich nur einmal jährlich nach Jerusalem pilgerten und zwar zum Passahfest (Lk 2,41).
Eins dieser drei Feste war das Wochenfest, oder auch Pfingstfest genannt, weil es sieben Wochen nach dem Passah bzw. am fünfzigsten Tag nach dem Passah gefeiert werden musste (5Mose 16,9).
In der Apostelgeschichte 1,13-14 listet Lukas die Namen der elf Jünger Jesu auf, dazu Frauen (im Plural) Maria, die Mutter Jesu und dessen Brüder. Nach dem Abschied von ihrem Herrn Jesus auf dem Ölberg bei Bethanien und auf dessen Anweisungen kehrten sie zurück nach Jerusalem. Sie stiegen hinauf in das Obergemach eines Hauses. Es kann sich um das Haus gehandelt haben, in dem sich die Jünger während des Todes und nach der Auferstehung von Jesus aufgehalten haben (Joh 20,19-24). Vielleicht oder wahrscheinlich ist es dasselbe Haus mit einem Oberzimmer (Saal) in dem die Jünger mit ihrem Herrn das letzte Passahlamm aßen und bei dem Jesus das Herrenmahl mit der neuen Bundesstiftung eingesetzt hatte (Mk 14,14; Lk 22,12), denn auch dort ist von einem großen und gepolsterten Raum im Obergeschoß des Hauses die Rede.
Die Formulierung des Lukas in Apostelgeschichte 1,13: „wo sie sich aufzuhalten pflegten“, verstärkt die oben erwähnte Annahme. In diesem Haus verbrachten sie die nächsten 10 Tage im Gebet (zwischendurch auch im Tempel). Gleich in Vers 15 des ersten Kapitels erwähnt Lukas fast nebenbei, dass die Zahl/Namen, der Jünger (wörtlich Menge) ungefähr 120 war. Bei dieser großen Versammlung erfolgte unter der Leitung des Petrus die Wahl des 12. Jüngers (Matthias) zum Apostel an Judas statt. Nirgendwo wird auch nur andeutungsweise dieses Vorgehen des Petrus vom Herrn oder anderen Autoritäten getadelt oder infrage gestellt. Von der Volksmenge werden die im Haus Versammelten später als Galiläer identifiziert (Apg 2,7). Gut möglich, dass die 70/72 Jünger aus Galiläa auch unter diesen Versammelten waren. Doch ist es nicht ausgeschlossen, dass sich Jesu Freunde aus Bethanien und andere Gläubige aus Judäa, wie Nikodemus und Josef aus Arimathea mit unter den etwa einhundertundzwanzig befanden. Es ist auffallend, dass sie sich an diesem vom Gesetz vorgeschriebenem Fest nicht im Tempel, sondern seit den frühen Morgenstunden in einem Privathaus aufhielten (Apg 2,1-2).
„Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen (¢chos – Schall, Hall) als (ösper – wie, sowie) führe ein gewaltiger Wind daher, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen.“ (Apg 2,2).
Dem Kommen des Heiligen Geistes ging ein gewaltiges Rauschen voraus (vgl. dazu 2Mose 19,16 – Bundesschluss am Sinai). Dieses Rauschen wird mit dem Echo/Schall eines plötzlich daherfahrenden, gewaltigen Windes verglichen. Es ist also kein physischer realer Wind, sondern ein vom Himmel her kommendes Geräusch, das mit einem Wind verglichen wird. Jesus selbst vergleicht das Wirken des Geistes mit dem Wind (Joh 3,7-8). Dieses Geräusch erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen und es war in der Stadt Jerusalem zu hören (Apg 2,6). „Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen (diamerizomenai glössai) wie (ösei) von Feuer, und sie (die Zungen/Sprachen) setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen.“ (Apg 2,3). Die gemalten Bilder, welche das Pfingstgeschehen darstellen, zeigen aneinandergereihte feurige Zungen, die pfeilartig über den Häuptern schweben. Doch auch hier benutzt Lukas das vergleichende Wörtchen `ösei – wie‘ vor dem Wort Feuer und macht damit deutlich, dass es sich nicht um physisches Feuer handelt.
Aber auch das Phänomen Feuer, wie auch der Wind hat seine Verwendung am Sinai gehabt (2Mose 3,2ff; 19,18). Auch ist hier von keinem Mischmasch oder Durcheinander der Sprachen die Rede, sondern wie das griechische Wort `dia–meri-zomenai gössai`‘ deutlich macht, wird die klare Trennung oder genauer gesagt Unterteilung der einzelnen Sprachen hervorgehoben. Es wird auch betont, dass sich diese klar differenzierten Sprachen auf einen jeden Einzelnen setzten/niederließen. Wenn wir davon ausgehen, dass sich in diesem Haus etwa hundertundzwanzig gläubige Menschen befanden, dann könnten es ebenso viele Sprachen gewesen sein. Gleichzeitig „wurden sie alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen (eterais glössais) zu reden (lalein) wie der Geist ihnen gab auszusprechen.“ (Apg 2,4).
Das erfüllt werden mit dem Geist Gottes ist die Erfüllung der Zusage Gottes durch den Propheten Joel (Joel 3,1ff)
- durch Johannes den Täufer (Mt 3,11; Lk 3,16) und
- durch Jesus selbst (Joh 14,16. 26; 15,26; 16,7; Lk 24,49; Apg 1,5).
Die Notiz: „Wie der Geist ihnen gab auszusprechen“ lässt offen, ob sie gleichzeitig oder nacheinander redeten. Fast unbegreiflich, doch jeder von ihnen redete in einem anderen Dialekt (Apg 2,6). Das griechische Wort `dialektos – Mundart` wird von der Wortwurzel `λlex` für `Wort` und der die Worte oder Sprachen trennenden, bzw. teilenden Vorsilbe `dia – durch` gebildet und heißt im Deutschen `Mundart`. Dadurch wird die Differenzierung der einzelnen Sprachen bzw. Sprachuntergruppen noch genauer hervorgehoben. Aus dem Text ist nicht ersichtlich, ob die Redenden selbst verstanden, was der Geist sie aussprechen ließ. Doch sie redeten nicht in den Wind (1Kor 14,9), sondern sie wurden von den in Jerusalem anwesenden Menschen verstanden. Etwas noch nie Dagewesenes schafft Gott mit dem Kommen des Heiligen Geistes. Es war also ein Sprachen-Rede-Wunder oder Zeichen.
„Es wohnten (katoikountes) aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation unter dem Himmel.“ (Apg 2,5). Der Begriff `katoikountes`, den Lukas an neun weiteren Stellen gebraucht, meint nicht Pilger oder Durchreisende, sondern in diesem Fall in Jerusalem `Wohnende, Ortsansässige` (vgl. dazu: Lk 13,4; Apg 2,9; 2,14; 9,22.32.35; 13,27; 19,10; 22,12). So lesen wir später in der Apostelgeschichte von Einzelnen, aber auch ganzen Gruppen von Menschen jüdischer Herkunft, die zwar im Ausland geboren und aufgewachsen sind, doch zu dem besagten Zeitpunkt ihren festen Wohnsitz in Jerusalem hatten. Als Beleg hier einige Beispiele:
- Josef/Barnabas, der gebürtig von Zypern war, aber in Jerusalem wohnte und sogar einen Acker besaß (Apg 4,36).
- In Apostelgeschichte 6,9 lesen wir von der Synagoge (einer jüdischen Versammlung) der Libertiner, Kyrenäer und Alexandriner und derer aus der Provinz Asien, die sich gegen Stefanus auflehnten. Diese alle waren in den jeweils genannten Provinzen oder Städten der Diaspora geboren und aufgewachsen, wohnten `katoikountes` aber zur Zeit in Jerusalem.
- Einige jüdische Zyprioten und Kyrenäer, die in Jerusalem wohnten `katoikountes` und zum Glauben an Jesus Christus kamen, verließen wenige Jahre später ihren Wohnsitz Jerusalem und gingen bis Antiochia (Apg 11,20) und verkündigten dort das Evangelium von Jesus Christus.
- Ein Jünger der ersten Generation namens Mnason, der ebenfalls Zypriot war, also als Jude auf Zypern geboren bzw. dort aufgewachsen war und später in Jerusalem wohnte und in seinem Haus Paulus mit dessen Begleitern gastlich aufnahm (Apg 21,16).
- Selbst von Paulus wissen wir, dass er, obwohl in Tarsus (Kilikjen) geboren, als Jugendlicher viele Jahre in Jerusalem lebte und zu den Füßen Gamaliels studierte (Apg 22,3).
- Auch die Schwester des Paulus ist mit Sicherheit in Tarsus geboren wie auch ihr Bruder Saul, doch sie lebte/wohnte mit ihrem Sohn ebenfalls in Jerusalem (Apg 23,16).
Daher wird der Begriff `katoikountes` auch in unserem Zusammenhang das gleiche bedeuten. Der Bericht über die, bei der täglichen Brotverteilung vernachlässigten Witwen der `Helenisten` gegenüber den Hebräischen, unterstreicht zusätzlich diese Annahme (Apg 6,1). Die Hellenisten (Ell¢nistön) waren Juden, die aber in der griechischen Kultur beheimatet waren, sozusagen hellenisierte Juden. Aus den oben angeführten Gründen können wir schließen, dass zur Zeit des Pfingstfestes, davor und auch danach, viele (ausländische) Juden in Jerusalem wohnten/lebten, die aus verschiedenen Ländern und vermutlich aus religiösen Gründen (Messiaserwartung) nach Jerusalem umgezogen waren und dort zur Zeit des Passah (Apg 2,23) und des Pfingstfestes des Jahres 33 n. Chr. ihren festen Wohnsitz hatten.
Dieser Tatbestand schließt selbstverständlich die Anwesenheit vieler Pilger beim Pfingstfest aus dem Kernland Israels und auch aus der Diaspora mit ein. Diese Pilger kann man hier voraussetzen, weil es auch durch folgende Aussage bestätigt wird: „und die hier weilenden (vorübergehend sich aufhaltenden) Römer, sowohl Juden als auch Proselyten.“ (Apg 2,10b; vgl. dazu Apg 17,21 – „dort weilenden Gästen/Fremden“). Es handelt sich hier um römische Bürger jüdischer Herkunft und um römische Bürger aus den Heiden, welche durch Beschneidung und Proselytentaufe zum Judentum konvertierten.
„Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart (idia dialektos) reden hörte.“ (Apg 2,6). So befanden sich in diesen Tagen viele Tausende Juden aus aller Welt in Jerusalem, einschließlich derer, die im Land geboren wurden und höchstwahrscheinlich auch Gäste aus dem Ausland. Viele von ihnen waren zu dieser frühen Vormittagszeit bereits im Tempel oder unterwegs dorthin. Man stelle sich die Volksbewegung vor, die sich auf einmal zu dem Haus beeilte, aus dem das laute Geräusch zu hören war. Während die Masse der Menschen dorthin eilte, traten anstelle des undefinierten lauten Geräusches klar vernehmbare und für alle verständliche Sprachen. Denn jeder, der hier wohnenden oder angereisten Juden, auch Proselyten, hörten aus der Sprachenvielzahl ihren eigenen Dialekt, bzw. die Sprache des Landes, in dem sie geboren wurden, deutlich heraus. Es war also ein Sprachen-Rede-Wunder-Zeichen.
„Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten: Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind?“ (Apg 2,7-8). Die Liste der Volksgruppen, welche Lukas aufführt, ist sehr bunt, obwohl die Bemerkung „von jeder Nation unter dem Himmel“ erkennen lässt, dass sie weit nicht vollständig ist.
- Parther (Gebiet des Iran).
- und Meder (im Gebiet des Iran).
- und Elamiter (Südwesten des heutigen Iran).
- und die Bewohner von Mesopotamien (Gebiete im Zweistromland – Euphrat und Tigris).
- und von Judäa (also auch einheimische Juden hörten ihre hebräische/jüdische Sprache/Dialekt).
- und Kappadozien, (Gebiet in Mittelanatolien).
- Pontus (Gebiet am Südufer des Schwarzen Meeres).
- und Asien, (gemeint ist hier Kleinasien in der heutigen Westtürkei).
- und Phrygien (westlicher Teil des Hochplateaus Anatoliens).
- und Pamphylien, (Gebiet um das heutige Antalya in der Südtürkei).
- Ägypten (etwa in den gleichen Grenzen wie heute).
- und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin (das heutige Libyen in Nordafrika).
- und die hier weilenden (epidemountes – sich vorübergehend aufhaltenden) Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, (gemeint sind hier römische Staatsbürger jüdischer Herkunft sowie römische Staatsbürger, die durch Beschneidung und die Proselytentaufe zum Judentum übertraten).
- Kreter (von der Insel Kreta).
- und Araber – (Sinai, Arabische Halbinsel).
wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen: Was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend: Sie sind voll süßen Weines.“ (2,9-13).
Von den Bemerkungen, die aus der Menge kamen, ist Folgendes abzuleiten:
- Der Inhalt der Sprachenrede ist uns nur unter der Überschrift überliefert und diese lautet: „Die Groß-Taten Gottes!“ Auch wenn wir nicht sagen können, was da im Detail geredet wurde, so sind doch die bekannten Kraftwirkungen Gottes aus der biblischen Überlieferung den meisten Juden bekannt gewesen und daher gaben sie den ausgesprochenen Inhalten diese Überschrift. Sicher redeten sie auch von den Großtaten Gottes durch Jesus Christus. Diese Proklamation der Taten Gottes in Redeform/Verkündigung war eine Ehrung und Verherrlichung Gottes auf der einen Seite und gleichzeitig ein inhaltsvolles Zeugnis und Zeichen für das Volk der Juden, die bis dahin im Unglauben verharrten. Ja, seit der gewaltigen und herrlichen Offenbarung Gottes am Berg Sinai, gab es nicht Desgleichen.
- Dieses Rede-Zeugnis ist auch deshalb bewundert worden, weil es von einfachen (nicht in Jerusalem theologisch ausgebildeten) Leuten kam – sie werden nämlich als Galiläer erkannt. Auch damit setzte Gott ein deutliches Zeichen – Er beruft und bevollmächtigt, wen Er will (1Kor 1,20).
- Aus der Menge wurde die Frage laut: „Was mag dies sein?“ Dies kam von Menschen, welche für Gottes Wirken offen waren. Ob jemand jedoch an die Prophetie aus Jesaja 28,11-12 dachte? Auch wenn in diesem Textzusammenhang nicht auf jene Prophetie Bezug genommen wird, bleibt doch die Tatsache bestehen, dass gerade an diesem Tag in Jerusalem, der heiligsten Stätte der Juden, und vor Israel, durch das Wirken des Heiligen Geistes in anderen Sprachen gesprochen wurde. Das mag für viele nationalistisch und orthodox geprägte Juden ein Ärgernis gewesen sein. Die Vermutung liegt doch nahe, dass viele der nach Jerusalem umgesiedelten Juden sich aus guten und frommen Gründen von ihrer heidnischen Umgebung bewusst auch räumlich lösen wollten. Und was erleben sie in Jerusalem? In denen für sie verdorbenen, unreinen Sprachen der Heiden, von denen sie möglicherweise geflüchtet sind, werden die Heilsgeschichten Gottes in Jerusalem mit solch einer Begeisterung erzählt. Das bringt Staunen hervor und sie fragen: „Was soll das bedeuten“?
- Es gab, wie immer und überall auch die Ungläubigen, die über die heiligen Dinge spotteten. Ihre Aussage: „Sie sind voll süßen Weins“ spricht gegen sie und auch gegen die Wahrheit. Die Weintraubenernte begann in Israel einige Wochen später. Diese Aussage erinnert an die Menschen, welche sich einige Monate vorher und ebenfalls in Jerusalem mit ähnlich spöttischen Bemerkungen gegen Jesus stellten (Joh 10,20 – „Viele unter ihnen sprachen: Er hat einen bösen Geist und ist von Sinnen; was hört ihr ihm zu“). An ihnen (und der Mehrheit des Volkes) erfüllte sich, was Gott vorausgesagt hatte: „Aber sie wollen (werden) nicht hören.“ (Jes 28,12b; Paulus sagt dazu in 1Korinther 14,21-22: „Im Gesetz steht geschrieben: »Ich will in andern Zungen und mit andern Lippen (eteroglossois kai cheilesin eteron) reden zu diesem Volk, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr.« Darum ist die Zungenrede (glossai) ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen; die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen.“ Aus der Prophetie durch Jesaja und das entsprechende Zitat durch Paulus könnte man schließen, dass dieses Sprachen-Rede-Wunder in Jerusalem am Pfingsttag als Zeichen für das bis dahin ungläubige Israel gegeben wurde.
- Interessant ist der Einstieg der Predigt des Petrus, bei dem er auf die spöttischen Bemerkungen der Ungläubigen Bezug nimmt. Damit widerlegt er mutig und auf logische Weise die unsinnige Behauptung der Ungläubigen. In seiner Predigt nimmt er zwar nicht Bezug auf Jesaja 28,11ff, zieht aber für das Pfingstgeschehen eine weit positivere Verheißung aus dem Propheten Joel heran. Deutlich steht damit das Kommen des Heiligen Geistes im Vordergrund und erst dann seine Wirkungen in und durch Menschen – das Reden in anderen Sprachen.
„Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: „Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund, und hört auf meine Worte!“ Warum Petrus in seiner Anrede die Bewohner Jerusalems und Judäas ausdrücklich nennt, die angereisten Pilger jedoch nicht erwähnt, mag darin liegen, dass der größere Pilgerstrom an Passah und im Herbst zum Laubhüttenfest nach Jerusalem kam, aber weniger zum Wochenfest.
„Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages“ (etwa 9h vormittags); sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist: „Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen (ekcheö) werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen (prophetisch reden), und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben; und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen (ekcheö) und sie werden weissagen (prophetisch reden).“ (Apg 2,14-18; Joel 3,1-2).
Das Reden in verschiedenen Sprachen/Dialekten am Pfingsttag war, wie Petrus es deutet, prophetisches Reden (Weissagen). Denn zu dem prophetischen Reden gehört nicht vordergründig oder zwingend eine Voraussage, sondern, wie hier deutlich wurde, die Proklamation, das Bekanntmachen, das Erinnern an die großen Taten Gottes in der Geschichte mit der Anwendung bzw. Bezugnahme auf die Gegenwart. Genau dies ist hier geschehen, zwar in verschiedenen Sprachen, aber für alle Zuhörer verständlich.
Schlussfolgerungen:
- Die größte Gabe Gottes an Pfingsten ist der Heilige Geist selbst.
- Der Heilige Geist kommt jedoch nicht leer, sondern bringt verschiedene Gaben mit sich, eine davon ist die Sprachen-Gabe. In diesem Fall diente diese Gabe als Werkzeug für die prophetische Rede. Mose wünschte schon in der Wüste, dass das ganze Volk weissagen könnte (4Mose 11,28-29). Es war auch später der Wunsch des Paulus an die Korinther (1Kor 14,5). Ausdrücklich werden auch Frauen mit dem prophetischen Reden ausgestattet, was sich später an verschiedenen Orten wiederholte (Apg 21,9; 1Kor 11,5).
- Diese Sprachen-Gabe, zunächst nur an Gläubige aus den Juden gegeben, soll auch als erstes für die noch ungläubigen Juden ein Zeichen sein. Denn sie haben im Großen und Ganzen durch ihre Führung Jesus nicht angenommen, sondern abgelehnt (so Petrus in Apg 2,23). Dadurch wurde diese Gabe zum Zeichen für die Ungläubigen in Israel (so die Erklärung des Paulus in 1Korinther 14,22, der sich auf Jesaja 28,12-13 bezieht).
- Weil Gott durch den Heiligen Geist alle Sprachen (pauschale Aussage) an Pfingsten einbezogen hat, erklärte er diese auch für rein bzw. als anerkannt und brauchbar für die Verbreitung des Evangeliums. Ähnliche Parallele in Apg 10,15.35 – allerdings dort auf alle Menschengruppen bezogen. Gott betreibt hier keine Wiederherstellung der einen ursprünglichen Sprache, die vor dem Turmbau zu Babel gesprochen und von allen verstanden wurde, sondern bezieht vorhandene Sprachen in seinen Plan einfach mit ein.
- Da Sprachen für konkrete Völker oder Kulturen stehen, sind damit auch alle Völker in das Heil Gottes einbezogen. Dies stimmt völlig mit dem Missionsauftrag Jesu in Matthäus 28,19 überein.
- Die Juden, insbesondere die aus der Diaspora nach Jerusalem umgesiedelten, sind damit, wenn auch indirekt, beauftragt, das Evangelium unter den jeweiligen Völkern, unter denen sie bereits gelebt hatten und deren Sprachen sie sprechen, zu bezeugen. Wer, wenn nicht gerade diese Juden, sind gut geeignet für die Völkermission in ihren Heimatländern, beginnend in den Synagogen der Juden. Erstaunlich, wie bald dies praktiziert wurde.
- Apg 11,19: „Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden.“
- Apg 11,20-21: „Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen (Helenisten-Juden, die griechisch lebten) und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn.“
- Apg 9,1-2: „Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gebunden nach Jerusalem brächte.“ (Apg 9,21). Wer hat das Evangelium schon vor Aposteleinsatz nach Damaskus gebracht? Waren es nicht die Diasporajuden?
- Das Pfingstgeschehen in einem Haus außerhalb des Tempels macht auch deutlich, dass Gott in seinem Wirken von nun an nicht mehr an die heilige Stätte der Juden (den Tempel auf dem Zionsberg) gebunden ist. Jesus sagte dies bereits voraus (Joh 4,19-24).
- Das Pfingstwunder macht deutlich, dass Gott in seinen Mitteilungen grundsätzlich für eindeutige und verständliche Rede ist.
Ergänzung: Prophetisches Reden durch Männer und Frauen – Apg 2,4: „wie der Geist ihnen zu reden eingab.“ (vgl. auch Apg 2,15-18).
Das Sprechen in, für sie fremden Sprachen – Apg 2,5-11: „Wir hören sie in unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden.“
6. Teil: Der Heilige Geist und seine Gaben in der Gemeinde Jerusalem
Gottes Geist ist vom Himmel herabgekommen wie es von Jesus vorausgesagt wurde. Sein Wirkungsbereich erstreckte sich über die ganze Erde (Joh 16,8-11; Offb 5,6). Doch zunächst wollen wir darauf achten, wo, wie und wodurch sich der Heilige Geist in der Gemeinde Jerusalem offenbarte. Es entsprach dem inneren Kreis, in dem die Evangelisation beginnen sollte (Apg 1,8c). Der Heilige Geist erfüllte die dort versammelten Gläubigen mit sich selbst und befähigte diese zum Zeugnis der wunderbaren Heilstaten Gottes und zwar in den verschiedensten Sprachen/Dialekten (Apg 2,4).
Diese besondere Äußerung des Heiligen Geistes in Jerusalem durch fremde Sprachen in dieser Fülle ist einzigartig und unwiederholbar. Zwar wird die Äußerung des Heiligen Geistes durch Sprachen-Rede noch an zwei anderen Orten beschrieben (Apg 10 und 19) wahrscheinlich mit ähnlichem Inhalt und zu ähnlichem Zweck, aber nicht mehr in der Fülle wie es am Pfingsttag in Jerusalem geschehen ist. Auf jeden Fall wird eine ähnliche Äußerung des Geistes in Jerusalem nicht mehr erwähnt. Petrus nimmt Bezug auf dieses besondere (und wohl auch einmalige) Ereignis, nachdem er von Cesaräa nach Jerusalem zurückkehrte (Apg 11,1ff).
So sagte er zu den Kritikern der Heidenmission: „Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso wie am Anfang auf uns“, d.h. als Begleiterscheinung äußerte sich der Heilige Geist durch die gläubig Gewordenen in Cesaräa in anderen Sprachen, ähnlich wie in Jerusalem am Pfingsttag (Apg 11,15; 10,44-46; 2,4). Dazu mehr in dem Abschnitt 8. Teil: „Die Auswirkungen des Heiligen Geistes in der Hausgemeinde des Kornelius in Cesaräa“. Dieses „am Anfang“ lässt die Vermutung zu, dass sich der Heilige Geist bei den etwa 120 Versammelten am Pfingsttag einmalig war. Und das sich der Heilige Geist in den gläubig Gewordenen nach dem Pfinmgstgeschehen (Apg 2,40-41) durchaus auch anders als mit der Sprachen-Rede-Gabe manifestieren konnte. Bevor wir jedoch der Frage nachgehen: wie sich der Heilige Geist in den Gläubigen in Jerusalem äußerte, wollen wir festhalten, welche Gaben und Befähigungen die Apostel empfingen.
- Der Heilige Geist befähigte Petrus und die anderen Jünger zum mutigen und furchtlosen Auftreten in der Öffentlichkeit: „Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte!“ (Apg 2,14).
- Apostelgeschichte 2,29a: „Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden.“
- Er befähigte den Petrus um Zusammenhänge zwischen alttestamentlicher Prophetie und neutestamentlicher Erfüllung herzustellen und diese auf die gegenwärtige Situation anzuwenden – Apg 2,16-21: „sondern das ist’s, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist“ (Joel 3,1-5); Oder Psalm 16,8-11: „Denn David spricht von ihm (dem Messias): „Ich habe den Herrn allezeit vor mir“ (Apg 2,22-28; David hat „von der Auferstehung des Christus gesagt: Er ist nicht dem Reich des Todes überlassen, und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen.“ Apg 2,29-31; Apg 2,32; „Diesen Jesus hat Gott auferweckt; des sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren; sondern er sagt selbst (Psalm 110,1): »Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten.“ (Apg 2,32-36).
- Der Heilige Geist wirkte Einsicht und Sündenerkenntnis bei den Zuhörern: „Als sie aber das hörten, ging’s ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den andern Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun?“ (Apg 2,37). Diese Wirksamkeit des Geistes Gottes hat Jesus vorausgesagt: „Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun (sie überführen) über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht; über die Sünde: dass sie nicht an mich glauben.“ (Joh 16,8-11).
- Er befähigte Petrus und die elf Apostel zu klaren Antworten auf die Fragen der Menschen: „Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße (metano¢sate – ändert eure Gesinnung, euer Denken, denkt um) und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe (Geschenk) des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird.“ (Apg 2,37-38).
- Der Heilige Geist wirkte an diesem Tag eine Wiedergeburt (geistliche Geburt) bei etwa dreitausend Menschen (Apg 2,41; Joh 3,3.5.7) und erfüllte sie mit sich selbst (Apg 2,38; Hes 11,19; 36,25-27; Joel 3,1-2).
- Der Heilige Geist wirkte bei den Gläubigen Verlangen nach Gemeinschaft mit Christus und untereinander (Herrenmahl), Verlangen nach Gebetsgemeinschaft, Hunger und Durst nach dem Wort Christi durch die Apostel (Apg 2,42).
- Der Heilige Geist wirkte Wunder und Zeichen durch die Apostel, so dass die Menschen mit Furcht (Gottesfurcht) erfüllt wurden (Apg 2,43).
- Er wirkte unter den Gläubigen sozialen Ausgleich (Apg 2,44-46).
- Er wirkte Gastfreundschaft – Häuser wurden für Versammlungen zur Verfügung gestellt, Mahlzeiten wurden dort gemeinsam eingenommen (Apg 2,44-45).
- Er wirkte Mut, Tragkraft und Freude in der Verfolgung und mutiges Bekennen vor der Obrigkeit (Apg 4,20).
- Er wirkte Einheit im Gebet und frische Geistesfülle zum Zeugnis des Wortes Gottes (Apg 4,24-31).
- Er wirkte Einheit: „Die Menge der Gläubigen waren ein Herz und eine Seele.“ (Apg 4,32; Joh 17,21).
- Er befähigte die Apostel zu Lösungen von Problemen (Apg 6,1-6).
- Der Heilige Geist erfüllte Stephanus und bevollmächtigte ihn zu wirken Wunder und Zeichen: „Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk.“ (Apg 6,8.10). Der Heilige Geist rüstete ihn aus mit Weisheit, dadurch war er den theologisch versierten Gegnern weit überlegen. Danach befähigte ihn der Geist Gottes vor dem Hohen Rat zu einem detaillierten Zeugnis über die Geschichte Israels. Dies war eine prophetische Rede in der Rückblende mit der richtigen Anwendung auf die Zuhörer (Apg 6,11-7,53).
- Der Geist Gottes befähigte die einen zum mutigen Zeugnis und Standhaftigkeit in der großen Verfolgung (Apg 8,3; 22,4), die anderen zum Verlassen der Stadt. Dadurch gelangte das Evangelium nach ganz Judäa und Samarien, die nächsten zwei Kreise, welche Jesus für die Evangelisation vorgegeben hatte (Apg 8,1; 1,8).
Wie wir sehen und erkennen, wirkt der Heilige Geist im Auftrag Jesu Christi souverän, überraschend und vielseitig. Die Gabe des Heiligen Geistes ist ein Geschenk Gottes an die Gläubigen, denn die Welt kann ihn nicht empfangen (Joh 14,17). Der Gläubig gewordene empfängt diese Gabe, wie der Text sagt: „Ihr werdet empfangen“. Um ein Missverständnis auszuräumen, hier geht es zunächst nicht um die Gaben (Charismata) des Heiligen Geistes, die er in Fülle mit sich bringt, sondern um DIE GABE – den Heiligen Geist selbst. Es ist auffällig, dass bei der Bekehrung von so vielen Menschen an diesem ersten Tag der Woche (dem Pfingsttag) von keinerlei direkten Auswirkung des Geistes (wie Reden in anderen Sprachen) die Rede ist.
Bei der nächsten Predigt forderte Petrus das Volk auf: „So tut nun Buße und bekehrt euch (denkt um und kehrt um), dass eure Sünden getilgt (juristischer Begriff) werden.“ (Apg 3,19). Das geistliche Ergebnis dieser Predigt war: „Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig; und die Zahl der Männer stieg auf etwa fünftausend.“ (Apg 4,4). Auch bei dieser zweiten großen Bekehrungswelle werden uns keine Auswirkungen des Heiligen Geistes (wie die Sprachen-Rede-Gabe) genannt, obwohl sicher ist, dass sie laut Verheißung die Gabe des Heiligen Geistes bei ihrem gläubig werden empfangen haben, wie auch bei der ersten Bekehrungswelle (Apg 2,38).
Nach der Freilassung des Petrus und Johannes aus dem Gefängnis wird von der Gemeinde ein öffentliches Lobpreis- und Anbetungsgebet angestimmt, und zwar als Prophetie. So heißt es in Apostelgeschichte 4,24-30: „Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht, du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt (Psalm 2,1-2): »Warum toben die Heiden, und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen, und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus.« Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten, mit allem Freimut zu reden dein Wort; strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus.“
Das Ergebnis war: „Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren; und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut.“ (Apg 4,31).
In diesem Zusammenhang sind die Auswirkungen des Heiligen Geistes in dreierlei Hinsicht zu erkennen:
- Die Stätte, wo sie versammelt waren, erbebte.
- Sie alle wurden (erneut) erfüllt mit Heiligem Geist (nicht zu verwechseln mit dem Empfang des Heiligen Geistes als Gabe /Geschenk bei dem gläubig werden).
- Sie redeten das Wort Gottes mit Freimut.
- Die prophetische Gabe kam hier schon im Gebet zum Vorschein, als sie aus Psalm 2 zitierten und es auf ihre Zeit anwendeten.
- Der Heilige Geist befähigte die Apostel zu Heilungen, Befreiungen von Dämonen und zu anderen Wundern (Gaben des Geistes Gottes), dadurch kamen noch viel mehr Menschen zum Glauben an Jesus Christus in Jerusalem und Umgebung. „Von den andern aber wagte keiner, ihnen zu nahe zu kommen; doch das Volk hielt viel von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten – eine Menge Männer und Frauen -, sodass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren; und alle wurden gesund.“ (Apg 4,13-16). Welch wunderbare Auswirkungen durch das Wirken des Heiligen Geistes im Volk der Juden! Eine gnadenvolle Zuwendung Gottes an Israel, wie sie vorher nicht offenbart wurde, wird hier erkennbar (Hes 36,25-27; 37: die geistliche Auferstehung in Israel). Jesus sagte voraus: „Ihr werdet noch größere Werke tun“ (Joh 14,12). Ja, das großE Erlaßjahr (das fünfzigste Jahr), welches Verheißen war und Jesus ankündigte, war voll im Gange (Jes 61,1-2; Lk 4,16ff).
In Apostelgeschichte 6,1-6 wird von der Erwählung und Berufung der sieben sogenannten Almosenpfleger berichtet. Als dies ausgerichtet war, heißt es:
- „Und das Wort Gottes breitete sich aus.“
- „und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem.“
- „Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam.“ (Apg 6,7).
Auch hier sind keine konkreten Charismen bei den Gläubigen erwähnt. Hier liegt der Schwerpunkt auf der geistlichen Ernte, die eingefahren wurde.
So können wir sehen, dass der Heilige Geist die Gläubigen mit unterschiedlichen Gaben ausgerüstet hatte. Und diese Gaben kamen dort zum Einsatz, wo sie der Herr für notwendig erachtete. Daraus entnehmen wir, dass die Sprachen-Gabe, um die es in unserem Thema geht, nur eine von vielen Gaben ist, die Gott durch das Wirken des Heiligen Geistes bislang
- an einem bestimmten Ort (Jerusalem),
- zu bestimmter Zeit (Pfingsttag)
- und für bestimmte Menschen (die Juden) zum Einsatz brachte.
7. Teil: Die Charismen des Geistes in Samaria
Alles, was bis jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes gewirkt wurde, geschah unter den Juden in Jerusalem und Judäa, das heißt im nationalen und sogar geographischen Kontext der Juden. Damit wurde erfüllt, was der Herr Jesus in seinem Auftrag an die Jünger angeordnet hatte, nämlich: „ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa.“
Als nächster geographischer und kultureller Kreis war laut Jesus: „Samarien“ (Apg 1,8) an der Reihe. Das Mischvolk der später sogenannten Samariter brachte bei der Besiedlung des Nordreichs (722/721 v.Chr.) ihre Kulte mit. Zu dem übernahm es auch Teile des jüdischen Kultes einschließlich der Beschneidung. Da die Samariter die fünf Bücher Moses – die Thora – anerkannten, standen sie theologisch und kultmäßig den Juden nahe. Daher erklärt sich auch der nächste, von Jesus vorgegebene Missionskreis. Er selbst hatte während seiner Dienstzeit Samarien mehrmals besucht (Joh 4; Lk 9; 17; Joh 7).
Nun führt der Heilige Geist nicht die Apostel, sondern den Philippus hinab in die (Haupt)Stadt der Samariter. „Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen, auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht; und es entstand große Freude in dieser Stadt.“ (Apg 8,4-8).
Es handelte sich wahrscheinlich um Sebaste, die Hauptstadt Samarias. Diese lag unweit der biblischen Stadt Sichem (heute Nablus). Philippus wurde vom Heiligen Geist mit der Gabe des Evangelisten (evangelistou) befähigt, dazu Kraftwirkungen zur Heilung von Krankheiten und Befreiung von Dämonen. Lukas berichtet: „Als sie aber den Predigten (wörtlich: der Evangelisierung – Frohbotschaftsverkündigung) des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen.“ (Apg 8,12).
Diese auffallende Evangelisationstätigkeit des Philippus in Samaria ruft die Apostel in Jerusalem auf den Plan und sie senden Petrus und Johannes dort hin, um festzustellen, was der Evangelist durch die Kraft und Wirkung des Heiligen Geistes und des Wortes ausgerichtet hat. Sie stellen unter anderem fest, dass die Gläubigen die Gabe des Heiligen Geistes noch nicht empfangen haben. Die große Freude in Samarien, die auch als Frucht des Geistes gesehen werden kann (Gal 5,22), ist verständlich und legitim für errettete Menschen, doch laut Kontext bezog sie sich mehr auf die Erfahrungen durch Wunderheilungen und Befreiungen von Dämonen (Apg 8,8). Erst durch Gebet und Händeauflegen der Apostel Petrus und Johannes empfangen die dortigen Gläubigen die Gabe des Heiligen Geistes, so lesen wir in Apostelgeschichte 8,15-17: „Die (Apostel) kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist.“
Spätestens hier entstehen bei uns eine Reihe von Fragen:
- Woran erkannte Philippus, dass die Gläubigen an Jesus Christus und auch Getauften auf seinen Namen, die Gabe des Heiligen Geistes nicht empfingen? Blieben sie stumm, gaben sie kein Zeugnis ihrer Erlösung?
- Und warum haben die gläubigen Samariter die Gabe des Heiligen Geistes nicht bei ihrem Gläubig werden empfangen? Hat Philippus ihnen in seiner Verkündigung nichts davon gesagt?
- War etwa Philippus als Evangelist nicht befähigt, die Echtheit des Glaubens bei den Samaritern zu durchschauen, wie das Beispiel von Simon dem Zauberer enthüllt?
- Oder war vielleicht gerade das noch Festhalten an diesem Zauberer Simon, der sie lange be- und verzauberte, der Grund dafür, dass der Heilige Geist bei den Gläubig gewordenen nicht einziehen konnte und wollte?
- Oder bedurfte es im Falle der Samariter (halbheidnisches Neuland, dazu Feinde der Juden) die Gegenwart und Autorität der Apostel, durch welche der Heilige Geist eindeutig die Annahme dieser Volksgruppe bestätigen und hervorheben wollte?
Es scheint klar zu sein, dass Philippus als `Einzelgänger` zwar einige für die Evangelisation wichtige und wunderbare Charismen hatte, dass er aber die Schalkheit/Falschheit des Zauberers Simon nicht durschaut hatte. Die Gabe zur Unterscheidung der Geister und zur Klärung der Echtheit des Glaubens unter den Samaritern war bei Petrus und Johannes offensichtlich vorhanden, wie auch folgende Bibelstellen bestätigen: Apg 5,1-11; 1Joh 4,1-4.
Auch wenn es schwierig ist, auf all diese Fragen eine logische Antwort zu bekommen, so kann man Folgendes festhalten:
- Der Heilige Geist wirkt nicht immer nach dem gleichen Schema.
- Der Heilige Geist sorgte dafür, dass in Samarien eine feste und echte Glaubensgrundlage gelegt wurde.
- Der Heilige Geist sorgte dafür, dass die Anerkennung der Samariter durch die gläubig gewordenen Juden in Jerusalem sichergestellt wurde, denn dies hatte weitreichende Auswirkungen. Die an Jesus Christus gläubigen Samariter sind nun anerkannt als vollwertige Gotteskinder und gehören zu Gottes Volk.
- Sicher beschenkte der Heilige Geist die gläubig gewordenen Samariter mit Gaben, da diese jedoch nicht erwähnt werden, liegt auf ihnen auch nicht der Schwerpunkt, sondern die Erlösung und auch der Empfang des Heiligen Geistes stehen im Vordergrund der Erwähnung.
Praktische Anwendung:
– Gerade bei Evangelisationen durch begabte Mitarbeiter ist Überprüfung, Nacharbeit und Festigung der Gläubig gewordenen durch weiterführende Gaben (Begabte) unerlässlich.
– Auch wenn der Heilige Geist den Philippus in seinem Dienst segnete, bleibt doch das Prinzip der `zwei Zeugen`, wie Jesus es bei seinen Jüngern für den Missionsdienst eingeführt hatte, in Kraft und sollte auch heute noch eingehalten werden (Mk 6,7; Lk 10,1).
8. Teil: Die Sprachengabe im Haus des Kornelius in Cäsarea
Inzwischen sind nach dem Pfingstereignis (33 n.Chr.) einige Jahre vergangen. Das Evangelium ist bereits in Jerusalem, Judäa, Samaria und Galiläa ausgebreitet worden. Das sind die Gebiete, in welchen Jesus mit seinen Jüngern gewirkt hatte. Dadurch waren diese Menschen für die Evangelisation vorbereitet.

Abbildung 2 Die Stadt Cäsarea wurde mit frischem Wasser aus dem etwa 8 km entfernten Karmelgebirge über dieses Aquadukt versorgt. (Foto: April 1986)

Abbildung 3 Das gewaltige Bauwerk ist in Teilen noch sehr gut erhalten und zeugt von der einstigen Bedeutung der Stadt Cäsarea am Mittelmeer. (Foto: April 1986)
Bei seinen Reisen durchs Land (die Provinz) Judäa kommt Petrus in die Städte am Mittelmeer – nach Lydda (heute Lod) und anschließend nach Joppe (heute Jaffa). Dort wirkt der Heilige Geist durch ihn Wunder und zu den bereits gläubig gewordenen Juden kommen noch viele Menschen hinzu – es ist eine landesweite Erweckung unter den Juden im Gange. Eines Tages wird Petrus von Joppe nach Cäsarea zu Kornelius gerufen, einem römischen Offizier der Kohorte `Die Italische`. Kurz zuvor war Petrus verzückt (gr. extasis) und hatte eine Vision (gr. örama – Gesicht, das Geschaute) in der Gott ihm zeigte, dass in seinen Augen und nach seiner Bewertung alle Menschen gleichwert sind (Apg 10,10-16). Die Abgesandten von Kornelius übernachten in Joppe im Haus des Gerbers Simon und am darauffolgenden Tag ging Petrus mit ihnen und in Begleitung von sechs weiteren Brüdern aus Joppe, zu der etwa 50 km nördlich gelegenen Hafenstadt Cäsarea.
Lukas schreibt: „Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Cäsarea. Kornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Kornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren.“ (Apg 10,23-27).
Mit der Ankunft in Cäsarea und ganz konkret mit dem Betreten des Hauses des Kornelius überschreitet Petrus (nach jüdischer Tradition) eine rote Linie. Er selbst sagt dazu: „Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden (allofylö – andersstämmigen) umzugehen oder zu ihm zu kommen; aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll.“ (Apg 10,28). Hier betritt Petrus nun zum ersten Mal heidnisches Terrain. Doch Gott hatte ihn zur rechten Zeit darauf vorbereitet und er kann mit Überzeugung sagen: „Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen?“ (Apg 10,29). Demnach wusste Petrus nicht, was ihn in Cäsarea erwartete, es war für ihn ein Glaubensschritt.
„Kornelius sprach: Vor vier Tagen um diese Zeit betete ich um die neunte Stunde (15h) in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann (ein Engel) vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach: Kornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir; und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist.“ (Apg 10,30-33).
Schon lange vorher hat Gott diese Menschen für seine Heilsbotschaft vorbereitet. „Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht; sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm.“ (Apg 10,34-35). Eine fundamentale Wahrheit wird hier von Petrus erkannt und ausgesprochen! Und diese ist richtungsweisend für die weitere Mission unter Nichtjuden.
Und nun beginnt Petrus mit der Predigt: „Er (Gott) hat das Wort dem Volk (den Söhnen) Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle.
Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft; der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten.
- Und er (Jesus) hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten.
Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten.“ (Apg 10,36-44).
Etwas ganz Unerwartetes und Ungewöhnliches geschieht während der Predigt des Petrus: in dem Augenblick, als er von der Vergebung der Sünden im Namen Jesu Christi spricht, erfüllt der Heilige Geist die Herzen der Anwesenden im Haus des Kornelius, und zwar gleichzeitig. Beachten wir, dass Petrus die Worte Buße und Bekehrung in seiner Predigt nicht erwähnt hatte, er betonte nur das Unentbehrliche, nämlich den Glauben an Jesus. Laut den einleitenden Worten des Kornelius waren sie alle von vornherein bereit, auf alles zu hören, was Petrus ihnen im Namen des Herrn sagen wird. Und sie waren laut der Aussage des Petrus: „Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist“ über die Geschichten von Johannes und Jesus wohl informiert. So konnte der Heilige Geist während der Verkündigung in ihnen Sinneswandlung, Umkehr und den Glauben an Jesus Christus bewirken. Dies alles und die persönliche innere Bereitschaft waren die Voraussetzungen für den Einzug des Geistes in ihre Herzen (Apg 2,37-38).
Die Wassertaufe, so dieser Bericht, ist jedoch keine Voraussetzung für den Empfang des Heiligen Geistes. Selbst Petrus und insbesondere die sechs jüdischen Begleiter aus Joppe sind überrascht und erstaunt, dass auf Menschen nicht- jüdischer Herkunft die Gabe des Heiligen Geistes, also der Geist selbst, ausgegossen wurde. Zu erkennen war dies an der Äußerung des Geistes durch das Reden in anderen Sprachen. So lesen wir: „Und die gläubig gewordenen Juden (aus der Beschneidung), die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde; denn sie hörten, dass sie in Zungen (glössais – Sprachen) redeten und Gott hoch priesen (machten Gott groß).“ (Apg 10,45-46). Im Vergleich zu dem Sprachenwunder am Pfingsttag, ist hier die Herkunft der Sprachen nicht genannt, obwohl es sich auch hier nach dem gesamten Kontext um differenzierte menschliche Sprachen gehandelt hatte. Der Inhalt muss ähnlich gewesen sein, wie damals, weil es heißt: „sie machten Gott groß“. An Pfingsten hieß es: „sie redeten von den Großtaten Gottes“. In beiden Fällen ist diese Sprachenäußerung „Gott verherrlichend“, also zu Gott hingewandt, aber für die Anwesenden (Petrus und seine Begleiter) ist es ein Weissagen (prophetisches Reden – Joel 3,1ff).
Wir wollen an dieser Stelle auf folgende Bemerkung achtgeben: „Und die gläubig gewordenen Juden (aus der Beschneidung), die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde.“ Bis dahin konnten die Gläubigen aus den Juden und bis vor kurzem sogar selbst Petrus nicht glauben, dass das Heil in Christus und die Verheißung des Heiligen Geistes auch für die Nichtjuden vorgesehen ist. So war auch hier die Sprachengabe des Geistes unter anderem ein Zeichen, ein Hinweis besonders für die anwesenden Juden, die bis dahin nicht glauben/wahrhaben wollten, dass Gott auch den Heiden Umdenken zum Leben gegeben hat (Apg 11,18). Als Petrus später nach Jerusalem zurückkehrte, konnten er und die sechs Brüder aus Joppe diese Heilstatsache glaubhaft begründen.
Schlussfolgerung:
- Die Gabe des Redens in anderen (menschlichen) Sprachen/Dialekten kann den Empfang des Heiligen Geistes bestätigen, wie diese Begebenheit zeigt. Der Heilige Geist grenzt sich jedoch nicht auf diese eine Gabe ein, sondern teilt einem jeden eine Gabe oder Gaben zu, wie er will und auch wann er will (Apg 8,17; 1Kor 12,11).
- Die Äußerung des Heiligen Geistes in anderen Sprachen/Dialekten, ist ein besonderes Zeichen für die Juden, denn dadurch bestätigt der Heilige Geist in deren Anwesenheit, dass das Heil Gottes in Jesus Christus allen Nationen gilt und dass die Juden sogar in der Pflicht sind, ihre geistlichen Güter mit den Heiden zu teilen (Mt 28,19; Röm 15,27).
„Da antwortete Petrus: Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben ebenso wie wir? Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi.“ (Apg 10,37-38). Noch einige Tage blieb Petrus in Cäsarea und festigte die Gläubigen, so entstand die erste heidenchristliche Gemeinde in Judäa durch Mitwirkung eines Apostels. Im Jahre 48 bei der Apostelversammlung in Jerusalem erinnert Petrus daran: „Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten.
- Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben wie auch uns, und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen,
- nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben.“ (Apg 15,7-9).
Auf diese Weise benutzte Gott den Petrus, der als Säule (Autorität) in der Gemeinde angesehen wurde und machte ihn zum Bahnbrecher für die künftige Heidenmission.
9. Teil: Die Gaben des Geistes in der Gemeinde Antiochien
Wir verfolgen weiter die Spuren der Ausbreitung des Evangeliums über die Grenzen des Landes Israel. Es ist offensichtlich, dass der Heilige Geist für die sogenannte Außenmission gerade diejenigen Männer jüdischer Abstammung berief und beauftragte, die ausländische Wurzeln hatten, also in einer anderen Kultur geboren und aufgewachsen waren.

Abbildung 4 Antiochien am Orontes (heute Antakya) war Provinzhauptstadt von Syrien mit weit über Hunderttausend Einwohnern. Im Februar 2023 wurde diese bedeutende Stadt durch ein gewaltiges Erdbeben größtenteils zerstört. (Foto: 9. April 2011)
So schreibt Lukas: „Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen (genauer: Helenisten – griechisch sprechende und lebende Juden) und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn.“ (Apg 11,19-21). Wir stellen Folgendes fest:
- Juden mit ausländischem Hintergrund lösten sich schneller von ihrer zweiten Heimat in Israel und gingen in die Mission.
- Weniger strenge Juden sind auch eher geeignet unter den Offeneren im Judentum zu sprechen.
- Gott gebraucht und segnet die einen und auch die anderen.
- Wenn Gottes Wort verkündigt wird, werden Menschen gläubig und bekehren sich zum Herrn.
Hier in Antiochien werden zum Empfang des Heiligen Geistes und dessen Auswirkungen keine Details genannt. Das heißt nicht, dass es diese nicht gab, aber ähnlich wie im Falle von Samaria, schicken die Apostel in Jerusalem begabte und befähigte Mitarbeiter, in diesem Fall den Barnabas (Sohn des Trostes) nach Antiochien, um die Glaubensgrundlage der neuen Jünger zu prüfen und die Gläubigen zu festigen. Seine Stärke war – voll Heiligen Geistes und Glaubens. „Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren; und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben; denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens.“ Das Ergebnis dieses Dienstes war: „Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen.“ (Apg 11,22-24).
Neben all den geistlichen Gaben hatte Barnabas auch noch die Gabe der Integration von neuen Gläubigen und Mitarbeitern. „Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt.“ (Apg 11,25-26; 9,27). Eine weitere Gabe des Geistes wird hier besonders hervorgehoben, die Gabe der Lehre. In Apg 13,1-2 wird neben der Lehrbegabung auch noch die prophetische Gabe betont und auch eingesetzt. „Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Luzius von Kyrene und Manaën, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus.“ (Apg 13,1). Eine starke Gemeinde – solche Gaben und Begabten. „Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist (anscheinend durch diese Propheten): Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe.“ (Apg 13,2).
Schlussfolgerungen:
- Auch hier wird die Sprachengabe nicht erwähnt, dafür aber andere für die Gemeinde wichtigen Gaben wie Prophetie und Lehre. Bei den Gläubigen wird die Umkehr zu Gott und der Glaube an Jesus Christus den Herrn hervorgehoben.
- Die Gabe der Barmherzigkeit und des Mitteilens ist besonders erwähnt: „Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder, nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden.“ (Apg 11,27-30; Röm 12,8).
- Es steht fest, dass gerade die Gemeinde in Antiochien (neben Jerusalem) zu einer der stärksten Missionsgemeinden wurde (Apg 13,3; 15,40).
10. Teil: Die Sprachengabe des Geistes in Ephesus
Es ist auffällig, dass Lukas in den Berichten über die erste und zweite Missionsreise des Apostels Paulus auf Zypern, im pisidischen Antiochia, Ikonion, Lystra, Derbe, Philippi, Thessalonich, Beröa, Athen, keinen Hinweis auf die Sprachengabe bei gläubig gewordenen gibt. Auch nicht in der Gründungsphase der Gemeinde Korinth, obwohl gerade dort Jahre später die Diskussion über die Praxis der Sprachenrede ausbrach.
Erst bei der dritten Missionsreise, welche den Apostel Paulus vom syrischen Antiochia über Galatien in den äußersten Westen der römischen Provinz Asia, nach Ephesus führte, berichtet Lukas von einer Auswirkung des Heiligen Geistes durch Sprachenrede der dort in Ephesus Gläubiggewordenen.Wir lesen in Apostelgeschichte 19,1-7: „Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen; und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa zwölf Männer.“

Abbildung 5 Das sehr gut erhaltene Taufbecken in der Marienkirche gibt Zeugnis, dass auch noch in den späteren Jahrhunderten Menschen auf den Namen Jesu getauft wurden (Foto: 6. März 2008).
Wir versuchen zunächst den Kontext dieser Geschichte zu beleuchten. Schon ein Jahr zuvor hatte Paulus zum Ende seiner zweiten Missionsreise hier in Ephesus kurz Halt gemacht. Bei seinem Abschied von den Juden versprach er wieder zu kommen, wenn Gott es zulässt (Apg 18,19-21). Das Ehepaar Priszilla und Aquila, welche ihn von Korinth bis hierher begleitet hatten, blieben in Ephesus mit ihrer Hausgemeinde. Beim Besuch des Apollos in Ephesus versahen die beiden den wichtigen Dienst der Nacharbeit und Vertiefung der Glaubensbeziehung zu Jesus bei Apollos (Apg 18,24-26). Dann reiste Apollos mit einem Empfehlungsschreiben weiter nach Korinth (Apg 18,27-28).
Es ist nicht leicht, die (etwa) zwölf Männer, welche Paulus in Ephesus (aufsuchte) und fand, zuzuordnen. Doch machen wir uns auf die Suche nach einer möglichen Antwort auf die Frage: wer waren die 12 Männer, aus welcher kulturellen und religiösen Gruppe kamen sie? Hatten sie Kontakt zu Aquila und Priszilla? Wenn ja, warum waren sie noch auf dem Stand der Johannes-Taufe?
- Die eine mögliche Zuordnung wäre – sie sind Juden und gehören der örtlichen Synagoge an, Unter Juden gab es Johannesjünger auch über die Grenzen des Landes Israel hinaus. Paulus suchte auf seinen Missionsreisen in der Regel zuerst Juden auf und diese fand er in der Synagoge. Es ist wahrscheinlich, dass sich auch das Ehepaar Aqula und Priszilla, trotz der neuen Glaubensbeziehung, zur örtlichen Synagoge hielten.
- Eine zweite Zuordnung wäre – sie sind Hellenisten, also gebürtige Juden, die aber wie Griechen lebten.
- Die dritte Zuordnung wäre – sie sind Proselyten, also Menschen, welche aus den Heiden durch Beschneidung und Taufe zum Judentum konvertierten.
- Eine vierte Zuordnung wäre – sie sind Heiden, die Gott fürchten. Diese standen ebenfalls der jüdischen Synagoge und dem Ein-Gott-Glauben nahe. Diese letztgenannten werden in der Apostelgeschichte als die `seboumenoi – Gottesfürchtige` genannt, ähnlich wie Kornelius in Cäsarea (Apg 10,1-2; 17,4; 18,7).
Da auch die Nachfolger des Täufers als `Jünger` bezeichnet werden, kann man diese 12 Männer dem Kreis der Johannesjünger zuordnen, die es auch in der Diaspora gab, wie das Beispiel von Apollos deutlich macht. Nach ihrem theologisch/geistlichem Stand zu urteilen gehörten die 12 Männer wohl nicht zu der Hausgemeinde von Aquila und Priszilla. Wären sie mit diesen in engerem Kontakt gewesen, hätten sie klare Informationen über Jesus und den Heiligen Geist erhalten. Halten wir also zunächst fest, dass es sich hier um die ersten Gläubigen in Ephesus handelt, welche durch den direkten Missionsdienst des Paulus zum wahren Glauben an Jesus Christus kamen. Meistens gehörten diese auch zu den späteren Gemeindeleitern oder auch überörtlichen Mitarbeitern des Apostels. Aus den späteren Texten der Apostelgeschichte des Lukas und den Briefen des Paulus werden uns einige Personen namentlich vorgestellt, die höchstwahrscheinlich zu den ersten in Ephesus gehörten.
- Epänetus – sein griechischer Name bedeutet `löblich`. Von ihm schreibt Paulus: „Grüßt Epänetus, meinen Lieben (Geliebten), der aus der Provinz Asien der Erstling für Christus ist.“ (Röm 16,5b).
- Tychikus, – die Wortwurzel seines Namens hat die Bedeutung von `Glück, Erfolg`. Möglicherweise dachten seine Eltern bei seiner Geburt an die griechische Göttin des Zufalls/Schicksals, des Glücks? Er ist aus der Provinz Asien – Ephesus (Apg 20,4; Eph 6,21; Kol 4,7; Tit 3,12; 2Tim 4,12).
- Trophimus, – sein griechischer Name hat die Bedeutung von `nährend, ernährend`. Er war einer der treuen Mitarbeiter und Begleiter des Paulus und stammte aus Ephesus Stadt (Apg 20,4; 21,29; 2Tim 4,20).
- Onesiphorus, sein griechischer Name bedeutet `der Nutzbringende`; nach den Worten des Paulus hatte er eine Hausgemeinde in Ephesus. Er leistete viele Dienste in der Gemeinde und besuchte unter Lebensgefahr den Apostel Paulus im Gefängnis in Rom (2Tim 1,16-18; 2Tim 4,19).
- Artemas, – sein griechischer Name erinnert an die Artemis der Epheser. Auch er war einer der treuen Mitarbeiter des Paulus (Tit 3,12). Ein eindeutig heidnisch/griechischer Name, doch Paulus machte wohl keinerlei Anstalten, diesen zu ändern (übrigens auch nicht bei Apollos).
Dass alle diese fünf Männer und engste Mitarbeiter des Apostels Paulus griechische Namen trugen, ist zwar noch kein letzter Beweis dafür, dass es sich um Griechen, also Heiden handelte (es könnten auch Hellenisten gewesen sein), doch einiges spricht dafür, dass sie zu der vierten Gruppe, der sogenannten `seboumenoi – Gottesfürchtige` gehörten. Aus dem Text des Lukas erfahren wir, dass Paulus erst nach der Begegnung mit den 12 Männern in die Synagoge der Juden hineinging, wo er drei Monate lang predigte. Dies spräche dafür, dass er diese 12 außerhalb der Synagoge kennenlernte. Möglich, dass sie mit Apollos im Kontakt waren, noch bevor dieser mit Aquila und Priszilla zusammengekommen war. Diese Unklarheiten machen aber auch deutlich, dass der Dienst von Aquila und Priszilla nicht ausreichte für Gemeindegründung. Doch sicher scheint, dass Paulus bei ihnen gastliche Aufnahme fand (Apg 18,3; Röm 16,3-5a). Auf jeden Fall fand Paulus diese 12 Männer nicht irgendwo auf dem Marktplatz, sondern im großen Umfeld der jüdischen Synagoge.
Im Gespräch mit den 12 Jüngern stellt Paulus fest, dass ihnen etwas fehlt und deshalb fragt er sie: „Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid?“ Anhand der Frage und der grammatischen Form macht Paulus klar, dass der Heilige Geist in der Regel zum Zeitpunkt des gläubig werden in den Menschen einzieht (Apg 2,38; Eph 1,13). Doch bei diesen Männern konnte der Heilige Geist nicht nur nicht einziehen, weil sie vom Heiligen Geist nichts wussten, sondern weil sie noch nicht an Jesus glaubten. Sie waren immer noch auf dem Stand der Johannestaufe, welche nur eine Taufe zum Umdenken war. Diese beinhaltete zwar den theoretischen, aber nicht den praktischen Glaubensbezug zu Jesus (Apg 19,4). Ihre Antwort hebt dies hervor: „Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist.“ Eine für uns schockierende Aussage, es sieht so aus, dass die Nachricht von dem Pfingstgeschehen noch nicht bis zu ihnen durchgedrungen war. Und Paulus klärt sie über den auf, auf den schon Johannes in seiner Predigt hingewiesen hatte. Sie sind bereit, sich auf den Namen von Jesus taufen zu lassen, das schließt ein, dass sie Jesus als den Messias/Retter im Glauben angenommen haben. Nun ist der Weg frei zum Empfang des Heiligen Geistes. In diesem Fall geschieht dies extra durch Händeauflegen, ähnlich wie in Samarien, auch dort legten die Apostel den Gläubigen die Hände zum Empfang des Heiligen Geistes auf. Die 12 Jünger empfangen den Heiligen Geist und nun erleben sie das Phänomen der Sprachen-Rede-Gabe und zwar mit prophetischem Inhalt – „und weissagten“, das heißt, sie redeten in verschiedenen Sprachen, ähnlich wie in Jerusalem am Pfingsttag und in Cäsarea im Haus des Kornelius.
Dieses Phänomen wird sich unter den Juden, aber auch anderen Bewohnern von Ephesus schnell herumgesprochen haben. Nun ist durch den Heiligen Geist erneut bestätigt worden, dass das Heil/Rettung anderen Nationen genauso angeboten wird wie den Juden. Damit wäre das Phänomen der Sprachen-Rede-Gabe in Ephesus mit prophetischem Inhalt auch als Zeichen für die ungläubigen Juden in der westlichen Diaspora zu werten. Ähnlich wie Petrus die Ausdrucksweise des Heiligen Geistes in Cäsarea als Beleg gegen die Kritiker aus den Juden in Jerusalem verwendete, so könnte Paulus den Juden der Diaspora (Ephesus/Asien) diese Bestätigung des Geistes bei den zwölf Männern als Beleg für die Annahme der Heiden zum Volk Gottes entgegenhalten. Schon im Pfingstgeschehen in Jerusalem konnten wir feststellen, dass die Sprachengabe nicht primär zur besseren Verständigung, sondern eher als Zeichen für die ungläubigen Juden gegeben wurde, die in Jerusalem wohnten und die aus der Diaspora nach Jerusalem umgesiedelt waren. Als Zeichen, dass Gott über die Grenzen des jüdischen Volkes und Landes hinaus allen Nationen das Heil in Christus anbietet und gerade die Juden für diese Aufgabe berufen worden sind. Davon musste Gott nicht die Heiden überzeugen, sondern die Juden, welche nicht wahrhaben wollten, dass das Heil auch den Heiden gilt (Apg 11,18; 22,21).
An dieser Stelle scheint es sinnvoll zu sein, einige Erfahrungen im Dienst der zwei namhaften Apostel – Petrus und Paulus – einander gegenüberzustellen.
– Aus dem Dienst des Petrus wird eine Befreiung aus dem Gefängnis berichtet, so auch aus dem Dienst des Paulus (Apg 4,7-11; 16,25-40).
– Aus dem Dienst des Petrus wird eine Totenerweckung berichtet, so auch aus dem Dienst des Paulus (Apg 9,39-42; 20,8-12).
– Aus dem Dienst des Petrus wird ein Gesicht (orama) berichtet, wodurch Petrus Neuland betreten sollte (Kornelius) so auch im Dienst des Paulus, als er in einem Gesicht (orama) den Mazedonierruf sieht und hört, der ihn zum Betreten des Neulandes Mazedonien auffordert (Apg 10,10-20; 16,9).
– Aus dem Dienst des Petrus wird ein Empfang des Heiligen Geistes mit Sprachengabe als Auswirkung in einem heidnischen Kontext in Cäsarea berichtet, so auch aus dem Dienst des Paulus in Ephesus (Apg 10,28-48; 19,1-7).
Diese Parallelen sind von Lukas nicht zufällig aufgeschrieben worden. Sie heben das herausragende Handeln des Heiligen Geistes durch besondere Vollmachten der beiden Apostel hervor. So schreibt Paulus in Galater 2,7-9: „da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden so wie Petrus das Evangelium an die Juden – denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden -, und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten.“
Die nächsten drei Monate predigte Paulus in der Synagoge der Juden. Auch nachdem er die Synagoge verlassen musste, kamen sehr viele Menschen durch seine vollmächtige Verkündigung zum Glauben, doch wird uns keine weitere derartige Erfahrung oder Auswirkung genannt. Es entsteht der starke Eindruck, dass es sich in den drei Fällen (Jerusalem, Cäsarea und Ephesus) in denen sich der Heilige Geist auf diese Weise kundgab, immer um den Beginn eines neuen Missionsfeldes handelte.
Nirgendwo blieb der Apostel Paulus so lange an einem Ort wie in Ephesus und Umgebung. „Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. So hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken, und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus.“ (Apg 19,11-12).Von hier aus ist das Evangelium in der gesamten Provinz Asia ausgebreitet worden (Apg 19,10. 20; Offb 2-3). Die Auswirkungen des Heiligen Geistes bei vielen, die in Ephesus gläubig wurden, sind in folgenden Aussagen zusammengefasst: „Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren, und bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren, und kamen auf fünfzigtausend Silbergroschen. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig.“ (Apg 19,18-20).
11. Teil: Die Sprachengabe in der Gemeinde Korinth
Als der Apostel Paulus etwa im Jahre 55 n.Chr. von Ephesus aus den sogenannten 1Korintherbrief schrieb, war die Gemeinde Gottes in Korinth noch keine vier Jahre alt (Apg 18,1-18; 1Kor 16,7-9).
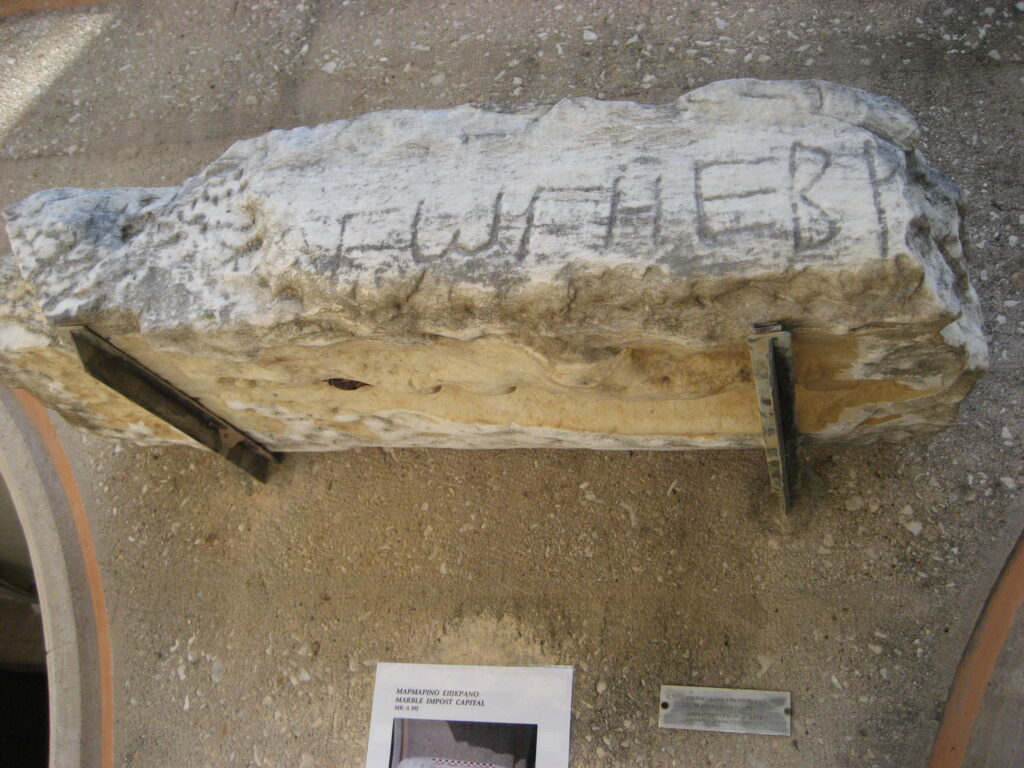
Abbildung 6 Die griechische Aufschrift „Synagoge der Hebräer“ bestätigt das Vorhandensein eines jüdischen Versammlungshauses in Korinth (Foto: 23. Mai 2011).
Für den Apostel, der mit seinen Mitarbeitern Silvanus und Timotheus die Gemeinde in Korinth gründete, waren die Nachrichten und Fragen der Gemeinde Grund genug, um einen ausführlichen Brief zu schreiben. Dem Thema Gaben des Geistes widmet der Apostel in seinem Brief viel Raum und speziell der Prophetie- und Zungenrede, sowie deren Zweck und Praxis, ein ganzes Kapitel (1Kor 14,1-33). In der Gründungsphase der Gemeinde wird das Phänomen `Sprachenrede-Zungenrede` nicht erwähnt (Apg 18,1-18). Das Argument des Schweigens bedeutet natürlich nicht, dass es dieses Phänomen in den Anfängen nicht gegeben hat. Höchstwahrscheinlich gab es dort in der Zeit der Wirksamkeit des Apostels solche Äußerungen des Heiligen Geistes. Die Korinther machen jedoch von dieser Geistesgabe falschen Gebrauch. Darum erläutert der Apostel so detailliert die Zweckbestimmung und den rechten Gebrauch dieser Gabe in der Gemeinde.
Paulus leitet dieses Thema ein mit: „Strebt nach der Liebe (agap¢n).“ (14,1a). Die Liebe ist Frucht des Heiligen Geistes (Gal 5,22) und als solche steht sie vor und über den Gaben und Werken (1Kor 13,1-13). An ihr soll erkannt und gemessen werden, ob jemand den Heiligen Geist hat (Röm 5,5b: „denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist“). Weiter schreibt Paulus: „Strebt aber nach den geistlichen Gaben (pneumatika), besonders aber, dass ihr weissagt (prof¢teu¢te – prophetisch redet).“ (14,1b).
Der Hauptkern der Prophetie ist die Verkündigung des Wortes Gottes auf verschiedene Weise, wie der Herr selbst durch den Propheten erklären ließ: „Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume; wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht.“ (Jer 23,28a). Und Mose wünschte: „Wollte Gott, dass alle im Volk des HERRN Propheten wären und der HERR seinen Geist über sie kommen ließe.“ (4Mose 11,29). Diese Gabe verhieß Gott, in reichem Maß unter seinen Kindern auszuteilen (Joel 3,1-2; Apg 2,17-18). Da liegt Paulus ganz auf der Linie, die Gott in Bezug auf die Mitteilung seines Willens festgelegt hatte.
Der Apostel fährt fort: „Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott; denn niemand versteht (hört auf) es, im Geist aber redet er Geheimnisse.“ (14,2). Im Griechischen gibt es für `Zunge als Körperglied` (Ri 7,5; Mk 7,33) und `Zunge als Sprache` nur einen Begriff, nämlich `gloss¢ `. Mit dem griechischen Begriff `cheilos` für Lippe ist auch oft Sprache gemeint (1Mose 11,1-9; Jes 6,5; 28,11). In unserem Textzusammenhang handelt es sich um eine Sprache, welche der Redende von Natur aus nicht beherrscht und auch den Zuhörern unbekannt und daher auch unverständlich ist. Wahrscheinlich leiten einige Christen davon ab, dass es sich hier nicht um eine menschliche Sprache handelt. In 1Korinther 13,1 erwähnt der Apostel neben menschlichen Sprachen (im Plural) auch Sprachen der Engel (im Plural, allerdings im Konjuktiv).
Bekanntlich haben sich die himmlischen Boten bei ihren Mitteilungen an Menschen, immer in der für die betreffenden Menschen verständlicher Sprache geäußert. Da es sich aber am Pfingsttag in Jerusalem eindeutig um menschliche Sprachen/Dialekte handelte, ist es wahrscheinlich, dass es sich bei Kornelius in Cäsarea und auch in Ephesus um Äußerungen des Geistes in menschlichen Sprachen/Dialekte handelte. Was läge hier näher, auch für Korinth unter dem Begriff `γλόσση – gloss¢ ` das gleiche zu verstehen.
Was die Zungenrede-Gabe in Korinth betrifft, so ist kein einziger Inhalt einer solchen Sprachäußerung überliefert worden und daher auch keine Auslegung. Wir haben aus dem Korinthischen Kontext keine praktischen Beispiele von Zungenrede (mit konkreter Auslegung) und daher ist ein Vergleich mit der heutigen Praxis in den Gemeinden nicht möglich. In Jerusalem am Pfingsttag und in Cäsarea war das Reden in Sprachen unter der Überschrift „Die Großtaten Gottes“ den jeweiligen Zuhörern verständlich, eine Auslegung war nicht notwendig. Was aber ein Gemeindeglied in der Gemeinde Korinth im Geist redete, blieb den Versammelten verborgen.
„Wer aber weissagt (prophetisch redet), redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung.“ (14,3). Es folgt eine Art Gegenüberstellung von Zungenrede und Prophetie, während Letztere sich an Menschen wendete und so die geistliche Auferbauung der Gemeinschaft im Auge hatte. „Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst; wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde.“ (14,4). Hier geht es nicht mehr nur um eine Gegenüberstellung, sondern schon um eine Wertung. Das Wohl der Gemeinschaft steht über der subjektiven Erfahrung des Einzelnen.
„Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange.“ (14,5).
Der Wunsch des Apostels, dass alle in Sprachen reden könnten, wird jedoch von ihm selber relativiert durch die Aussage in 1Kor 12,30: „Nicht alle reden in Sprachen“. Paulus ist zwar für die Sprachen-Rede-Gabe, hebt jedoch die für die Gemeinschaft verständliche und aufbauende Gabe der prophetischen Rede (in einer für alle verständlichen Landessprache/Volkssprache) deutlich hervor. Nur durch die Übersetzung/Auslegung der Sprachenrede wird ihr Wert für die Gemeinschaft anerkannt.
„Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre.“ (14,6). Der Gemeinschaft nützt nach den Worten des Apostels die Sprachenrede (ohne Übersetzung) nichts. Dagegen sind Offenbarung, Erkenntnis, Weissagung (Prophetie) und Lehre die aufbauenden geistlichen Elemente für die Gemeinde vor Ort.
Und dann begründet er seine Argumentation: „Doch auch die tönenden leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden.“ (14,7-9). Wie schon an Pfingsten, so macht der Apostel Paulus auch für Korinth deutlich, dass es sich bei der durch den Geist Gottes gewirkten Sprachenrede um eine klar definierte Sprache (Dialekt) handelt und keineswegs um ein undeutliches Gemisch von Lauten oder Wortfetzen aus verschiedenen Sprachen.
Schon in jungen Jahren empfand ich es als störend, wenn in einer Stubenversammlung gemeinsam (gleichzeitig) halblaut, leise oder sogar flüsternd gebetet wurde. Natürlich hat Gott alle gehört und verstanden, doch der Aufbaueffekt für die Gemeinschaft war verfehlt. Ich selber konnte mich nicht konzentrieren und hörte meist dem zu, der am lautesten betete. Dabei handelte es sich noch nicht um eine Art Zungenredegebet, sondern alle beteten in Deutsch. Das Ergebnis war das gleiche, keiner verstand so richtig, was der andere betete.
Paulus fährt fort: „Es gibt zum Beispiel so viele Arten (gen¢) von Sprachen (hier: fönön – Stimmen/Töne) in der Welt, und nichts ist ohne Sprache (hier: afönön – unstimmig/tonlos).“ (14,10). Dieser Vergleich unterstützt zusätzlich die Annahme, dass es sich auch bei der Sprachenredegabe um eine in dieser Welt vorhandenen und gesprochenen Sprache/Dialekt handelt, die in sich stimmig ist.
Paulus weiter: „Wenn ich nun die Bedeutung (dynam¢n – Kraft) der Sprache (hier: φfön¢s – Stimme/Tones) nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar.“ (14,11). Jetzt wird Paulus ganz drastisch in seinen Vergleichen, denn als Barbaren wurden all die Völker bezeichnet, die außerhalb der damals zivilisierten und im Römischen Reich anerkannten und verstandenen Sprachen lebten. Obwohl auch die sogenannten Barbaren auf der Insel Melite (Apg 28,1ff) in sich stimmige Sprache benutzten. Damit ist für die Gemeinschaft das unverständliche Reden oder Beten in Sprachen zwecklos und nutzlos.
„So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben (pneumatön) eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde.“ (14,12). Der Hinweis hier ist: was zur Auferbauung der Gemeinde dient, diese Gaben sollen auch in der öffentlichen Versammlung in ihrer Vielfalt zum Zuge kommen.
„Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege! Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer.“ (14,13-14). Auslegen, bzw. übersetzen/dolmetschen ist unbedingte Voraussetzung für lautes, öffentliches beten oder reden in einer unbekannten Sprache. Hier fällt noch auf, dass Paulus von `seinem` Geist spricht, bzw. dem Geist des Redenden oder Betenden in einer anderen Sprache. Und dass in diesem Fall der Verstand (nous) des Redenden ausgeschaltet ist, so dass er selbst nicht kontrollieren oder beurteilen kann, was er sagt oder betet. Merken wir, dass sich hier auch eine Gefahr verbergen kann? Wenn schon beim prophetischen Reden von zwei oder drei Personen die Gemeinde beurteilen soll, wie viel mehr wenn nur einer eine Aussage macht?
„Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand; ich will lobsingen mit dem Geist, aber ich will auch lobsingen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut.“ (14,15-17). Wieder und wieder betont Paulus den begrenzten Nutzen des Sprachen-Rede (Gebets) für die Gemeinschaft, die nichts davon hat und entsprechend nicht mit einem Amen als Bestätigung bekräftigen kann.
„Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als zehntausend Worte in einer Sprache.“ (14,18-19). Das ist die Kulmination der Auseinandersetzung mit der Thematik Sprachengabe in der Gemeinde – fünf zu zehntausend. Natürlich spitzt der Apostel stark zu, aber doch nur, um die Korinther wieder ins richtige Lot zu bringen. Und er bekräftigt seine Argumentation mit dem Aufruf: „Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene.“ (14,20)!
Nun folgt eine von der Schrift her abgeleitete Erklärung des Apostels über die Zweckbestimmung der Sprachenrede. „Im Gesetz steht geschrieben: »Ich will in andern Zungen (eteroglössois – Anderssprachige) und mit andern Lippen (cheilesin eterön – Lippen anderer) reden zu diesem Volk, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr.« Und Paulus zieht daraus den Schluss: „Darum sind die Sprachen (glössai) ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen; die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen.“ (14,21-22). Das Zitat, welches Paulus hier als Erklärung für die Sprachenrede anführt, ist aus dem Propheten Jesaja 28,11-12 entnommen.
Dort ist der Bezug zum Volk Israel (Juda und Jerusalem) deutlich erkennbar. Dazu nennt Paulus die Bestimmung dieser Sprachen-Rede-Gabe, bzw. das Phänomen dieser Ausdrucksweise Gottes – es ist ein ZEICHEN für die Ungläubigen, für die, die nicht hören wollten. Diese Verstockten im Herzen und den Ohren gab es zur Zeit des Propheten Jesaja, die gab es zur Zeit Jesu und der Apostel. Damals wollte die Mehrheit der Juden nicht hören und nicht glauben. Ein kleiner Teil der Gesamtheit der Juden in Korinth, (ähnlich wie auch in Jerusalem am Pfingsttag), nahm Jesus als den Messias an.
So schreibt Lukas: „Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme über euer Haupt; ohne Schuld gehe ich von nun an zu den Heiden. Und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, eines Gottesfürchtigen; dessen Haus war neben der Synagoge. Krispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Hause, und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen.“ (Apg 18,5-8).
Zwar wird in der Gründungsphase das Phänomen der Sprachenrede nicht erwähnt, doch die spätere Praxis dieser Gabe in der Gemeinde lässt zumindest den Schluss zu, dass es dieses Phänomen in der Anfangszeit als Zeichen für die Juden, die nicht hören und glauben wollten, gegeben haben könnte.

Abbildung 7 Das Kreuz – für die Juden ein Ärgernis, für die Griechen eine Torheit (Foto: 23. Mai 2012).
„Denn die Juden fordern Zeichen.“ (1Kor 1,22), Und wenn sie welche bekommen, glauben sie doch nicht (Joh 12,37: „Und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn“).
Aber ist die Sprachenredegabe nicht auch ein Zeichen für die Ungläubigen aus den Heiden? Im Abschnitt 8 (Sprachengabe in Cäsarea) konnten wir sehr deutlich feststellen, dass der Empfang des Heiligen Geistes in Verbindung mit der Sprachen-Rede-Gabe bei den Heiden (Haus des Kornelius) von Petrus geradezu als Beweis ihrer Annahme bei Gott in Jerusalem (bei den Juden) vorgetragen wurde (Apg 11,18).
Für Heiden wäre solch ein Zeichen sinnlos und zwecklos, wie der Apostel im folgenden Text klar macht. „Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden, und es kommen Unkundige (idiötai – Laien) oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt; das Verborgene seines Herzens wird offenbar, und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist.“ (14,23-25). Aus dieser Erklärung des Paulus zur Bestimmung der Sprachenrede geht hervor, dass sie nicht für die Evangelisation von Laien (besonders der Unkundigen/Ungläubigen aus den Heiden) bestimmt ist. Für diesen Zweck ist die Gabe der prophetischen Rede viel geeigneter.
„Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung; alles geschehe zur Erbauung.“ (14,23-26). Der Apostel ist für die Vielfalt der Gaben in einer Gemeinde, doch jede Ausdrucksform soll sich an einem Ziel orientieren – die Auferbauung der Gemeinde. Das Gemeinwohl steht im Vordergrund, nicht die subjektive Erbauung, oder gar Selbstdarstellung.
„Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander, und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden, und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der dasitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens.“ (14,27-33). Es gibt Einschränkungen, was die Anzahl der Redenden betrifft und dazu auch noch der Reihe nach. Dies gilt auch für das Beten oder Psalmensingen. Und es gibt Sprachen-Rede Verbot bei Fehlen einer Auslegung/Übersetzung. Doch bei allem Streben nach Gaben und deren Anwendung in der Gemeinde soll der Friede Gottes gewahrt werden.
12. Teil: Der Stellenwert der Sprachen-Rede-Gabe
In den vorherigen Abschnitten versuchten wir festzustellen, wo, wann und wie diese Gabe in der ersten Gemeindegeneration zum Einsatz kam. In diesem letzten Abschnitt geht es nicht um eine detaillierte Studie aller Gnadengaben und deren Träger, sondern mehr um die Frage, welchen Stellenwert die Sprachen-Rede-Gabe unter den anderen Gnadengaben des Heiligen Geistes einnimmt. Und schließlich eine Zusammenfassung mit einigen Schlussfolgerungen.
Die Listen der Gnadengaben und die Ämter (Dienste).
Mit den Geistesgaben befasst sich systematisch nur der Apostel Paulus. Im ersten Korintherbrief und im Epheserbrief finden wir insgesamt drei Listen mit zum Teil ähnlicher Reihenfolge von Gaben und Gabenträgern.
1Korinther 12,28-30:
Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt:
- Erstens – Apostel
- Zweitens – Propheten
- Drittens – Lehrer
- Danach – Wunderkräfte
- Danach – Gnadengaben der Heilungen
- Hilfeleistungen
- Leitungen
- Arten von Sprachen
- Sind etwa alle Apostel?
- Alle Propheten?
- Alle Lehrer?
- Haben alle Wunderkräfte?
- Haben alle Gnadengaben der Heilungen?
- Reden alle in Sprachen?
- Legen alle aus?
Epheser 4,11-13:
Und er hat gegeben die einen als
- Apostel,
- Propheten,
- Evangelisten,
- Hirten,
- Lehrer.
Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi.
1Korinther 12,7-11:
In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller;
- Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden;
- Dem andern wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist;
- Einem andern Glaube, in demselben Geist;
- Einem andern die Gabe, gesund zu machen, in dem „einen“ Geist;
- Einem andern die Kraft, Wunder zu tun;
- Einem andern prophetische Rede;
- Einem andern die Gabe, die Geister zu unterscheiden;
- Einem andern mancherlei Zungenrede;
- Einem andern die Gabe, sie auszulegen.
Dies alles aber wirkt derselbe „eine“ Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will.
Kurze Bemerkungen zu dem, was in diesen Gabenlisten auffällt.
- Die Träger der apostolischen Berufung und Begabung sind immer ganz vorne bzw. oben in den Listen.
- Der prophetische Dienst ist in den ersten zwei Listen jeweils an zweiter Stelle.
- Die Gabe der Sprachenrede ist in den zwei Listen, in denen diese genannt wird, immer an letzter Stelle.
Wie wir in den vorhergehenden Abschnitten feststellen konnten, hatte diese Gabe folgende Bestimmung:
- An Pfingsten war sie offensichtliche Begleiterscheinung beim Kommen des Heiligen Geistes.
- Ebenfalls am Pfingsttag diente sie der Verherrlichung Gottes, denn durch diese Gabe wurden die Großtaten Gottes gerühmt.
- Die Vielfalt der eindeutigen Sprachen/Dialekte am Pfingsttag diente als Zeichen für die ungläubigen Juden. Dadurch bestätigte Gott dem gesamten Volk Israel, dass alle Völker in Gottes Heilsplan eingeschlossen sind.
- In Cäsarea, im Haus des Kornelius, diente diese Gabe als Zeichen/Bestätigung für Petrus und seine sechs jüdischen Begleiter, dass auch Heiden durch Herzensumkehr und Glauben den Heiligen Geist empfangen haben wie auch die gläubig gewordenen Juden/Galiläer am Pfingsttag.
- Auch diente sie später als Beweis für die Judenchristen in Jerusalem, die nicht wahrhaben wollten, dass die Heiden auch Anteil an der Erlösung haben. Petrus begründet: „Sie haben den Heiligen Geist empfangen gleichwie wir am Anfang“ (gemeint ist am Pfingsttag).
- In Ephesus diente sie (wie auch das prophetische Reden) höchstwahrscheinlich zur Bestätigung des Empfangs des Heiligen Geistes bei gläubig gewordenen und Getauften aus den Heiden. Dieses hörbare Zeichen war grundlegend, nicht nur für die Heiden selbst, sondern auch für die Juden vor Ort.
- In Korinth diente diese Gabe der individuellen Auferbauung der Gläubigen.
- Sie diente der Auferbauung der Gemeinde nur, wenn sie in eine für alle bekannte und verständliche Sprache ausgelegt wurde. Sonst wurde sie von Paulus als hörbare Äußerung im öffentlichen Gottesdienst untersagt.
- Für keine andere Gnadengabe wird irgendwo eine Einschränkung gemacht, nur für die Gabe der Sprachenrede.
- Es ist ein legitimes und auch ehrliches Anliegen, dass diese Gabe nicht erzwungenermaßen gesucht und erlangt werden sollte.
- Jede Äußerung der Geistesgaben muss überprüfbar sein. Wenn sogar die Prophetie, welche in der landesüblichen Sprache ausgesprochen wurde, nach den Worten des Paulus von der Gemeinde beurteilt/geprüft werden sollte, wie viel mehr die Zungenrede, die häufig nicht ausgelegt wird, und wenn sie ausgelegt wird, dann beruht die Auslegung oft nur auf einem einzigen Zeugen.
- Die Zungenredegabe (wie auch alle anderen Gaben) kann vom Herrn erbeten werden, doch der Heilige Geist teilt letztlich jedem die Gabe(n) zu, wie er will.
- Diese Gabe allein kann nicht als sichere Bestätigung für das Innewohnen des Heiligen Geistes (Geistestaufe) im Gläubigen angesehen werden. Die Äußerungen des Heiligen Geistes bei der Wiedergeburt eines Menschen sind unterschiedlich.
- Diese Sprachengabe wurde nicht gegeben, um das natürliche Erlernen von Sprachen bei Gläubigen aufzuheben.
- Der Heilige Geist ist uneingeschränkt im Zuteilen von Gaben und Befähigungen. Er gibt sie und kann diese auch wieder zurückziehen. Er kann diese auf Lebenszeit oder auch nur für bestimmte Situationen zuteilen.
- Weil die Sprachengabe nach den Worten des Apostels in erster Linie der Selbstauferbauung dient, ist bei ihrem Gebrauch besonders behutsamer Umgang nötig. Jede Art von Stolz oder Überheblichkeit über andere Gabenträger, bei denen die Geistesgaben nicht so offensichtlich hervorstechen, sollte bekämpft werden (das gilt natürlich auch für alle anderen Gabenträger).
- In manch einer Situation, besonders bei der Mission, wäre diese Gabe auf den ersten Blick hilfreich zur verständlichen Weitergabe der Heilsbotschaft, doch gerade dafür ist sie in der Urgemeinde nicht eingesetzt worden. In der Regel benutzt Gott die menschlichen Sprachkenntnisse als natürliche Kanäle (irdene Gefäße) zur Verbreitung seines Evangeliums.
Aktualisiert am 10. Juni 2025