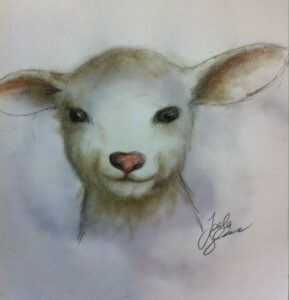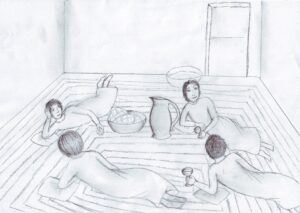Die Sabbatruhe im Lichte der Bibel

Abbildung 1 Am siebten Tag ruhte Gott der HERR von allen seinen Werken, die er gemacht hatte (1Mose 2,1-2). Früh am Morgen herrscht völlige Ruhe über dem Roten Meer, dahinter die aufgehende Sonne über der arabischen Halbinsel (Foto: am 5. Februar 2013).
Bibelstudie über das Sabbatgebot und die Bedeutung im Neuen Testament
(1.) Einleitung
In dieser Bibelarbeit gehen wir auf Spurensuche nach dem Ursprungsgedanken des Sabbats (der Sabbatruhe), seinem Inhalt, Sinn und Bedeutung, sowie der Praxis unter den Patriarchen, im Volk Israel, zur Zeit von Jesus, den Aposteln in der Urgemeinde und den darauffolgenden Generationen der Christen.
Bei dieser Bibelarbeit geht es um eine ehrliche Suche nach Antworten für die christliche Praxis einer gesunden Gottesbeziehung.
(Zitate aus der Revidierten Elberfelder Übersetzung und Interlinearübersetzung)
Vorab eine kurze Erklärung der wichtigen griechischen Begriffe zu diesem Thema:
- Katapausis, dieser Begriff birgt in sich eine umfassende Ruhe (1Mose 2,2b-3), wird jedoch im Alten Testament häufig verwendet um die körperliche Ruhe zu beschreiben, eben Ruhe von der Arbeit. Dann aber auch die Bedeutung der Ruhe vor äußeren Feinden. Der tiefere geistliche Aspekt der Gottesruhe wie in 1Mose 2,2b-3 angedeutet, bleibt in den meisten Texten des Alten Testamentes weitgehend verborgen. Durch die Vorsilbe ´kata´ bekommt der Begriff den Schwerpunkt, dass die Ruhe tiefgehend, dauerhaft ist.
- Anapausis, hier handelt es sich um einen ähnlichen Begriff mit ähnlichem Inhalt von Ruhe, allerdings bekommt der Begriff durch die Vorsilbe ´ana´ den Aspekt von aus-ruhen, auf-atmen, frei werden von der Mühe und Belastung (Luther: Erquickung). In verschiedenen Sprachen (auch in der Musik) ist das Wort `Pause` bekannt für Anhalten, Pause machen.
- Sabbatismos, bedeutet Sabbatruhe (gemeint ist die wahre Gottesruhe). Dieser Begriff kommt zwar nur an einer Stelle des NT vor, nämlich in Hebräer 4,9, er wird aber von dem Autor in seinen Texten mit dem Begriff ´katapausis´ sozusagen gleichbedeutend für die Ruhe Gottes verwendet.
(2.) Der siebte Tag – ein Ruhetag für Gott!
Die erste Erwähnung der Ruhe finden wir im Anschluss an die Sechstageschöpfung, dort wird deutlich hervorgehoben:
Und Gott ruhte (gr. katepausen) am siebten Tage von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte (gr. katepausen) er von all seinem Werk, daß Gott geschaffen hatte, indem er es machte. (1Mose 2,2b-3).
In diesem Text steht zweimal ausdrücklich, dass Gott am siebten Tag ruhte von all seinen Werken, die Er gemacht hatte und dass Er diesen Tag heiligte. Er maß also diesem Tag eine besondere Bedeutung zu. Doch aus Gründen der Ermüdung hätte Gott keinen Ruhetag gebraucht, denn er wird „weder müde noch matt“ (Jes 40,28). Jesus sagt, dass der Sabbat um des Menschen willen gemacht ist (Mk 2,27). Ruhte Gott dann schon damals um des Menschen willen? Obwohl es vor der Zeit von Mose keinen direkten Hinweis in der Bibel zur Einhaltung des siebten Tages im Sinne einer Verordnung Gottes gab, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Patriarchen den siebten Tag als Ruhetag nicht nur zur Erinnerung an Gottes Ruhe, sondern auch aus eigenem Vorteil in Anspruch nahmen und einhielten. Die Zweckbestimmung des Sabbats, so wie Jesus ihn in Markus 2,27 definiert, legt es nahe, dass der Mensch am Anfang das Verhalten Gottes auch so verstanden hat und sich mehr oder weniger daran hielt. Auch die Zeiteinteilung und Zeitberechnung zur Zeit der Patriarchen unterstützt diese Annahme.
Doch erst am Sinai hat Gott den siebten Tag der Woche, als buchstäblichen Ruhetag, in die Zehn Gebote mit aufgenommen. Das Sabbatgebot steht an vierter Stelle in den Zehn Geboten. Es nimmt eine zentrale Stellung ein, weil dadurch die praktische, sichtbare Beziehung der Israeliten zu ihrem Gott zum Ausdruck kommt. Zentral auch deswegen, weil der Israelit an jedem Sabbat an Gottes wunderbare Schöpfung erinnert wurde und an die ebenso wunderbare Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens denken sollte.
(3.) Der siebte Tag – ein gesetzlicher Ruhetag für das Volk Israel
Gott selbst schrieb die `Zehn Worte` auf steinerne Tafeln, die in Form von Geboten und Verboten formuliert wurden. Und an zentraler Stelle steht das Gebot zur Einhaltung und Heiligung des siebten Tages.

Abbildung 2 Ein Berg aus schwarzem Basalt im Wadi Rum erinnert an den Berg Sinai von dem aus Gott dem Mose die zwei steinernen Tafeln des Zeugnisses mit den Zehn Geboten übergeben hat (Foto: 6. November 2014).
So lesen wir in 2Mose 20,8-11: „Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den HERRN, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde, der innerhalb deiner Tore wohnt.Denn in sechs Tagen hat der HERR den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte (gr. katepausen) am siebten Tag, darum segnete der HERR den siebten Tag und heiligte ihn.“ (2Mose 20,8-11).
Die erste und zentrale Begründung für das Einhalten des Sabbats liegt also in der Sechstageschöpfung durch Gott. Dem Beispiel Gottes folgend, sollte daher auch der Mensch nach sechs Arbeitstagen eine Ruhepause einlegen.
Eigentlich müsste der Mensch sich darüber freuen, dass Gott ihm einen Tag in der Woche frei gibt, um auszuruhen, aber gerade das Sabbatgebot ist sehr oft missachtet und nicht eingehalten worden. Das Bemühen Gottes jedoch liegt nicht im Regeln der Arbeit für den Menschen in den sechs Tagen, auch nicht im Motivieren des Menschen dazu, möglichst viel zu tun, sondern seiner großen Sorge, dass der Mensch vor lauter Arbeit vergisst, die Ruhe in Gott zu suchen. Deshalb ist der Mensch aufgefordert: „Komm zur Ruhe, du rastloser Mensch, denn dein Heil, deine Rettung liegen nicht in deinem Schaffen, sondern im Stillwerden vor Gott und Ruhe in Gott.“
Die Israeliten erfuhren diese Wahrheit, als sie sich in der ausweglosen Lage am Ufer des Schilfmeeres befanden. Dort lesen wir: „Mose aber antwortete dem Volk: Fürchtet euch nicht! Steht und seht die Rettung des HERRN, die er euch heute bringen wird! Denn die Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der HERR wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein.“ (2Mose 14,13-14).
Auch Jesaja macht zum Thema Ruhe eine wunderbare Aussage in einer Situation, in der das Volk von Juda voller eigenen Aktivität war: „Denn so spricht der Herr, HERR, der Heilige Israels: durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und Vertrauen ist eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt.“ (Jes 30,15). Die Rettung des Menschen liegt also nicht in seinem Tun, sondern in der Umkehr zu Gott und dem stille werden vor Gott. Diese oben genannten Aussagen ermutigen zu den konkreten Fragen:
- Um was ging es Gott eigentlich bei dieser Ruheverordnung?
- Warum nimmt das Sabbatgebot einen so breiten Platz in den Zehn Geboten und im Leben des Volkes Israels ein?
Überlegungen / Antworten:
-
- Körperliche Ruhe und Erholung für Mensch und Tier sind ohne Zweifel ein wichtiger Grund (2Mose 20,8-11).
- Der Mensch soll an seinen Schöpfer denken (1Mose 2,1-3).
- Ein Tag der Versammlung ist ein wesentlicher Grund, weil dadurch der Einzelne durch die gottesdienstliche Gemeinschaft wieder ganz neu auf Gott ausgerichtet wird.
- Am Sabbat sollten die Israeliten daran erinnert werden, dass Gott das Volk heiligt (2Mose 31,13; vgl. dazu auch Joh 17,17. 19).
In der Sabbatfeier liegt also neben den natürlichen Begründungen auch schon ein klarer Hinweis auf das heiligende Wirken von Jesus durch seine Hingabe.
Aber das Sabbatgebot hat noch einen weiteren wichtigen Sinn. In 5Mose 5,12-15 wird das Sabbatgebot im Rahmen der Zehn Gebote erneut wiederholt und mit einer außerordentlich wichtigen Begründung versehen. „Beachte den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, so wie der HERR, dein Gott, es dir geboten hat! Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den HERRN, deinen Gott. Du sollst (an ihm) keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und all dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore (wohnt), damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen (gr. anapausetai) wie du. Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der HERR, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat! Darum hat der HERR, dein Gott, dir geboten den Sabbattag zu feiern.“ (5Mose 5,12-15).
Ein wichtiger Grund der Sabbatverordnung liegt also in der geschichtlichen Tatsache der wunderbaren Erlösung Israels aus der Sklaverei Ägyptens. Hat nicht Gott schon damals am ersten siebten Tag seiner Ruhe an die Erlösung seines Volkes gedacht? Gott sind seine Werke von Anbeginn bekannt (Apg 15,18).
Also noch mal: Weil Israel in Ägypten Sklave war und weil Gott Israel aus dieser Sklaverei erlöst hat, darum sollen sie den Sabbattag heiligen.
Nun hat Gott das Volk Israel durch Mose aus Ägypten geführt und unter Josua nach Kanaan zur Ruhe gebracht (Jos 23,1): „Und es geschah nach vielen Tagen, nachdem der HERR Israel Ruhe (gr. katapausai) verschafft hatte vor allen seinen Feinden ringsumher (…).“
Israel kam zwar in Kanaan zur äußerlichen Ruhe, aber zur wahren Ruhe in Gott ist das Volk
wegen ihres Unglaubens und Ungehorsams nicht gekommen (vgl. 4Mose 14,21-23 mit Hebr 4,11. Und in Hebräer 4,3 lesen wir das Urteil Gottes über die Ungläubigen und Ungehorsamen: „Sie (das Volk Israel in der Wüste) sollen nicht zu meiner Ruhe (κατάπαυσίν – katapausin) kommen.“ (vgl. mit Psalm 95,11).
(4.) Wie und wodurch kommt der Mensch zu Gottes Ruhe?
Gott bestimmt nun nach langer Zeit einen anderen Tag, ein ´Heute´, an dem er für das Volk Gottes noch einmal eine Möglichkeit schafft, um zu seiner, zu Gottes Ruhe, einzugehen (Psalm 95,7-11). Der Hebräerbriefschreiber kannte die Geschichte des Volkes Israels und die damit verbundenen alttestamentlichen Weissagungen sehr gut. Er richtet sich in seinem Schreiben zuerst an Juden. Im 4. Kapitel nimmt er Bezug auf Psalm 95,7–11, dort schreibt David durch den Heiligen Geist: „Heute, so ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht, (so wie es damals in der Wüste geschah)“. Und er deutet dieses ´Heute´ auf die Evangeliumszeit und gibt im gleichen Kapitel eine deutliche Erklärung für die tiefe Bedeutung der Gottesruhe am siebten Tag nach der Schöpfung (Hebr 4,3-9).
Zum einen verbindet er die Sabbatruhe Gottes, den siebten Tag, den Ruhetag, mit dem Einzug des Volkes Israels nach Kanaan unter Josua und zwar mit negativem Ergebnis, d.h. Israel ist unter Josua im Land Kanaan nicht zur wahren Gottesruhe gekommen, sie erlangten nur eine äußere Ruhe vor Feinden (Josua 23,1).
Zum anderen verbindet er positiv die Sabbatruhe Gottes mit dem Einzug der Glaubenden an Jesus in das verheißene geistliche Land (Reich Gottes – örtlich nicht mehr eingeschränkt).
Der Autor begründet diese Argumentation in Hebräer 4,8 wie folgt:
„Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte (im Land Kanaan), würde Gott nicht durch David (in Psalm 95,7-11) von einem anderen Tag, einem „Heute“ sprechen, als einer erneuten und endgültigen Möglichkeit in Gottes Sabbatruhe hineinzukommen. Und in Kapitel 4,1 fordert der Hebräerbriefschreiber auf: „Lasst uns also voll Sorge (darauf) bedacht sein, hineinzukommen zu seiner Ruhe (katapausin), solange die Verheißung noch steht (gilt).“
- „Denn wir, die Glaubenden (an Jesus) kommen hinein in die Ruhe (katapausin)“ (4,3). Die Vorsilbe `kata` richtet den Sinn des Wortes nach unten, in diesem Zusammenhang meint es: in der dauerhaften, endgültigen Gottesruhe angekommen zu sein.
- „So bleibt also eine Sabbatruhe (gr. sabbatismos) dem Volke Gottes noch übrig, denn wer hineingekommen ist zu seiner (Gottes) Ruhe (katapausin), der ist auch zur Ruhe (katapausen) gekommen von seinen Werken, wie Gott von den seinen.“ (4,9).
Der Begriff Sabbatruhe oder Sabbatfeier kommt im Neuen Testament nur in Hebräer 4,9 vor. Das griechische Substantiv heißt `sabbatismos` und steht im engsten Zusammenhang mit dem Begriff `katapausis`, welches in Hebräer Kapitel 4 mehrmals verwendet wird und immer die tiefe und endgültige Ruhe Gottes zum Ausdruck bringt (vgl. auch 1Mose 2,2-3). Beim Übertragen dieses Wortes in die lateinische oder deutsche Sprache, würde es heißen – Sabbatismus. Daher könnte ich mich im geistlichen Sinne sogar `Sabbatist` nennen, weil ich durch den Glauben an Jesus Christus Teilhaber der Gottesruhe bin.
Aufgrund dieser Textzusammenhänge in Hebräer 3,7 – 4. 11, können wir die Feststellung machen, dass sich die Sabbatruhe des Alten Testamentes in ihrer wahren, tiefen, geistlichen und damit endgültigen Bedeutung und Erfahrbarkeit erst in der Sphäre des Glaubens an Jesus Christus vollzieht und deshalb auch ewigen Bestand hat. Dies bedeutet, dass sie nicht mehr unterbrochen wird, obwohl sie natürlich erst in der Ewigkeit, nach unserer leiblichen Auferstehung, ihre vollendete und endgültige Form annehmen wird.
Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Wenn wir die Möglichkeit haben, in ein Haus/Gebäude hineinzugehen, wo wir Schutz und Geborgenheit erfahren können, brauchen wir uns nicht mehr damit begnügen, draußen im Schatten oder in den Umrissen desselben aufzuhalten. „Denn das Gesetz hat nur den Schatten der zukünftigen Güter, nicht das Wesen der Güter selbst.“ (Hebr 10,1). Auch die alttestamentliche Sabbatverordnung und Sabbatruhe sind nur ein Schatten der Wirklichkeit, die in und durch Jesus ihre wahre Bedeutung und Erfüllung bekommen hat.
Dass diese Ruhe jetzt und heute erfahrbar ist, sagt uns Jesus in Matthäus 11,28-29: „Kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und beladen seid und ich will euch zur Ruhe (anapausin) bringen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, weil ich sanftmütig bin und im Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe (anapausin) finden für eure Seelen.“
Der griechische Begriff `anapausis` in diesem Text bedeutet `ununterbrochene Ruhe, Entlastung, Befreiung, Aufatmen, eim `Aufhöre` von sich Abmühen. Die Vorsilbe `ana` hebt den nach oben gerichteten Charakter des Wortes hervor. Dies geschieht zum einen, indem der Mensch zu Jesus kommt (ihm glaubt und vertraut) und seine Last von Jesus abnehmen lässt. Diese Last besteht aus Sünde und dem Bemühen Gott gegenüber und seinen Rechtsforderungen mit eigener Kraft gerecht zu werden. Die zweite Bedingung um zur Ruhe zu kommen ist, sich in das Joch von Jesus einspannen zu lassen. Dies ist ein befreiender Dienst aus Liebe und Dankbarkeit, darum führt er in die Ruhe (anapausin).
Die Gottesruhe am siebten Tag in 1Mose 2 und die Ruhe, zu der Jesus so freundlich einlädt, sind ihrem geistlichen Wesen nach gleich. Nun wird das Gebot, welches nach seinem Buchstaben immer wieder übertreten wurde, zu einem Angebot in Jesus. Er hat das Sabbatgebot keineswegs aufgehoben oder aufgelöst (Mt 5,17), sondern zur wahren Erfüllung gebracht. In ihm ist jetzt diese Ruhe zu finden. Und wer durch den Glauben in Jesus ist, der ist auch in der Ruhe Gottes angekommen und dies nicht nur an einem bestimmten Tag der Woche, sondern für allezeit.
Wenn der Sabbat die Israeliten an die Knechtschaft und die wunderbare, aber doch nur physische Errettung aus Ägypten durch Mose erinnern sollte, wie viel mehr soll nun die geistliche Sabbat-Ruhe an die geistliche Errettung des Menschen aus der Sklaverei der Sünde und des Todes durch Jesus Christus erinnern !
(5.) Das Sabbatgebot im Neuen Testament
Es ist geradezu erstaunlich, dass das Sabbatgebot in seiner buchstäblichen Fassung an keiner einzigen Stelle des Neuen Testamentes vorkommt, bestätigt oder gar der Gemeinde angeordnet wird. Eine derartige Stelle gibt es im Neuen Testament einfach nicht. Im Vergleich dazu werden alle anderen Gebote aus den zwei Tafeln des Zeugnisses von Jesus direkt zitiert und erklärt oder indirekt erwähnt.
Jesus hat viele Gebote des Alten Testamentes genannt, erklärt, also auf Inhalte hingewiesen, die bis
dahin nicht offenbart waren. Er fasst sie alle zusammen in einem Doppelgebot:
„Das höchste Gebot ist das: »Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr Einer (der Einzige), und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Denkvermögen und von allen deinen Kräften«. Das andre ist dies: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (5Mose 6,4-5; 3Mose 19,18). Es ist kein anderes Gebot größer als diese.“ (Mk 12,29–31; Mt 22,39-40).
Dann aber zitiert er auszugsweise das erste und zweite Gebot, welches die Anbetung des
einen wahren Gottes zum Inhalt hat: „Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen.“ (vgl. Mt 4,10 mit 5Mose 6,13; 2Mose 20,1-3).
In Anlehnung an das dritte Gebot (Missbrauch des Namens Gottes) sagt Jesus: „Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen (,…).“ (Mt 7,21).
Das vierte Gebot: Sabbatgebot – fehlt gänzlich in den neutestamentlichen Schriften.
Das fünfte Gebot: „Ehre Vater und Mutter“ (vgl. Mt 15,4-6; Eph 6,2-3)
Das sechste Gebot „Töte nicht.“ (vgl. Mt 5,21-26 und 19,18 mit 2Mose 20,13).
Das siebte Gebot: „Brich nicht die Ehe.“ (vgl. Mt 5,27–32 ; 19,1-12 und 19,18 mit 2Mose 20,14).
Das achte Gebot: „Stiel nicht.“ (vgl. Mt 19,18 mit 2Mose 20,15).
Das neunte Gebot: „Rede kein falsches Zeugnis (…).“ (vgl. Mt 5,33-37 und 19,18 mit 2Mose 20,16).
Das zehnte Gebot: „Begehre nicht (…).“ (vgl. Mt 5,28 mit 2Mose 20,17).
Oder das Gebot: „Versuche nicht den Herrn, deinen Gott.“ (vgl. Mt 4,7 mit 5Mose 6,16).
Das Sabbatgebot jedoch in seiner buchstäblichen Form hat Jesus kein einziges Mal erwähnt, obwohl es einen zentralen Platz in den Zehn Geboten einnimmt. In diesem Zusammenhang soll darauf hingewiesen werden, dass es für den Juden zwischen den sogenannten moralischen, rituellen und bürgerlichen Gesetzen grundsätzlich keine Unterscheidung gab. Auch unterscheiden die biblischen Autoren nicht zwischen der Bezeichnung „Gesetz des Herrn“ (gleich Zehn Gebote) und „Gesetz Moses“ (gleich restliche Gebote). Hier einige Stellen, die dies deutlich machen: „(…) und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen (…) und sie (die Leviten) legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus (…).“ (Neh 8,1-8). „Und als die Tage ihrer Reinigung erfüllt waren gemäß dem Gesetz Moses, brachten sie ihn (Jesus) hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn.“ (vgl. Lk 2,22-24 mit 3Mose 12,8; 2Mose 13,2).
Das Buch des „Gesetzes des Mose“, ist gleichzeitig auch das Buch des „Gesetzes Gottes“. Es gibt also nur einen Verfasser und das ist Gott. Mose war nur der Vermittler, und weil er dem Volk das Gesetz Gottes überreichte, wurde das Gesetz auch „Gesetz Moses“ genannt.
Auch Jakobus betont die Einheit des Gesetzes wenn er schreibt:
„Denn wer das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist‘s ganz schuldig.“ (Jak 2,10).
Jesus macht den Juden den Vorwurf:
„Niemand unter euch tut das Gesetz.“ (Joh 7,19).
Jesus unterstreicht die Einheit und Zusammenhang des Gesetzes mit den Worten: „In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und (sogar) die Propheten.“ (Mt 22,40).
Jedes einzelne Gebot hat seinen Platz in Gottes Plan und ist durch Christus und in Christus erfüllt worden. Deshalb sprechen die neutestamentlichen Schreiber auch vom „Gesetz Christi.“ (Gal 6,2; 1Kor 9,21). Jesus selbst sagt dazu: „Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es der mich liebt.“ (Joh 14,21; vgl. auch 1Joh 3,24).
Wie Jesus, so auch später die Apostel unter der Leitung des Heiligen Geistes (Apg 15,28: „es gefällt dem Heiligen Geist und uns“) entschieden, welche Verordnungen und Vorschriften wegen ihrer schattenhaften, sinnbildlichen Bedeutung nun von der Wirklichkeit in Jesus abgelöst wurden und welche Willensäußerungen Gottes im Gesetz in ihrer buchstäblichen Form sowie in ihrer ganzen geistlichen Tiefe (z.B. Mt 5-7) für die Nachfolger Jesu für alle Zeiten unter allen Völkern verbindlich einzuhalten sind.
(6.) Wie lebte Jesus mit dem Sabbatgebot?
Natürlich hielt sich Jesus grundsätzlich auch an das Sabbatgebot. Doch gerade der Sabbat bedeutete für ihn ein Dienst-Tag. Zur äußeren Ruhe kam er meist in den frühen Morgenstunden oder wenn er sich mit seinen Jüngern ganz bewusst zurückgezogen hatte (Mk 1,35; Lk 4,42; Mk 6,30-31).
Doch die am häufigsten wiederholte Anklage gegen Jesus von Seiten der Schriftgelehrten und
Pharisäer lautete: „Er (Jesus) löst den Sabbat auf.“ bzw. „bricht den Sabbat.“ (Joh 5,18). darauf stand die Todesstrafe (2Mose 35,2-3). Natürlich waren diese Anklagen falsch und entsprangen aus einem falschen Verständnis der Gebote Gottes, trotzdem dürfen wir die Frage stellen: Warum hat Jesus die Juden so oft durch die Heilungen am Sabbat herausgefordert? Denn wenn wir die entsprechenden Stellen aus Mt 12; Mk 2; 3; Lk 6; 13; 14; Joh 5; 7; 9 aufmerksam durchlesen, dann stellen wir fest, dass in keinem dieser Heilungsfälle akute Lebensgefahr bestand, Jesus hätte also die Heilung auch an einem anderen Tag vollbringen können. Es fällt geradezu auf, dass Jesus die Aufmerksamkeit der Juden am Sabbat und durch den Sabbat auf sich lenkt. Er will ihnen damit doch etwas ganz Wichtiges sagen. Haben nicht die Juden den Sabbat zu ihrem Maß gemacht, weil sie daran alles und alle gemessen, bewertet und beurteilt haben? Sie kämpften bis aufs Blut, um dem Sabbat zu dienen. Jesus sagt aber:
„Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat.“ (Mk 2,27).
Das heißt, am Sabbat wird dem Menschen gedient und der Mensch lässt sich helfen und zwar ganzheitlich. In Johannes 7,23 sagt Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten: „Zürnt ihr mir, wenn ich am Sabbat den ganzen Menschen gesund gemacht habe?“ Dies ist wohl sein ausdrückliches Ziel, nämlich den Menschen durch Erlösung aus der Macht der Sünde, durch Sündenvergebung, durch Heiligung und Heilung in Gottes Gemeinschaft, und damit in Gottes Ruhe zurückzuführen. Und wenn er dies am Sabbat tut, dann füllt er diesen Ruhetag mit seiner ursprünglichen Bedeutung – die Wiederherstellung des gesamten Menschen. Wenn Jesus den Juden sagt: „Der Menschen-Sohn ist Herr des Sabbats.“ (Mk 2,28), dann ist er also derjenige, welcher den Sabbat angeordnet hatte. Jetzt steht er leibhaftig vor ihnen und lehrt sie die eigentlichen Inhalte der Sabbatruhe, welche er selbst verkörperte.
Jesus macht aber auch die Juden darauf aufmerksam, dass die Priester ihrerseits durch ihre Tätigkeit im Tempel am Sabbat im buchstäblichen Sinne des Wortes den Sabbat brechen und doch ohne Schuld sind (Mt 12,5). Nach dem Gesetz Moses musste man jeden Jungen am achten Tag beschneiden, wenn aber dieser achte Tag auf den Sabbat fiel, dann wurde die Erfüllung des einen Gebotes zur Übertretung eines anderen Gebotes (Joh 7,23-24).
Durch die buchstäbliche Einhaltung des Sabbatgebotes haben die Pharisäer grob gegen das Gebot der Liebe (Barmherzigkeit) verstoßen (Mt 12,7). Die Aussage Jesu in Matthäus 12,12: „Darum ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun“, ist positiv und motivierend zu allerlei gutem Handeln, welches dem leiblichen und geistlichen Aufbau eines Menschen zugute kommt.
(7.) Wie verstanden die Apostel und die ersten Christen die Sabbatruhe?
So wie die Apostel die Sabbatruhe verstanden, lehrten und lebten, hatte es letztlich Gültigkeit für die neutestamentliche Gemeinde. Schon in erster Zeit der Gemeinde, im jüdischen Umfeld, feierten die Gläubigen die geistliche Sabbatruhe, zu der sie nun gekommen waren und zwar täglich. Ihr Wochenrhythmus hatte sich völlig verändert. Nur am Sabbat zur Ruhe zu kommen, war für sie nun zu wenig. Von den Gläubigen heißt es in Apg 2,46: „Und an jedem Tag verharrten sie fest, einmütig im Tempel und brachen in jedem Haus das Brot.“ In Apostelgeschichte 2,42 heißt es:
„Sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft, in der Lehre der Apostel und im Brotbrechen und in den Gebeten.“ Man bekommt fast den Eindruck, dass sie an allen Tagen (einschließlich Sabbat) dasselbe getan haben, nämlich in Gott geruht und den Menschen gedient.
Als die Apostel und Evangelisten die nationalen und kulturellen Grenzen des Judentums überschritten hatten, stellte sich so manche Frage nach der Bedeutung des Gesetzes für die Gläubigen aus den Heiden. Etwa im Jahre 48 n. Chr. trafen sich die Apostel und bedeutenden Autoritäten der Gemeinde der ersten Generation in Jerusalem und berieten miteinander, was nun die Heidenchristen aus dem Gesetz Moses übernehmen sollten, bzw. was sie nicht einhalten brauchen. Einige Judenchristen forderten: „Man muß sie beschneiden und gebieten, das Gesetz Moses zu halten.“ (Apg 15,5). Wohlgemerkt, auch sie sahen das Gesetz als eine Einheit. Doch die Apostel kamen nach sorgfältiger Prüfung dieser Frage zu dem Ergebnis. Im ersten schriftlich verfassten Brief in Apg 15,23-29 heißt es: „Die Apostel und die Ältesten als Brüder, grüßen die Brüder aus den Heiden in Antiochien und Syrien. Da wir gehört haben, daß einige von uns ausgezogen sind und euch beunruhigt haben, mit Worten verwirrend eure Seelen, denen wir (doch) keinen Auftrag gegeben haben.“
Das Ergebnis der Beratung in Jerusalem lautete: „Es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen (Dogmen). Sie sollten sich fernhalten: von Götzenopferfleisch, von Blut, vom Fleischgenuss erstickter Tiere, von Unzucht. Diese vier Vorschriften (gr. ´dogmata´ Apg 16,4) waren für das Evangelium und die Gemeinschaft zwischen Juden und Heidenchristen förderlich. Dies war bis dahin das erste und blieb wohl auch das letzte Aposteltreffen, in dem ein für allemal das Verhältnis der Heidenchristen zum Mosaischen Gesetz grundsätzlich geklärt wurde.
Den Heidenchristen das Sabbatgebot in seiner buchstäblichen Form zu verordnen, stand unter den Aposteln in Jerusalem gar nicht zur Debatte. Wenn dieses Gebot in seiner buchstäblichen Form für die Heidenchristen Heilsbedeutung gehabt hätte, hätten die Apostel es dringend empfohlen. Es ist jedoch nicht einmal erwähnt worden. Wo immer der Apostel Paulus in die Städte des Römischen Reiches kam, suchte er zuerst die Juden auf. Er fand sie immer in den Synagogen, und in der Synagoge traf man sich vorrangig am Sabbat. Doch kam es immer wieder zum Bruch mit der Synagoge, so dass die Versammlungen dort schon nach kurzer Zeit nicht mehr möglich waren. So zog man sich meist in Privathäuser zurück, oder auch in eine öffentliche Schule wie in Ephesus, wo Paulus mehr als zwei Jahre lang und zwar täglich lehrte.
In der Gemeinde zu Kolossä gab es wohl Judenchristen oder umherziehende jüdisch-christliche Eiferer, welche versuchten, den Gläubigen ein schlechtes Gewissen zu bereiten, weil sie den Sabbat nicht so beachteten, wie es das Gesetz Moses vorschrieb. In seinem Brief an die Kolosser (Kap. 2,16-17) schreibt Paulus: „Niemand richte euch wegen Essens und Trinkens, oder in Hinsicht auf ein Fest, entweder Neumond oder Sabbate, welche sind ein Schatten der zukünftigen (Dinge), aber der Leib ist Christi.“ An welchem Tag sich die Gemeinde zu Kolossä versammelt hatte, um den Sabbat nach dem Gesetz des Mose einzuhalten, hat Paulus ihnen nicht gepredigt. Wieso sollten sie sich an den Buchstaben des Sabbatgebotes halten, also nur im Schatten stehen, wenn sie doch in Christus in das geistliche Gebäude einziehen konnten, gemeint ist hier, die wahre Ruhe Gottes in Christus und dies an jedem Tag der Woche.
An die Gläubigen zu Rom (Röm 14,5-6) schreibt Paulus ähnliche Worte, obwohl er den Begriff Sabbat nicht gebraucht: „Der eine aber beurteilt einen Tag im Vergleich zu einem (anderen) Tag, der andere beurteilt jeden Tag (gleich); jeder sei in seinem Sinn (Meinung) überzeugt! Der auf den Tag achtet, der tut es dem Herrn; und der da isst, isst dem Herrn, denn er dankt Gott.“
Auch in keinem anderen Brief der Apostel finden wir ein Plädoyer, also eine Verteidigung, für das buchstäbliche Einhalten des Sabbats. Daraus können wir schließen, dass er für das Heil der Christen keine nennenswerte Rolle gespielt hat.
Aber wir lesen in Apostelgeschichte 20,6b–7, dass sich Paulus mit seinen Mitarbeitern und der örtlichen Gemeinde in Troas am ersten Tag der Woche (Tag eins der Woche) versammelte, um das Brot zu brechen (Herrenmahl/Abendmahl). Obwohl Paulus in dieser Stadt schon vor sieben Tagen angekommen war, versammelte sich die Gemeinde am ersten Tag der Woche, also nach dem Sabbat. Warum? War es eine rein heidenchristliche Gemeinde? War Paulus am Vortag, also am Sabbat in der Synagoge bei den Juden? Hat sich die Gemeinde nach Möglichkeit jeden Tag versammelt, um Paulus zu hören?
Warum ist Paulus nicht am ersten Tag der Woche abgereist? Dieser erste Tag der Woche hat in der christlichen Gemeinde anscheinend eine Bedeutung gehabt. Auf jeden Fall bleibt die geschichtliche Tatsache bestehen, dass sich eine (heiden) christliche Gemeinde mit apostolischer Gegenwart am ersten Tag der Woche versammelte, um das Brot zu brechen und auf die Verkündigung des Apostels zu hören.
Auch wenn es nicht ausdrücklich gesagt wird, wann oder an welchem Tag der Woche sich die Gemeinden in Galatien versammelten, so gibt Paulus uns durch seine Verordnung einen bestimmten Hinweis. Die Galater sollten für die armen Gläubigen in Judäa am ersten Tag der Woche Geld sammeln oder auf die Seite legen (1Kor 16,1-2). Der Gemeinde in Korinth ordnet der Apostel an, die Sammlung am gleichen Tag, also am ersten Tag der Woche (Versammlungstag), durchzuführen.
Warum gerade am ersten Tag der Woche und nicht am Sabbat?
- Erstens ist der Herr Jesus am ersten Tag der Woche durch die Kraftwirkung des Vaters aus dem Tod auferweckt worden. Der erste Tag der Woche wird in der Offenbarung des Johannes `kyriak¢` Bis heute hat sich diese Bezeichnung im griechichen Kulturkreis erhalten, die Wochentage beginnen mit `kyriak¢`, was übersetzt werden kann mit: dem HERRN gehörender (Tag).
Am Auferstehungstag, welcher der erste Tag der jüdischen Woche war, begegnet Jesus der Maria aus Magdala, dann einer ganzen Gruppe von Frauen, dann dem Simon Petrus, dann den zwei Emmaus-Jüngern , welche nach Jerusalem zurückkehren und den restlichen Zehn von ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen berichten. Die Jünger erzählen ihrerseits den Zweien, dass Petrus den auferstandenen Jesus gesehen hat. Dann kommt Jesus in ihre Mitte und zeigt ihnen seine Hände und Füße, er isst sogar vor ihnen. Dieser Tag war ein Tag guter Nachrichten, ein Tag der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn und untereinander (erster Versammlungstag nach der Auferstehung). Damit bekommt er nicht nur symbolische sondern auch praktische Bedeutung.
Nach acht Tagen (also wieder am ersten Tag der Woche), nicht am nächsten Sabbat, besucht Jesus seine Jünger wieder, diesmal ist Thomas dabei (zweiter Versammlungstag nach der Auferstehung).
Am ersten Tag der neuen Arbeitswoche ist der allmächtige Gott bei der größten Arbeit, nicht wie damals bei der Schöpfung als er das Licht aus der Finsternis hervorrief, sondern er holt seinen geliebten Sohn aus der Finsternis des Todes ins Leben zurück. Auf diese Weise beginnt am ersten Tag der Woche die neue Schöpfung und sie beginnt mit dem auferstandenen Christus.
- Ein zweiter Grund für die Versammlung der Gemeinden (Troja, Korinth, Galatien) am ersten Tag der Woche kann in der Ausgießung des Heiligen Geistes gesehen werden. Diese fand fünfzig Tage nach dem Passah-Sabbat des Jahres 33 n. Chr. statt (3Mose 23,15-16; 5Mose 16,9), also auch am ersten Tage der Woche. Ist das Zufall, oder können wir darin eindeutig die wunderbare Vorsehung Gottes erkennen.
Übrigens waren die Jünger schon die ganzen zehn Tage nach der Himmelfahrt von Jesus in Jerusalem beständig beieinander im Gebet geblieben, wie Jesus es ihnen vor seinem Weggehen angeordnet hatte.
(8.) Zeugnisse aus der früheren Kirchengeschichte
Aus der Kirchengeschichte gibt es zahlreiche Zeugnisse von den Kirchenvätern, welche die Versammlungen der Christen am ersten Tag der Woche bestätigen und beschreiben.
- Justinus, ein frühchristlicher Philosoph und Märtyrer (+167), schreibt: „Am Sonntag kommen wir alle zusammen, weil (…) Jesus Christus, unser Erlöser, an diesem Tage von den Toten auferstanden ist.“ Der wöchentliche „Tag des Herrn“ ist Wurzel und Vorbild für alle späteren christlichen Feste und Feiertage. Aus Freude über die Auferstehung wird in der frühen Kirche am Sonntag nie gefastet und beim Gottesdienst nicht gekniet, sondern nur stehend gebetet.
- Ignatius schreibt 110 n.Chr. an die Magnesier (zwischen Ephesus und Milet gelegen): „Wir feiern nicht mehr den Sabbat, sondern halten den Tag des Herrn, an dem auch unser Leben aufging durch ihn und seinen Tod.“
- In der um 125 entstandenen „Zwölfapostellehre“ heißt es: „Am Tage des Herrn versammelt euch, brecht das Brot und sagt Dank (…).“
- Plinius (Gouverneur von Bithynien, 106-108 n.Chr.) schrieb über die Christen an den Kaiser Trajan: „Es ist ihre Gewohnheit, an einem bestimmten Tage vor Sonnenaufgang zusammenzukommen und abwechselnd unter sich ein Lied ihrem Christus, den sie als Gott verehren, zu singen.“
- Eusebius erklärt diesen bestimmten Tag: „Die Gottesdienste wurden sehr früh an jedem Morgen des Auferstehungstages gefeiert.“
- Barnabas (120 n.Chr.) sagt: „Wir feiern den achten Tag mit Freuden. Es ist auch der Tag, an dem Christus von den Toten auferstand.“
- Justin (140 n. Chr.) schreibt: „Dass am ersten Tage, der auch Sonntag genannt wird, kommen alle, die in den Städten und auf dem Lande wohnen, zusammen auf einem Platz, und die Schriften der Apostel oder die Propheten werden solange gelesen, als es die Zeit gestattet (…) Sonntag ist der Tag, an dem wir unsre Zusammenkunft haben, weil (…) Jesus Christus, unser Erlöser, an diesem Tage von den Toten auferstand.“
Diese Zeugnisse der Geschichte – wobei nicht behauptet wird, dass es sich um inspirierte Schreiber handelt – werden nur deshalb zitiert, weil immer wieder gesagt wird, dass im Jahre 321 n, Chr. durch Konstantin unter Einfluss der katholischen Kirche der Sabbat abgeschafft und der Sonntag eingeführt worden sei. Das ist ein Irrtum, der auch durch ständiges Wiederholen nicht wahr wird.
Es ist zwar eine Tatsache, dass der erste Tag der Woche um 321 n. Chr. durch Konstantin zum gesetzlichen Feiertag erhoben wurde, doch nur deswegen, weil sich die Christen schon seit mehr als zweieinhalb Jahrhunderte an diesem Tag versammelten.
(9.) Schlussfolgerungen
Das Neue Testament macht keinerlei Vorschriften in Bezug auf bestimmte Tage, an denen die Christen sich zu versammeln haben. In der ersten Zeit trafen sie sich täglich, sie trafen sich abends, sie trafen sich nachts zum Gebet oder Predigt, sie trafen sich in Gefängnissen, beteten zu bestimmten und auch unbestimmten Zeiten in verschiedenen Körperhaltungen und an ganz ungewöhnlichen Orten und an verschiedenen Tagen.
Da wir mehrere Belege für die Gemeindeversammlung am ersten Tage der Woche mit apostolischer Gegenwart haben (die Apostel in Jerusalem, Paulus in Troja), so dürfen wir ruhig unsere Gottesdienste an diesem Tag, dem Auferstehungstag unseres Herrn und Erlösers, feiern und uns darüber freuen, dass der siebte Tag der Woche, also der Sabbat in unserem Land noch (wir wissen nicht wie lange) ein freier Tag ist, an dem wir uns ausruhen und viel Gutes tun können, wie auch an allen anderen Tagen der Woche.
Doch trotz all der Freiheit, die wir in Christus haben, wollen wir uns an Jesus orientieren, der sich immer wieder Ruhe-Pausen suchte und fand. Denn nicht im Schaffen, sondern im Ruhen in Gott werden wir stark sein und befähigt, unseren Dienst für Gott an den Menschen tun zu können.
Aktualisiert am 7. Januar 2025