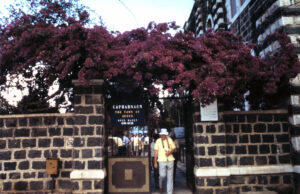-
Neueste Beiträge
Kategorien
- Apokalypse
- Audio-Predigten
- Aus dem Leben von Jesus
- Biographien
- Ehe und Familie
- Fragen an Jesus
- Fragen und Antworten
- ISRAEL
- JESUS
- Jesus und das Gesetz
- JESUS, WOHIN GEHST DU?
- Mensch, ärgere dich nicht
- OFFENBARUNFG
- Paulus
- Reiseberichte
- Sabbat/Sabbatismos
- Seligpreisungen
- Sonderthemen
- Uncategorized
- UNTERWEGS MIT JESUS
- Verordnungen von Jesus
- Video
- Vom Traditionalisten zum Evangelisten
- Wer ist Jesus?
- Wer ist Jesus?
Meta
Kapitel 4: Die 1. Missionsreise
Veröffentlicht unter Vom Traditionalisten zum Evangelisten
Schreib einen Kommentar
Kapitel 3: Jerusalem – Tarsus – Antiochien – Jerusalem
3.1. Paulus bei der Gemeinde in Jerusalem
Als Paulus von Damaskus nach Jerusalem zurückkehrt, kann er nicht ahnen, dass sein Aufenthalt dort nur kurz sein wird. Er bemüht sich zunächst, Kontakt zu den Jüngern zu bekommen (Apg 9,26). Die früheren Versammlungsplätze sind ihm bekannt, doch wo immer er auch anklopft und sich als Jünger vorstellt, begegnen ihm Furcht und Misstrauen. Die Verfolgung hatte die Jünger Vorsicht gelehrt (Mt 10,17). In Damaskus dachte wohl niemand von den Jüngern an die Notwendigkeit eines Empfehlungsschreibens (Apg 18,27). Auch hatte Paulus zu diesem Zeitpunkt noch keine Mitarbeiter als Begleiter bei sich. Aber er gibt nicht auf. Schließlich trifft er auf Barnabas, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes (Apg 11,24). Barnabas war auf Zypern geboren und ist von seiner Abstammung her Levit. Seine Einstellung ist weitherzig, er wird „Sohn des Trostes“ genannt (Apg 4,36). Barnabas besitzt das Gespür, den Durchblick und den Mut, Paulus aufzunehmen (Apg 9,27a). Er kommt dem Wunsch des Paulus nach und brachte ihn zu den Aposteln (Apg 9,27b).
Aus Galater 1,18 erfahren wir jedoch von Paulus selbst, dass er lediglich mit Petrus intensive Gemeinschaft hatte und Jakobus, den Bruder des Herrn, sah. Paulus blieb fünfzehn Tage bei Petrus, das könnte heißen, er wohnte als Gast im gleichen Haus wie auch Petrus. Während Barnabas für Paulus die Brücke zur Gemeinde wurde, trug Petrus viel zu seiner Integration in die Gemeinde bei. Am Anfang ihres Kennenlernens stand mit Sicherheit die ausführliche Geschichte von Paulus‘ Begegnung mit Jesus sowie sein erstes Zeugnis in Damaskus (Apg 9,27). Von Petrus konnte Paulus sozusagen aus erster Hand vieles über das Leben und Wirken Jesu erfahren.Nachdem Paulus in der Gemeinde aufgenommen ist, drängt es ihn, den Namen Jesu in der Stadt zu bezeugen, in der er ihn ausrotten wollte: Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn (Apg 9,28). Da er die griechische Sprache beherrschte, ist es leicht verständlich, dass er zu den Hellenisten sprach. Nach Apostelgeschichte 6,1 und 9,29 wurden als `Helenisten` Juden bezeichnet, die von der grichischen Kultur und Sprache sehr stark geprägt waren. Möglicherweise waren es Leute aus der Synagoge der Libertiner (…) und derer von Zilizien und Asien (Apg 6,9) mit denen auch Stephanus diskutierte, doch bei ihnen hat Paulus keinen Erfolg. Wahrscheinlich ist die Art seines Redens ein Streitgespräch (Apg 9,29) Er forderte seine Zuhörer heraus, so wie er es auch in Damaskus getan hatte. Die Reaktion ist ähnlich wie damals bei Stefanus: sie aber trachteten ihn umzubringen (Apg 9,29).
3.2. Paulus wird nach Tarsus gesandt
Und als das Blut des Stephanus, deines Zeugen, vergossen wurde, stand ich auch dabei und hatte Gefallen daran und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten“
(Apg 22,19-20). Doch der Herr bleibt dabei: „Geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden“ (Apg 22,21). Auch die Gemeindeleiter in Jerusalem wissen die Entwicklungen richtig einzuschätzen. Paulus wird von den Brüdern hinab nach Cäsarea geleitet und mit dem Schiff nach Tarsus ausgesandt (Apg 9,30).

Abbildung 14: Dieser Aquädukt war etwa 8 Kilometer lang und versorgte die Stadt Cäsaräa mit frischem Wasser aus dem Karmelgebirge (Foto: P. Schüle April 1986).
Auf diese Weise wirkt Gott immer wieder:
– Er beauftragt und sendet aus.
– Er bestätigt seinen Auftrag und seine Aussendung durch die vom Geiste Gottes erfüllte Gemeindeleitung.
– Durch Bereitschaft und den Gehorsam kommt der Plan Gottes zur Ausführung. „Danach kam ich in die Länder Syrien und Zilizien“ (Gal 1,21).
Dem fünfzehntägigen Aufenthalt des Paulus in Jerusalem ist eine grundlegende Bedeutung zuzumessen. Auf dem Schiff nach Tarsus konnte Paulus ermutigt an die Zeit in Jerusalem zurückdenken. In Barnabas hatte er einen echten Freund gefunden. Die enge Gemeinschaft mit Petrus und anderen Leitern trug viel dazu bei, dass Paulus seinen Wirkungsplatz im Reiche Gottes finden konnte. So kehrt Paulus nach mehreren Jahren nach Tarsus zurück, in die Stadt, in der er geboren war und seine Kindheit verbracht hatte. Er war in eigener Kraft und eigener Gerechtigkeit ausgezogen, um für die väterlichen Überlieferungen zu kämpfen (Gal 1,14); als von Gott Begnadeter und Gerechtfertigter, als Diener des Evangeliums, kehrt er nun in seine Heimatstadt zurück (1Tim 1,12-14).
Was hat Paulus denn nun einige Jahre lang in Tarsus gemacht? Diese Frage würde uns sehr interessieren doch sie lässt sich nicht ganz befriedigend beantworten. Dass Paulus dort in Abgeschiedenheit und Stille einige Jahre lang lebte, ist jedoch unwahrscheinlich; dafür wäre Arabien allemal geeigneter gewesen. Die Stadt Tarsus mit ihrem pulsierenden Leben, dem Götzendienst unter den vielen Volksgruppen und der starren Gesetzlichkeit der Juden in den Synagogen war für Paulus eher eine Herausforderung zur Predigt des Evangeliums als zum einseitigen Rückzug in die Stille zur persönlichen Auferbauung. Es gibt einen direkten und einen indirekten Hinweis für die evangelistische Tätigkeit des Paulus während dieser Zeit:
1. In Galater 1,21-24 gibt uns Paulus einen Einblick in sein Leben nach dem Besuch in Jerusalem: Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Cilicien. Ich war aber den Gemeinden in Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten aber nur gehört: Der, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte; und sie verherrlichten Gott um meinetwillen.
Hieraus kann man Folgendes schließen:
– Paulus hielt sich nicht nur in Tarsus auf.
– Er verkündigte die Frohe Botschaft.
– Die Gläubigen in Judäa freuten sich über ihn und seine Arbeit und priesen Gott, obwohl sie ihn nicht persönlich kannten.
2. In Apostelgeschichte 15,41 besucht Paulus zu Beginn seiner zweiten Missionsreise zusammen mit Silas die Gemeinden in Syrien und Zilizien, um sie zu stärken. An der Gründung dieser Gemeinden mögen auch andere beteiligt gewesen sein, aber warum nicht auch Paulus? Schließlich hatte er die gute Gewohnheit, Gemeinden immer wieder zu besuchen, die er gegründet hatte.
Eine weitere Begründung für seine evangelistische Tätigkeit in Zilizien wird durch die klare Beauftragung des Herrn in Jerusalem gegeben (Apg 22,21). Bei dieser Beauftragung und Aussendung wird nicht eindeutig gesagt, wann Paulus mit seinem Dienst unter den Heiden beginnen soll, doch warum nicht schon in seiner Geburtsstadt Tarsus und der Proinz Syien/Zilizien?
Man kann also annehmen, dass Paulus in jener Zeit in Tarsus wohnte, durch seinen Beruf als Zeltmacher seinen Lebensunterhalt verdiente und jede Möglichkeit nutzte, um das Evangelium in den Synagogen der Stadt und der Umgebung zu verkündigen.
3.3. Antiochien – eine Gemeinde entsteht
In der Zeit der Verfolgung in Jerusalem, die wegen Stephanus entstand, wurden die Gläubigen zerstreut und etliche von ihnen zogen bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia (Apg 11,19).

Antiochien am Orontes (heute Antakya in der Südosttürkei) war damals Hauptstadt der römischen Provinz Syrien (Foto: P. Schüle 8. April 2011).
Einige Zyprioten und Kyrenäer redeten Gottes Wort in Antiochien auch zu den Hellenisten. Und des Herrn Hand war mit ihnen und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zum Herrn (Apg 11,19-21). Die Nachricht über diese Entwicklungen erreichte schließlich die Gemeinde in Jerusalem. Man wollte nicht nur Genaueres erfahren, sondern auch die Neuanfänge unterstützen (Apg 11,22). Die Jerusalemer Gemeindeleitung sandte Barnabas aus, dass er bis nach Antiochien gehen sollte (Apg 11,22b). Für diese Aufgabe war er der geeignete Mann. Er hatte weder familiäre Verpflichtungen (1Kor 9,5-6), noch war er an Haus und Hof gebunden (Apg 4,37). Seine geistlichen Qualitäten, die gedankliche Nähe nach Antiochien als Zypriot, seine griechischen Sprachkenntnisse, seine Erfahrung in der Gemeinde Jerusalem sowie seine Bereitschaft, Neuland zu betreten waren gute Voraussetzungen für diese Aufgabe.
Was die zeitliche Einordnung dieser Reise betrifft, so muss sie deutlich nach dem Paulusbesuch in Jerusalem stattgefunden haben. Der 1. Paulus-Besuch in Jerusalem war ca. 37 n.Chr., siehe Kap. 2.5. „Antiochien am Orontes (heute Antakia, Südosttürkei), um 300 v. Chr. von Seleukos I. Nikator gegründet. Ca. 25 km vom Meer entfernt befindet sich der Hafen Seleuzia. 64 v.Chr. von Pompeijus annektiert und zur Hauptstadt der röm. Provinz Syrien erklärt. Antiochien galt als drittgrößte Stadt im röm. Reich.“ Negev, Avraham. Archeologisches Lexikon, 1986.
Die Entfernung von Jerusalem bis Antiochien beträgt etwa fünfhundertfünfzig Kilometer. Auf dem Weg dorthin besuchte Barnabas wahrscheinlich die neu entstandenen Gemeinden in Phönizien mit den Städten Tyrus und Sydon, so dass seine Reise schon länger gedauert haben konnte. Die Wendung dass er hindurchzöge bis nach Antiochia (Apg 11,22b) würde die Annahme von Zwischenstopps in Phönizien begründen.
Als Barnabas schließlich in Antiochien ankam und sah, was Gott durch seine Gnade bewirkt hatte, freute er sich (Apg 11,23). Sein Auftrag bestand also sowohl in der Bestandsaufnahme als auch in der Festigung der Gemeinde. Durch seinen Dienst wurden noch viel mehr Menschen gläubig (Apg 11,24). Die Arbeit weitete sich immer mehr aus und Barnabas erkannte seine Grenzen. Weder war er auf seine Karriere bedacht, die er in der Gemeinde machen konnte noch gibt sich zufrieden mit dem Erreichten. Barnabas sah den Bedarf der Gemeinde nach Unterweisung in der biblischen Lehre. Immer wieder erinnert er sich an Paulus. Diesen Mann wollte er nach Antiochien holen. So machte er sich auf den Weg nach Tarsus, um Paulus aufzusuchen und ihn nach Antiochien einzuladen (Apg 11,25f). Die Freude des Wiedersehens war mit Sicherheit groß. Die Freunde hatten sich viel zu erzählen, da seit ihrem Kennenlernen in Jerusalem inzwischen einige Jahre vergangen waren. Es ist gut vorstellbar, dass sich Paulus über die Einladung des Barnabas freute und sie gerne annahm. An der Seite eines Mannes zu arbeiten, der von Anfang an in der Jerusalemergemeinde dabei war, war für ich ein Privileg.
Paulus war ein Mann der Großstädte. Antiochien, eine Provinzhauptstadt mit einer aufblühenden Gemeinde, zog ihn an.[2] Auf diese Weise würde er auch in den engeren Kreis der damaligen Gemeindeleitung einbezogen werden. Er bricht erneut seine Zelte ab und geht mit Barnabas in die etwa 225 km entfernte syrisch-kilikische Provinzhauptstadt. Die Wendung und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia (Apg 11,26a), macht nicht nur deutlich, dass Barnabas die Regie führte, sondern dass Paulus bereit war, sich einbinden zu lassen, und anzuerkennen, dass Gott ihm seinen Weg auch durch die Brüder aufzeigen konnte. Die gesamte Suchaktion konnte viele Wochen in Anspruch genommen haben. In Antiochien angekommen, werden Barnabas und Paulus freudig aufgenommen. Für Paulus beginnt ein neuer Lebensabschnitt, der für seinen weiteren Dienst einen entscheidenden Eindruck hinterlassen wird. Die Gemeinde in Antiochien setzt sich aus verschiedenen Menschen zusammen. Da sind Juden, die aus einer festen Tradition kommen und aramäisch sprechen; Hellenisten, die der Herkunft nach zwar Juden sind, aber ihre Sprache und Lebensweise ist griechisch, sie sind viel weltoffener und toleranter. Und es sind auch recht bald Heiden (Nichtjuden) zum Glauben gekommen (Gal 2,12). Einen Teil der Bevölkerung in dieser Großstadt bildeten Sklaven. Man kann davon ausgehen, dass sich auch aus dieser Schicht viele zum Herrn bekehrten. Diese Menschen bilden nun eine Gemeinde. Hier erfüllt sich im Ansatz, was Jesus in Johannes 10,16 vorausgesagt hat: Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof (Schafgehege) sind, auch diese muß ich bringen, und sie werden meine Stimme hören; und es wird eine Herde, ein Hirte sein. An Barnabas und Paulus sehen wir, was gabenorientierte Gemeindearbeit bedeutet. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit besteht aus Lehre und Unterweisung (Apg 11,26b), und dies tun sie ein ganzes Jahr lang. Man kann sich sowohl Einzel- als auch Gruppen- und Gemeindeunterweisung vorstellen (vgl. Apg 20,20b). Hier führten Barnabas und Paulus aus, was Jesus seinen Jüngern aufgetragen hatte und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe (Mt 28,20). Beiden wird bescheinigt, dass sie die Gabe der Prophetie und der Lehre hatten (Apg 13,1). So sind sie imstande, alttestamentliche Verheißungen richtig auf Jesus und das neu angebrochene Reich Gottes zu deuten und anzuwenden. Sicher waren Evangelisation und Seelsorge ebenfalls in ihrem Aufgabenbereich eingeschlossen. Auch andere Menschen arbeiteten mit ihnen, und so wuchs die Gemeinde. Es fällt hier auf, dass keine Wunder und Zeichen erwähnt sind, obwohl sie keineswegs ausgeschlossen sind. In ihrer Art ergänzen sich die beiden. Paulus ist sehr direkt in seiner Art; dies führt oft schnell zu zwei Fronten und zu Opposition (Apg 9,29). Barnabas kann den Weg vorbereiten, verbinden und ausgleichen. Außer Jesus selbst ist jeder Mensch einseitig, deswegen hat der Herr immer wieder seine Jünger in Zweierteams ausgesandt (Lk 10,1; Mk 6,7). Dies ist ein wichtiges Prinzip sowohl im Gemeindebau, als auch in der Mission. Die Gemeinde muss in einem solchen Maße gewachsen und zu einem nicht übersehbaren Faktor in der Stadt geworden sein, dass man die Gläubigen mit dem Namen Christen belegte (Apg 11,26). Das kam wohl daher, dass sie so viel und öffentlich über Christus sprachen. Erst später wurde der Name Christen zur Selbstbezeichnung (1Petr 4,16).
[1] Der 1. Paulus-Besuch in Jerusalem war ca. 37 n.Chr., siehe Kap. 2.5.
[2] Antiochien am Orontes (heute Antakia, Südosttürkei), um 300 v. Chr. von Seleukos I. Nikator gegründet. Ca. 25 km vom Meer entfernt befindet sich der Hafen Seleuzia. 64 v.Chr. von Pompeijus annektiert und zur Hauptstadt der röm. Provinz Syrien erklärt. Antiochien galt als drittgrößte Stadt im röm. Reich. Negev, Avraham. Archeologisches Lexikon, 1986.
3.4. Paulus kehrt nach Jerusalem zurück
Das Leben und Wirken in der Gemeinde Antiochien war abwechslungsreich und die Gottesdienste vielseitig. Es gibt leider keinen Hinweis darauf, wo sich die Gläubigen versammelt haben.
Das Innere der Petruskirche am Südhang von Antakya-Türkei (Antiochien) gelegen. Sie wird als eine der ältesten Versammlungsplätze der Christen in Antiochien vermutet. Die Grotte wurde im 5. Jh. zu einer Kirche ausgebaut. Heute finden dort zu bestimmten Anlässen Gottesdienste statt
Vermutlich wurden sie in den Synagogen nicht allzu lange geduldet. So werden wohl auch hier die Versammlungen in Häusern stattgefunden haben.
Mosaikfußboden in der
Eines Tages kommen einige prophetisch begabte Jünger aus Jerusalem nach Antiochien herab (Apg 11,27). Sicher werden sie freundlich aufgenommen und man freut sich, etwas Neues aus Judäa zu erfahren; allerdings hat einer der Jünger, Agabus, auch eine ernste und sorgenvolle prophetische Botschaft zu deuten (Apg 11,28). Über die ganze bewohnte Erde wird eine große Hungersnot kommen, wovon die Gläubigen in Judäa besonders betroffen sein werden. Der Begriff `οικομενη – oikomene` kommt im NT sechzenmal vor (Mt 24,14; Lk 2,1; 4,5; 21,26; Apg 11,28; 17,6. 31; 19,27; 24,5; Röm 10,18; Hebr 1,6; 2,6; Offb 3,10; 12,9; 16,14; 20,2) und hat meistens globale Bedeutung, in einigen Fällen wird der Begriff jedoch auch räumlich eingegrenzt verwendet. Römische Geschichtsschreiber bestätigen, dass es während der Regierungszeit des Kaisers Klaudius solche überregionale Dürreperioden und Hungersnöte gegeben hatte (Neudorfer: 1990, 249). Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich diese Hungersnöte damals auch über die Grenzen des römischen Reiches erstreckt haben, ähnlich wie in Offenbarung 3,10 angedeutet wird.
Diese Prophetie wird nicht einfach als Information aufgenommen, sondern löst eine gezielte Hilfsaktion bei den materiell besser gestellten Gläubigen in Antiochien aus. Dabei fallen drei Dinge auf:
- Alle beteiligen sich (11,29),
- alle geben gemäß ihres Vermögens (11,29),
- die Motivation ist Dienst und Gemeinschaft (gr. διακονια und κοινονια – diakonia und koinonia) an denen, die bald große Not haben werden (vgl. Röm 15,27).
Das Geld wird nicht durch die Gäste aus Jerusalem nach Judäa übersandt, sondern durch Vertraute der Gemeinde in Antiochien, nämlich Barnabas und Saulus (Apg 11,30). Hier lässt sich ein Prinzip im Bereich Spenden und Opfergaben erkennen, nämlich, Transparenz, indem mehrere, unabhängige und verschiedene Personen einbezogen werden. Es heißt in diesem Text ausdrücklich: „das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten“ (Apg 11,30). Es geht hier also in erster Linie um die Sendung des Geldes durch die genannten Personen, nicht um die Sendung von Personen.
Barnabas ist noch immer Abgesandter der Jerusalemer Gemeinde (Apg 11,22b); nun bietet sich ihm die Gelegenheit, nach Jerusalem zurückzukehren, um von der Entwicklung in Antiochien zu berichten. Paulus ist nicht in gleichem Maße wie Barnabas der Gemeinde in Jerusalem Rechenschaft schuldig; aber erstens ist er dessen engster Mitarbeiter und zweitens ist auch er von Jerusalem durch den Herrn und die Brüder ausgesandt worden (Apg 22,21; 9,30). Dies wird noch deutlicher in Apostelgeschichte 12,25a wo es heißt: „Barnabas aber und Saulus kehrten zurück nach Jerusalem, (gr. εις Ιερουσαλημ – eis Jerusalem) erfüllt habend den Dienst. Die Lesart `nach Jerusalem` gilt als die beste (Haubeck: 1997, 725). Der Formulierung: `kehrte (kehrten) zurück nach Jerusalem` begegnen wir noch an weiteren sechs Stellen bei Lukas: Lk 2,45; 24,33. 52; Apg 1,12; 8,25; 13,13. Das `zurückkehren nach` (mit Akk.) einer Stadt, oder Region, wird noch durch weitere drei Stellen belegt (Lk 4,14; Apg 14,21; Gal 1,17). Dies führt zur Annahme, dass Barnabas und Saulus von Antiochien nach Jerusalem zurückgekehrt sind und nicht umgekehrt.
Sicher war das Überbringen des Geldes auch ein Dienst, aber im Kontext von Apostelgeschichte 11,22-12,25 überwiegt die eindeutige Aussendung des Barnabas nach Antiochien mit einem bestimmten Auftrag und die fast zwangsläufig daraus resultierende Rückkehr nach Jerusalem. Dass Barnabas hier an erster Stelle genannt wird, macht deutlich, dass er die Führung im Team hatte und Saulus/Paulus vorerst sein Begleiter war.
Doch auch für Paulus ist es eine willkommene Rückkehr nach Jerusalem, hat er doch damals diese Stadt nur ungern verlassen und inzwischen vieles erlebt, was er nun mitteilen will. Der Besuch in Jerusalem hat große Bedeutung. Zum einen können Barnabas und Paulus von der guten Entwicklung in Antiochien und anderen Städten berichten; die finanzielle Unterstützung aus Antiochien war ein spürbarer Beweis der Gemeinschaft unter den Gläubigen und somit eine Frucht des Evangeliums (Röm 15,27); zum anderen konnten sie in Bezug auf die weitere Missionsarbeit neue Vorschläge unterbreiten. Man kann also annehmen, dass die Gemeindeleitung in Jerusalem nach Überbringung des Geldes, Barnabas und Paulus erneut aussandte, um in Antiochien die Missionsarbeit fortzusetzen. Für Barnabas ist es eine Bestätigung, dass sein Arbeitsbereich nun außerhalb Jerusalems liegt. Für Paulus bedeutete dieser Besuch eine stärkere Einbindung in das Gesamtwerk der Gemeinde. Leider gibt es keine direkten Hinweise über Dauer und Inhalt ihres Jerusalemaufenthaltes, deswegen können wir hier nur mutmaßen. Die Anmerkung in Apostelgeschichte 12,25b „mitgenommen habend Johannes, mit Beinamen genannt Markus“ kann sich auf das erneute Verlassen Jerusalems beziehen; oder was wahrscheinlicher zu sein scheint, Markus war bereits bei der Inspektionsreise des Barnabas in Antiochien dabei und wurde nun von beiden auch wieder nach Jerusalem mitgenommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Barnabas nicht allein nach Antiochien gegangen ist (Apg 11,22) ist sehr groß.
Gerade in diesen Zusammenhängen wird das Bemühen von Barnabas deutlich, mit viel Geduld neue Mitarbeiter für die Mission zu gewinnen.
Dieser Jerusalembesuch könnte im Jahr 44 n. Chr. gewesen sein, da die Ereignisse in Apostelgeschichte 12 (Verfolgung in Jerusalem durch Herodes Agrippa I, 37-44 n. Chr.) zwischen der Abreise von Antiochien und Ankunft in Jerusalem geschildert werden. Dieser Jerusalembesuch ist mit dem Besuch in Galater 2 nicht identisch, wie von einigen Kommentatoren angenommen wird (vgl. z.B. Tenney: 1997, 293 und Bradford: 1986, 127). Dagegen sprechen nicht nur zeitliche Gründe (siehe die Begründung in Kap. 2.5), sondern auch inhaltliche (Gal 2,5. 7-8). Zum Zeitpunkt des Jerusalembesuches von Galater 2 war die erste Missionsreise schon vorbei, bei diesem Jerusalembesuch stand sie noch bevor. Dass Lukas keine weiteren inhaltlichen Angaben zum Aufenthalt in Jerusalem macht, ist nicht verwunderlich, gibt es doch in seiner Berichterstattung immer wieder Lücken. Lukas konzentriert sich nun in seinem Bericht auf die neue Etappe der Ausbreitung des Evangeliums von Antiochien aus (Apg 13).
Veröffentlicht unter Vom Traditionalisten zum Evangelisten
Schreib einen Kommentar
Kapitel 2: Jerusalem – Damaskus – Jerusalem
2.1. Saulus begegnet Jesus vor Damaskus
Über die erste Begegnung des Saulus mit dem auferstandenen Herrn in der Nähe der Stadt Damaskus gibt es drei ausführliche Berichte in der Apostelgeschichte: Kapitel 9,3-9; 22,6-11; 26,12-18. Kurze Hinweise über seine Berufung finden wir in Apostelgeschichte 9,27; Galater 1,15; 1Korinther 15,8; 2Timotheus 1,11 und an anderen Stellen.

Abbildung 7 Damaskus – die heutige Stadt erstreckt sich von West nach Ost auf einer Länge von etwa 24 Kilometer (Foto: P. Schüle 10. April 2011).
Die Verfolgung in Jerusalem und Umgebung hat sich wohl über mehrere Monate hingezogen. Dafür spricht zum einen der große Umfang der Verfolgung (Apg 8,1 „διογμος μεγας – große Verfolgung“ und zum anderen mussten viele Verfolgte erst in Damaskus angekommen sein, sich dort integriert und das Zeugnis von Jesus weitergegeben haben (Apg 8,4), bevor die Informationen über das Zunehmen der Nazoräer in Damaskus zurück nach Jerusalem gekommen sein konnten. Bis sich Saulus dann entschloss, nach Damaskus zu reisen, verging auch noch Zeit. Auch die Formulierung in Apg 9,1: „Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn“, spricht für Kontinuität und zeitliche Ausdehnung der Verfolgungswelle in Jerusalem und Umgebung. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass sich die Verfolgung über längere Zeit hingezogen hat. Nun muss es Saulus wohl aufgefallen sein, dass sein Vorgehen die Ausbreitung der neuen Lehre nicht verhinderte, sondern förderte. Hier werden seine Treue zum gesetzlichen Gottesdienst, sein eiserner Wille, sein fester Charakter sowie sein blinder Eifer für Gott deutlich (Joh 16,2; Röm 10,2). Paulus hörte, dass viele Gläubige nach Damaskus flohen und dort die neue Lehre verbreiteten.
Damaskus war eine bedeutende syrische Stadt, etwa 242 km von Jerusalem entfernt (6-8 Tagereise). Im Jahre 64 v. Chr. wurde sie der römischen Provinz Syrien einverleibt (Haubeck: 1997, 690f). Die Geschichte der Stadt reicht bis in die Frühzeit (1Mose 14). Sie hatte eine starke jüdische Bevölkerungsgruppe, die in mehreren Synagogengemeinden zusammengeschlossen war. Diese jüdischen Gemeinden betrieben ihrerseits eine starke Proselytenwerbung. Saulus ging es wohl in erster Linie um diejenigen des „neuen Weges“, die von Jerusalem flüchteten (Apg 26,11), also um Jerusalemer Bürger (Haubeck: 1997, 691). Obwohl die Juden in der Diaspora die Autorität des Hohenpriesters und Ältestenrates in Jerusalem anerkannten, ist es fraglich, ob die dort ansässigen Juden ohne Zustimmung der örtlichen Behörden gefesselt nach Jerusalem geführt werden durften. Auch Jesus wurde gefragt, aus welchem Herrschaftsgebiet er komme (Lk 23,7), und wurde entsprechend zu Herodes gesandt, der für juristische Angelegenheiten der galiläischen Bürger zuständig war.
Später taten sich in der Tat die Juden von Damaskus mit den Stadtbehörden zusammen, um Saulus zu fangen (vgl. Apg 9,23 mit 2Kor 11,32). In Apostelgeschichte 9,14 jedoch bezieht sich die Vollmacht zu fesseln auf alle, welche Jesu Namen anrufen. Zu der geplanten Verfolgung durch Saulus kam es jedoch nicht.
Es mag Saulus einige Überwindung gekostet haben, zu dem amtierenden Hohenpriester Kaiphas zu gehen, der zu der Partei der Sadduzäer gehörte. Lehrmäßig waren sich die Pharisäer und Sadduzäer nicht einig. Ja sogar weit voneinander entfernt; aber wie so oft in Fällen, in denen man einen gemeinsamen Feind hat, sieht man zeitweise über die internen Streitigkeiten hinweg. Die Initiative geht hier von Saulus aus. Und so bekommt er von dem Hohenpriester nicht nur die gewünschte Erlaubnis, sondern auch die erforderlichen Vollmachten in Form von beglaubigten Briefen an die Synagogen von Damaskus (Apg 9,2; 26,12). Dabei wurde die gesamte Aktion auch von anderen Oberpriestern und dem Ältestenrat unterstützt (Apg 22,5; 4,6). So bekommt Saulus wohl auch Begleitschutz durch die Tempelbehörde für die Ausführung seines Vorhabens und macht sich auf den Weg nach Damaskus.
Ludwig Schneller, der die palästinische und syrische Landschaft gut kannte, schreibt Anfang des 20. Jh.: „Acht Tage konnte diese Reise gedauert haben“ (Schneller: 1926, 32). Nach Apg 9,8b sind sie zu Fuß unterwegs – Bilder, die in der Pauluskirche in Damaskus zu sehen sind, nach denen Saulus bei der Erscheinung Jesu vom Pferd stürzt, sind durch die biblischen Texte nicht gedeckt. Wahrscheinlich ist Saulus zunächst entlang des Jordan und dann am See Genezaret über die Golan-Höhen, dann weiter über das biblische Edrej (heute Daraa) nach Damaskus gereist. Was mag in seinem Herzen vorgegangen sein, als er an den Wirkungsplätzen Jesu vorüber zog? Er wird wohl von den vielen Verhören, die er geführt hatte, mehr über Jesus erfahren haben, als ihm lieb war. Aber auch das mutige Erdulden und Ertragen von Schlägen und Misshandlungen seitens der Jünger Jesu, sprach eine deutliche Sprache. Woher nahmen sie die Kraft, für ihre Verfolger zu beten und sie zu segnen, anstatt sie zu verfluchen (Mt 5,44; Apg 7,60)? Reisen haben früher mehr als heute Gelegenheit zum Nachdenken geboten. Solch eine Reise konnte nicht nur wegen Gefahr durch Räuber gefährlich sein, sondern bot dem Reisenden je nach Jahreszeit Gelegenheit zum Nachdenken und sich der Natur zu erfreuen.
Das große und bedeutende Erlebnis des Saulus wird örtlich und zeitlich festgehalten. Von Süden her kommend, muss Damaskus in der Ebene des Barada-Flusses liegend, weit und gut sichtbar gewesen sein, d.h., nur noch einige Stunden entfernt (Apg 9,3; 22,6).
Die übernatürliche Begegnung mit Jesus geschah „mitten am Tag“ (Apg 26,13) oder „mittags“ (Apg 22,6), also zu einer Tageszeit, als die Sonne im Zenit stand und am hellsten leuchtete.
Es gibt wohl kaum einen aufmerksamen Bibelleser, der sich nicht mehr oder weniger an den zum Teil unterschiedlichen Texten, die das gleiche Ereignis beschreiben, gestoßen hätte. Mir geht es jedoch nicht darum, die Unterschiede hervorzuheben, sondern vielmehr die Gemeinsamkeiten, bzw. Ergänzungen zu unterstreichen, wenn auch eine Auseinandersetzung mit den scheinbar gegensätzlichen Aussagen nötig sein wird.
Dieter Hildebrand betont in seinem Buch Saulus-Paulus (1989, S. 69): „Nicht die Abweichungen verblüffen, sondern der Grad der Übereinstimmung in allen drei Texten.“ Hinzu kommt, dass Lukas in Kapitel 9 der Apostelgeschichte einen allgemeinen Bericht gibt, während er in den Kapiteln 22 und 26 Paulus selbst zu Wort kommen lässt, der wiederum dieses Erlebnis verschiedenen Personengruppen innerhalb seiner Verteidigungsreden erzählt (Apg 22,1; 26,1-2). Eine Aufstellung der Texte (zum Teil farblich unterschieden) in Form einer Tabelle gibt uns einen besseren Überblick über
- die wörtlichen und sinngemäßen Übereinstimmungen,
- die Ergänzungen und
- die scheinbaren Gegensätzlichkeiten (in rot/kursiv).
Statistisch gesehen sind von den etwa 450 Wörtern aller drei Texte
- 38% wörtlich oder sinngemäß übereinstimmend,
- 58% einander ergänzend
- und nur ca. 4% einander scheinbar widersprechend.
| Allgemeiner Bericht des LukasApg 9,3-9 | Verteidigungsrede in JerusalemApg 22, 6-11 | Verteidigungsrede in CäsareaApg 26,12-18 |
| Als er aber hinzog, geschah es, daß er sich Damaskus nahte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. | Es geschah mir aber, als ich reiste und Damaskus nahte, daß um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte. | Und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den Hohenpriestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag, auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die mit mir reisten umstrahlte. |
| Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: | Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach: | Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen: |
| Saul, Saul, was verfolgst du mich? | Saul, Saul, was verfolgst du mich? | Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen! |
| Er aber sprach: Wer bist du, Herr? | Ich aber antwortete: Wer bist du, Herr? | Ich aber sprach: Wer bist du, Herr? |
| Er aber (sagte): Ich bin Jesus, den du verfolgst! | Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus, der Nazoräer,den du verfolgst. | Der Herr aber sprach:Ich bin Jesus, den du verfolgst. |
| Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. | ||
| Ich sagte aber: Was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir: | ||
| Doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. | Steh auf und geh nach Damaskus und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. | Aber richte dich auf und stell dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende ihre Augen aufzutun, daß sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. |
| Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, dasie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. | ||
| Saulus aber richtete sich auf von der Erde. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. | Da ich aber von der Herrlichkeit jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von denen, die bei mir waren, an der Hand geleitet und kam nach Damaskus. | |
| Und er konnte drei Tage nicht sehen und aß und trank nicht. |
- Bei der zentralen Aussage Saul, Saul, was verfolgst Du mich? und der Gegenfrage „Wer bist Du, Herr?“ gab es wohl keinen Anlass, bei den unterschiedlichen Gelegenheiten verschiedene Begriffe zu gebrauchen.
- Bei der zweiten Aussage „Ich bin Jesus, den Du verfolgst“ fügt Paulus noch die Herkunftsbezeichnung „Nazoräer“ Vor dem Volk Israel (Apg 22,8) zitiert Paulus die volle Antwort Jesu, weil dies für die Juden wichtig war. Es geht um Jesus, den Nazoräer (Apg 4,10 und Joh 19,19).
- Die zweite Frage des Paulus, „Was soll ich tun, Herr?“, ist im Zusammenhang mit der Verteidigungsrede in Jerusalem wichtig. Bis dahin hatte Paulus einen anderen Auftraggeber gehabt, den er fragen musste. Die Antwort Jesu auf diese Frage wird von Paulus in unterschiedlichem Umfang wiedergegeben. Die Antwort Jesu, die Berufung und Auftrag einschließt, fügt Paulus in seine Verteidigungsrede vor dem König Agrippa ein und nutzt damit die Gelegenheit zur Evangelisation (Apg 26,29) und zur Begründung seines Gehorsams gegenüber seinem neuen Dienst-Herrn (Apg 26,19).
Während wir beim Inhalt dieses Zwiegesprächs allein auf Saulus als Zeugen angewiesen sind, müssen wir feststellen, dass er nicht genau mitbekam, was mit seinen Begleitern geschah, bzw. wie sie die Vorfalle erlebten. Auch ist im Zwiegespräch, welches primäre Bedeutung hat, ein klares und eindeutiges Konzept zu sehen: Klare Aussagen von Jesus, logische Fragen von Saulus, wiederum für Saulus verständliche Antworten von Jesus. Der Rahmen jedoch, in dem die Botschaft übermittelt wird, enthält viele übernatürliche Elemente, die zum Teil auch unterschiedlich wahrgenommen werden. Daher ist es verständlich, wenn ergänzende oder sogar gegensätzliche Aussagen gemacht werden. Es ist auch leicht nachvollziehbar, dass es auf dem Restweg nach Damaskus zwischen Saulus und seinen Begleitern zum Austausch gekommen ist, wobei nicht unbedingt ein einheitliches Bild von den Begleitumständen des Ereignisses entstand. Ein übernatürliches Ereignis wird in der Regel subjektiv wahrgenommen.
a) Die Wahrnehmung durch Sehen:
- Ein helles Licht umstrahlt plötzlich Saulus und seine Begleiter (Apg 26,13).
- Saulus wird so stark geblendet, dass er eine Zeitlang (3 Tage) nicht sehen kann (Apg 22,11).
- Die Begleiter sehen zwar das Licht, werden aber nicht geblendet (Apg 22,9).
- Die Begleiter sehen niemand, d. h. keine Gestalt (Apg 9,7).
- Saulus sieht (auch ohne natürliches Sehvermögen) den Herrn (Apg 26,16; 9,17b; 9,27; 1Kor 15,8).
b) Zu Wer fiel zu Boden?
- Saulus und seine Begleiter fallen zur Erde/Boden (Apg 26,14).
- Die Begleiter stehen irgendwann auf und sind sprachlos (Apg 9,7). (Wir vergleichen dazu Johannes 18,18 mit Markus 14,54 und die klärenden Details in Markus 14,68b-70. Johannes beschreibt Petrus stehend am Feuer mit den Dienern. Markus beschreibt Petrus als sitzend am Feuer mit den Dienern. Was nun, steht Petrus oder sitzt er? Er tur beides, aber nicht gleichzeitig. Markus beschreibt Petrus, wie er aufsteht, in den Vorhof des Palastes hinausgeht und sich zu den anderen Dienern dazustellt).
- Saulus wird am Ende der Unterredung vom Herrn ausdrücklich aufgefordert aufzustehen (Apg 22,10). Die Begleiter standen schon vorher unaufgefordert auf.
c) Die Wahrnehmung durch Hören:
- Saulus hörte eine Stimme (Apg 22,7). Diese Stimme ist ausdrücklich an ihn gerichtet (Apg 26,14).
- Die Stimme geschah im hebräischen Dialekt (Apg 26,14).
- Saulus konnte die Worte verstehen (Apg 22,10a).
- Dass die Begleiter nicht mithören/verstehen konnten, was zu Saulus gesagt wurde (Apg 22,9), hat er wohl erst im Nachgespräch erfahren. Die Aussage in Apostelgeschichte 9,7, „sie hörten zwardie Stimme, sahen aber niemand“, betont die Einschränkung der Begleiter nicht nur im Sehen, sondern auch im Hören. (Für dieses Hören und doch nicht Hören/verstehen gibt es auch ein Beispiel in Johannes 12,28-29. Auch dort wurde die himmlische Stimme von den Dabeistehenden unterschiedlich wahrgenommen. Ein Teil des Volkes nehmen Donnergeräusch wahr, ein anderer Teil meint Engel reden zu hören. Wenn diese Stimme auch um der Menschen Willen geschah, wurde sie von ihnen doch nicht einheitlich wargenommen und schon gar nicht verstanden. Für das Volk war es ein Zeichen vom Himmel, nur Jesus verstand, was der Vater sagte).
Ergebnis: Lukas, der in einer Vielzahl von Details so präzise Angaben und Aussagen macht, wird sich doch an dieser Stelle nicht selbst widersprochen haben. Ich nehme an, dass der Heilige Geist den Lukas so geführt hat, dass er die scheinbar gegensätzlichen Aussagen nicht ausbügelte; vielmehr wird gerade dadurch das begrenzte und unterschiedliche Fassungsvermögen des Menschen zum Ausdruck gebracht, das sich zeigt, wenn er mit der himmlischen Welt konfrontiert wird.
In wenigen Minuten ist die mit viel Fleiß und Arbeit mühsam aufgebaute Lebenswelt des Saulus zusammengebrochen. Was er gesehen und gehört hatte, war so real, dass es sein Leben lang nie Zweifel gab, was den Glauben an Jesus betraf (2Tim 4,7). Doch so gewaltig dieses Erlebnis und so ehrlich das Fragen des Saulus auch war, Bekehrung kann man dieses Erlebnis noch nicht nennen.
Da Saulus auf Grund der Klarheit des Lichtes nichts sehen kann, wird er an der Hand geleitet und nach Damaskus gebracht (Apg 9,8b).
2. 2. Bekehrung des Saulus in Damaskus
Als Saulus am späten Nachmittag in die alte syrische Stadt Damaskus einzieht, ist die Stimme des Herrn immer noch in seinen Ohren. Es ist möglich, dass er an die Geschichten des Alten Testamentes dachte, in denen Damaskus eine nicht geringe Rolle gespielt hat (1Mose 14,15; 15,2; 2Sam 8,5; 1Kön 19,15; 2Kön 5,12; 8,7-9). Nun zieht er selber in diese Stadt ein. Doch er kann sich an dem pulsierenden Leben der Menschen nicht erfreuen, er sieht nichts. Momentan war er geistlich gesehen im Niemandsland. Zu seinem alten Leben würde er niemals mehr zurückkehren können, aber die Zukunft war noch nicht bestimmt.
Jesu Weisung war klar und eindeutig: „geh nach Damaskus, und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist“ (Apg 22,10b). Saulus wird bei einem Juden namens Judas untergebracht. Dieser Jude wohnt in der „geraden“ Gasse. (Das griechische Wort „ευθεος“ heißt „sofort“, es wird in diesem Zusammenhang jedoch mit „gerade“, im Gegensatz zu „krumm“ übersetzt). Der Ausdruck „und er konnte drei Tage nicht sehen“ (Apg 9,9), kann nach hebräischem Verständnis bedeuten, dass er schon am übernächsten (also am dritten) Tag von Ananias besucht wurde. Saulus war es in dieser Zeit nicht nach Essen und Trinken zu Mute, Viele Fragen beschäftigten ihn jetzt. Bilder aus der jüngsten Verfolgungszeit, die Pläne, hier in Damaskus reiche Beute zu machen, quälten ihn in seinem Gewissen. Wie konnte er das, was er angerichtet hatte, wieder gutmachen? Doch nun tut er das einzig Richtige in dieser Situation: er betete (Apg 9,11), und der Herr zeigte ihm in einem Gesicht den Ananias (Apg 9,12), der dann zu ihm kam, ihm die Hände auflegte und Weisungen erteilte.

Abbildung 8 Ananias legt Saulus die Hände auf und überbringt an ihn den Auftrag des Herrb. Eine Skulptur in der Ananiaskapelle in der Altstadt von Damaskus (Foto: P. Schüle 11. April 2011).
Dieser Ananias war gottesfürchtig nach dem Gesetz, hatte ein gutes Zeugnis bei den Juden in Damaskus (Apg 22,12) und war ein Jünger Jesu (Apg 9,10.13). Was Saulus dann am dritten Tag erlebte, lässt sich aus den zwei Texten der Apostelgeschichte 9,17-19 und 22,13-16 rekonstruieren:
- Durch Handauflegung und Zuspruch des Ananias wird Saulus wieder sehend (Apg 22,16b).
- Der Auftrag an Saulus wird wiederholt bzw. ergänzt (Apg 22,14-15).
- Durch Anrufung des Namens Jesu erlangt Saulus Sündenvergebung (Apg 22,16 b).
- Er lässt sich taufen (Apg 22,16b).
- Er wird durch erneute Handauflegung durch Ananias, mit dem Heiligem Geist erfüllt (Apg 9,17).
- Er nimmt Speise zu sich und kommt wieder zu Kräften (Apg 9,19).
Ananias legt Saulus die Hände auf und überbringt an ihn den Auftrag des Herrb. Eine Skulptur in der Ananiaskapelle in der Altstadt von Damaskus (Foto: am 11. April 2011).
Sicher war das, was Saulus vor Damaskus erlebte, mehr als nur ein geistliches Wachrütteln, aber die Bekehrung zu Christus durch die Sündenvergebung, Taufe und die darauf folgende Erfüllung mit dem Heiligen Geist, hat er erst in Damaskus erlebt. Die Aufforderung des Ananias in Apostelgeschichte 22,16 „Und nun, was zögerst du, steh auf, lass dich taufen und abwaschen deine Sünden indem du den Namen des Herrn anrufst“, spricht ebenfalls für die Umkehr des Saulus in Damaskus und nicht schon bei der ersten Begegnung vor Damaskus. Das alte Gebäude seines Lebens war völlig eingestürzt. Nun wurde ein neues, tragfähiges Fundament gelegt – Christus, seine Gnade, seine Vergebung und seine Gerechtigkeit. Auf diesem Fundament begann er nun aufzubauen.
2.3. Paulus bezeugt Jesus Christus in Damaskus
Der Text, der vom ersten Zeugnis des Saulus in Damaskus berichtet, ist sehr kurz, dafür aber voller wichtiger und interessanter Aussagen. Saulus geht nicht zu den örtlichen Synagogenleitern, um Grüße aus Jerusalem zu überbringen oder gar sich zu rechtfertigen für seine veränderte Einstellung gegenüber der neuen Bewegung, deretwegen er nach Damaskus kam. In Apostelgeschichte 9,19b wird deutlich gesagt, wo er sich nun aufhält, nämlich bei den Jüngern in Damaskus, d.h., bei denen, die er verfolgen, fesseln und nach Jerusalem bringen wollte.
Welch ein Triumph der Gnade Gottes. Die Jünger in Damaskus konnten es kaum fassen, doch sie sahen mit ihren eigenen Augen die Veränderung im Leben dieses Mannes. Sie hörten immer wieder von seiner Begegnung mit dem Auferstandenen vor Damaskus. Der von allen anerkannte und glaubwürdige Zeuge Ananias bestätigte die Echtheit der Bekehrung des Saulus. Hier bei den Jüngern fand er herzliche Aufnahme und Zuspruch, Einige Tage war Saulus bei den Jüngern und sofort am folgenden Sabbat wollte er öffentlich Zeugnis geben von seiner Begegnung mit Jesus.

Abbildung 9: Der Haupteingang zur Pauluskirche in der Altstadt von Damaskus (Foto: P. Schüle 11. April 2011 ).
Er nutzte also die nächstmögliche Gelegenheit, um in den Synagogen der Stadt von Jesus zu predigen. Da es in Damaskus mehrere Synagogen gab, ist anzunehmen, dass er mindestens Wochen, wenn nicht sogar Monate dort verbrachte. Der Kern seiner Predigt war: „Jesus ist der Sohn Gottes“ (Apg 9,20) und „Jesus ist der Messias“ (Apg 9,22b). Auf dieser Grundlage predigte er das „Umdenken und die Hinwendung(Bekehrung)zu Gott, um des Umdenkens würdige Werke zu tun“ (Apg 26,20). Diese für ihn neue Glaubensgrundlage hat er durch die Offenbarung Jesu bekommen (Gal 1,12). Dass Gott seine gute Kenntnisse des Alten Testaments mitbenutzte, ist ohne Zweifel. Jedoch die Erkenntnis „Jesus ist der Messias und der Sohn Gottes“, kann einem Menschen nur durch göttliche Offenbarung zuteil werden (Mt 16,17; Lk 24,45).
Ausdrücklich betont Paulus in der Apostelgeschichte 26,20, dass er zuerst in Damaskus gepredigt hatte. Die Reaktion auf seine Predigt ist ebenso verblüffend wie auch verständlich. Es gibt keinen Hinweis auf Massenbekehrungen, obwohl sie gar nicht ausgeschlossen sind. Deutlich betont wird jedoch die Bestürzung der Juden über den plötzlichen Frontwechsel bei diesem Mann aus Tarsus und Bevollmächtigten aus Jerusalem(Apg 9,21). Es entsteht der Eindruck, dass Saulus in Damaskus unter den Juden nicht so sehr warmherzig und werbend das Evangelium verkündete, sondern sie mehr durch massive Schriftbeweise zur radikalen Umkehr herausforderte. Dies entspräche ganz seinem Temperament. So wie eine Feder, die bis ans Äußerste ihrer Spannungsmöglichkeit auseinander gezogen und dann plötzlich losgelassen wird, in die Gegenrichtung schnellt, so mag es auch aus Saulus, der sofort alle überzeugen wollte, hervor gesprudelt haben.
Es ist nicht deutlich, wo im Lukanischen Bericht die sogenannte „Arabienlücke“ zu suchen ist, zwischen Apostelgeschichte 9,21 und 22 oder 9,22 und 23; beides wäre möglich. Falls Saulus bei seiner Rückkehr aus Arabien auch seinen Predigtstil geändert hat, der Inhalt blieb mit Sicherheit der gleiche. Eindeutig muss jedoch der Vers 23 in Kapitel 9 dem zweiten Damaskusaufenthalt zugeordnet werden. Ein Anschlag auf Saulus zum Ende des ersten Aufenthaltes in Damaskus scheint fraglich, da sonst seine erneute Rückkehr trotz Todesgefahr unverständlich wäre.
2.4. Paulus reist nach Arabien
Lediglich ein paar Worte werden zu dieser Arabienreise gesagt. Den Galatern schreibt Paulus (Gal 1,17): „ich ging sogleich (gr. ευθεος) fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück.“ Es gibt keine detaillierten Angaben über das Ziel, die Dauer und den Grund der Reise. Deshalb gilt auch hier die Feststellung: je weniger Informationen, desto mehr Spekulationen sind im Umlauf. Trotzdem ist es sinnvoll, darüber nachzudenken und einige Überlegungen anzustellen.
a) Geographische Einordnung von Arabien
Arabien ist von dem Hebräischen `Arabah` (Wüste), abgeleitet. Schaut man auf Karten des Orients, so lässt sich dieses Gebiet im Süden gut in die Arabische Halbinsel einordnen, im Norden rechnete man zum Zeitpunkt der Arabienreise des Saulus das Nabatäerreich mit der Hauptstadt Petra, unter deren Verwaltung auch Damaskus stand (2Kor 11,32).
In dem Gebiet des nördlichen Arabien wird sich Saulus aller Wahrscheinlichkeit nach aufgehalten haben. Wenn Jesus dem Saulus oft innerhalb weniger Tage konkrete Weisungen gegeben hat (Apg 22,10; 9,12), dann wird er das Weggehen von Damaskus nach Arabien kaum auf eigene Faust unternommen haben.
b) Dauer des Arabienaufenthalts
Auch über die Dauer des Arabienaufenthaltes kann man nur Vermutungen anstellen. Man kann nicht aufgrund fehlender biblischer Informationen sagen, der Aufenthalt dort wäre kurz gewesen. Allerdings kann er auch keine drei Jahre gedauert haben. Nach Galater 1,18 betrug die gesamte Zeitspanne zwischen Bekehrung und dem ersten Jerusalembesuch schon drei Jahre (siehe auch die Erklärung in Kap. 2.6.). Wenn man die Wirksamkeit des Apostels in Damaskus vor und nach Arabien genauer analysiert, könnte der Arabienaufenthalt durchaus (ein Jahr?) gedauert haben. Sein Beruf als Zeltmacher könnte ihm dort gut zustatten gekommen sein.
c) Mögliche Gründe für den Arabienaufenthalt
Auch zu den Günden der Reise macht Paulus keinerlei Angaben. Aus der Aussage in Galater 1,17 „ich ging weg“ geht jedoch hervor, dass er Damaskus nicht fluchtartig verlassen hat, sondern wohlüberlegt und geplant. Nach stürmischen Wochen oder Monaten angefüllt mit der Verkündigung des Evangeliums, sowie der Beweisführung aus dem Alten Testament brachte Saulus die Juden in Verwirrung (Apg 9,22), so dass sich bald eine Gegenoffensive anbahnte. Ein Rückzug in die Stille wäre genauso verständlich wie auch neutestamentlich begründet. Nicht ausgeschlossen ist auch ein missionarischer Vorstoß in die arabischen Gebiete (Apg 26,17), wo es ja auch Juden gab (Apg 2,11). Dass Paulus in seiner Rede an den König Agrippa von seinem Zeugnis in Damaskus und Jerusalem spricht, Arabien aber nicht erwähnt, ist noch kein Beleg dafür, dass er nicht auch in Arabien gepredigt hat. Kann sich jemand den Paulus als Schweigenden vorstellen? Aber aus der Gesamtperspektive seines Lebensdienstes gesehen, waren jene Gebiete nicht sein Missionsfeld

Abbildung 10: Ein Berg aus schwarzem Basalt im Wadi Rum in Südjordanien, unweit der Grenze zu Saudiarabien. Schon zur Zeit des Alten Testamentes suchten die Propheten die Stille und Einsamkeit in der Wüste (Foto: P. Schüle 6. November 2014).
In Galater 4,25 lokalisiert Paulus den Berg Sinai als „in Arabien“ befindlich. Er wusste also wo sich der Berg Sinai befand. War er vielleicht dorthin gereist zum bedeutenden Ort des Bundesschlusses zwischen Gott und dem Volk Israel? Aufgrund der Erklärung und Deutung des Zusammenhangs zwischen Hagar und Sinai in Galater 4,24ff könnte man sein Interesse am Berg Sinai in Arabien teilweise ableiten. Die Tatsache, dass gerade er im Galaterbrief zweimal Arabien nennt, lässt darauf schließen, dass ihm Arabien als Gebiet mit seiner historischen/theologischen Relevanz nicht gleichgültig war (2Mose 3,1-4Mose 10,13,; 1Kön 19,1-16). Obwohl Arabien `Wüste` und Araber ` Wüsten- oder Steppenbewohner` bedeutet, gab es dort seit uralten Zeiten auch Städte mit Hochkulturen und erfolgreichem Wirtschafts- und Handelsleben. Da zur Zeit des Saulus Arabien nicht nur die Arabische Halbinsel einschloss, sondern auch die Syrische Wüste südöstlich von Damaskus, ebenso die Gebiete des ehemaligen Moab und Edom, könnte sein Interesse auch diesen letzteren Gebieten gegolten haben, war doch das Ostjordanland eng mit der Geschichte seines Volkes verbunden.
2.5. Erneuter Aufenthalt in Damaskus und Flucht
Paulus folgte lebenslang dem Grundsatz, Missionsgebiete, in denen er das Evangelium verkündigte, immer wieder aufzusuchen und die dort gewonnenen Gläubigen zu stärken. Vorerst zog es ihn nicht nach Jerusalem, sondern zurück nach Damaskus, wo er sich zum Herrn bekehrte und wo er so herzliche Aufnahme bei den Jüngern gefunden hatte, dorthin, wo er seine ersten Schritte im Glauben machen konnte.
In Damaskus gab es eine funktionierende Gemeinde; es gab viele Juden und mehrere Synagogen. Die Stadt war ein Knotenpunkt für den ost-west und süd-nord Handel, eine Karawanenstadt am östlichen Rand des riesigen römischen Reiches.
Wenn Paulus noch später auf seinen Missionsreisen immer wieder sein Handwerk als Zeltmacher nutzte, um für sich und oft auch für seine Mitarbeiter das tägliche Brot zu verdienen (Apg 20,33) dann wird er auch sicherlich hier in Damaskus gearbeitet haben; die Stadt war auch für ihre Webereien bekannt.
An den Sabbaten wurde jede Gelegenheit genutzt, um das Evangelium zu predigen. Noch predigte Saulus den Juden oder auch den Proselyten, von denen es in Damaskus viele gab. Proselyten waren Heiden, die durch Beschneidung und Taufe in die jüdische . Gemeinschaft aufgenommen wurden. Er muss Erfolg gehabt haben, so dass sich schon bald wieder eine starke Opposition von Seiten der Juden gegen ihn formierte.
Im Text der Apostelgeschichte 9,23 lesen wir: „als sich aber viele Tage erfüllten, beschlossen die Juden ihn umzubringen“. Diese unbestimmte Zeitangabe lässt nicht nur auf Wochen, sondern auch auf einige Monate der Wirksamkeit des Apostels schließen.
Eindeutig geht der Beschluss, Saulus umzubringen, auf die Juden zurück (Apg 9,23b). Aber so viele Juden es auch in Damaskus gab, und so selbständig sie in einer für sie fremden Stadt in den Synagogenverbänden ihre Religion auch ausüben konnten, an einen römischen Bürger aus einer freien Stadt wie Tarsus, die sich dazu unter römischer Oberhoheit befand, konnten sie nicht so einfach herankommen. Lukas berichtet hier nicht vollständig, und es ist gut, dass wir von Paulus in 2Korinther 11,32 ergänzende und dazu noch geschichtlich wichtige Aussagen haben, dank derer wir die Flucht aus Damaskus zeitlich ziemlich genau einordnen können.
Damaskus wurde zwar schon 64 v. Chr. der römischen Provinz Syrien einverleibt, aber unter der Herrschaft Caligulas (37-41 n. Chr.) kam Damaskus für kurze Zeit unter die Oberhoheit des Nabatäerkönigs Aretas IV., der von 9 v. Chr. bis 39 n. Chr. regierte. Aretas ließ die Stadt Damaskus durch einen Statthalter, wörtlich: `έτναρχ – Volksfürst` (2Kor 11,32) verwalten.
2.5. Des Paulus erneuter Aufenthalt in Damaskus und Flucht
Paulus folgte lebenslang dem Grundsatz, Missionsgebiete, in denen er das Evangelium verkündigte, immer wieder aufzusuchen und die dort gewonnenen Gläubigen zu stärken. Vorerst zog es ihn nicht nach Jerusalem, sondern zurück nach Damaskus, wo er sich zum Herrn bekehrt hatte und wo er so herzliche Aufnahme bei den Jüngern gefunden hatte, dorthin, wo er seine ersten Schritte im Glauben machen konnte.

Abbildung 12: Ein Teil der alten Stadtmauer von Damaskus, an der die frühere Bau- und Wohnweise erkennbar ist. Die Eingänge zu den Häusern und Wohnungen in der Stadtmauer sind nur von innen möglich, doch solch eine Fensteröffnung nach draußen ist eine ideale Möglichkeit, um in einem Tragekorb an einem Seil die Flucht unauffällig möglich zu machen (Foto: 11. April 2011).
In Damaskus gab es eine funktionierende Gemeinde; es gab viele Juden und mehrere Synagogen. Die Stadt war ein Knotenpunkt für den ost-west und süd-nord Handel, eine Karawanenstadt am östlichen Rand des riesigen römischen Reiches.
Wenn Paulus noch später auf seinen Missionsreisen immer wieder sein Handwerk als Zeltmacher nutzte, um für sich und oft auch für seine Mitarbeiter das tägliche Brot zu verdienen (Apg 20,33) dann wird er auch sicherlich hier in Damaskus gearbeitet haben; die Stadt war auch für ihre Webereien bekannt.
An den Sabbaten wurde jede Gelegenheit genutzt, um das Evangelium zu predigen. Noch predigte Saulus den Juden oder auch den Proselyten, von denen es in Damaskus viele gab. Proselyten waren Heiden, die durch Beschneidung und Taufe in die jüdische . Gemeinschaft aufgenommen wurden. Er muss Erfolg gehabt haben, so dass sich schon bald wieder eine starke Opposition von Seiten der Juden gegen ihn formierte.
Im Text der Apostelgeschichte 9,23 lesen wir: „als sich aber viele Tage erfüllten, beschlossen die Juden ihn umzubringen“. Diese unbestimmte Zeitangabe lässt nicht nur auf Wochen, sondern auch auf einige Monate der Wirksamkeit des Apostels schließen.
Eindeutig geht der Beschluss, Saulus umzubringen, auf die Juden zurück (Apg 9,23b). Aber so viele Juden es auch in Damaskus gab, und so selbständig sie in einer für sie fremden Stadt in den Synagogenverbänden ihre Religion auch ausüben konnten, an einen römischen Bürger aus einer freien Stadt wie Tarsus, die sich dazu unter römischer Oberhoheit befand, konnten sie nicht so einfach herankommen. Lukas berichtet hier nicht vollständig, und es ist gut, dass wir von Paulus in 2Korinther 11,32 ergänzende und dazu noch geschichtlich wichtige Aussagen haben, dank derer wir die Flucht aus Damaskus zeitlich ziemlich genau einordnen können.
Damaskus wurde zwar schon 64 v. Chr. der römischen Provinz Syrien einverleibt, aber unter der Herrschaft Caligulas (37-41 n. Chr.) kam Damaskus für kurze Zeit unter die Oberhoheit des Nabatäerkönigs Aretas IV., der von 9 v. Chr. bis 39 n. Chr. regierte. Aretas ließ die Stadt Damaskus durch einen Statthalter, wörtlich: `ετναρχ – Volksfürst` (2Kor 11,32) verwalten.
Da Caligula seine Herrschaft in Rom im Frühjahr 37 n. Chr. antrat und Aretas’ Herrschaft 39 n. Chr. endete, bleiben für die kurze Verwaltung der Stadt Damaskus durch den Nabatäerkönig nur zwei Jahre übrig. Für die Flucht aus Damaskus scheint mir das Jahr 37 deswegen naheliegend zu sein, weil nicht selten mit dem Kaiserwechsel in Rom auch Herrschaftsveränderungen in den Provinzen einhergingen. Auch die Juden konnten solch einen Machtwechsel für ihre eigenen Interessen nutzen, wie der Vergleich von Apostelgeschichte 18,12 mit 25,1-2 zeigt – Paulus vor Gallio in Korinth, Paulus vor Festus in Cäsarea. Als römischer Bürger stand Saulus bis zu solch einem Macht- und Verwaltungswechsel unter römischem Schutz. Dies änderte sich jedoch schnell zugunsten der dort ansässigen Juden, die in dem arabischen Fürsten plötzlich einen Verbündeten fanden. Jedoch konnte solch eine Großrazzia nicht geheim ablaufen, weil es auch viel gläubige Juden gab, die in verschiedenen Kreisen der Stadt tätig waren und wahrscheinlich Saulus warnten, die Stadt Damaskus nicht durch die Tore zu verlassen.

Abbildung 13 Ob der Korb, in dem Saulus hinabgelassen wurde, so ausgesehen hatte? Dieses Exemplar ist in der Paulus-Kirche in Damaskus ausgestellt (Foto P. Schüle 11. April 2011).
An Einfallsreichtum fehlte es den Jüngern nicht und vielleicht erinnerten sie sich an die zwei Kundschafter, die Jericho auf eine ungewöhnliche Art und Weise verlassen hatten (Jos 2,15). Nur wurde es dem Saulus etwas bequemer gemacht: er wurde in einem Korb an der Außenmauer durch eine Fensteröffnung (Pförtchen) hinabgelassen (Apg 9,25). Auf diese Weise entkam er den Juden und dem Statthalter.
Am hellen Tag, jedoch blind, hatte er zum ersten Mal Damaskus betreten; in dunkler Nacht, aber mit dem hellsten Licht im Herzen, verließ er diese Stadt. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass er die Stadt seiner Bekehrung anschließend noch einmal besucht hätte. Doch auf diese Weise ging Damaskus in die Geschichte und das Bewusstsein der christlichen Gemeinde ein.
.
Veröffentlicht unter Vom Traditionalisten zum Evangelisten
Schreib einen Kommentar
Kapitel 1: Tarsus – Jerusalem
1.1. Familie und Kindheit in Tarsus

Abbildung 2: Eine römische Strasse in Tarsus etwa 3 Meter unter dem heutigen Stadtniveau. (Foto: P. Schüle 15. April 2011).
Schon seine Großeltern und Eltern dienten Gott: „Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen“ (2Tim 1,3a). Seine Familie konnte sich rühmen zu der strengen jüdischen Gruppe der Pharisäer zu gehören. Bei seinem letzten Besuch in Jerusalem stellt er sich dem Hohen Ratvor: „Ihr Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern (Apg 23,6a). Die Pharisäer waren im Judentum eine politische und religiöse Partei. Ihre Anfänge gehen auf die Vor-Makkabäerzeit zurück. Pharisäer bedeutet: `die Abgesonderten`. Sie waren die strengste Sekte im Judentum (Apg 26,5). Sie glaubten an Engel, an Geister und an die Auferstehung der Toten. Im Gegensatz zu den Sadduzäern überlebten sie das Ende des jüdischen Staates 70 n. Chr. und sind heute in den Gruppen des orthodoxen Judentums vertreten.
Mit der Geburt erbte Paulus auch das römische Bürgerrecht, welches seine Eltern wahrscheinlich als angesehene Bürger der Stadt verliehen bekamen. Als er später von dem römischen Hauptmann in Jerusalem gefragt wurde: „Sage mir, bist du ein Römer? Er aber sprach: Ja. Und der Oberste antwortete: Ich habe für eine große Summe dieses Bürgerrecht erworben. Paulus sprach: Ich aber bin sogar darin geboren“ (Apg 22,27-28). Nach väterlicher Überlieferung (1Mose 17,12) wurde er am achten Tag beschnitten (Phil 3,5). Paulus konnte sich nicht nur der Zugehörigkeit zum Volk Israel rühmen, sondern auch seine Abstammung auf den Erzvater Benjamin den jüngsten Sohn von Jakob zurückführen (Phil 3,5). Mit der Namensgebung Saul (der Erbetene, der Geliehene) verbanden seine Eltern möglicherweise ihre Wünsche und Hoffnungen. Bei Juden der Diaspora war es üblich, dass sie zwei Namen führten, einen für das bürgerliche Leben und den anderen für den internen synagogalen Gebrauch. So bekam das Kind Saul noch den römischen Namen ´Paulus´, was soviel wie der Geringe, der Kleine bedeutet.
Aus der kurzen Notiz über sich selbst und seine Vorfahren kann man auch auf eine gesetzesgemäße Erziehung schließen (2Tim 1,3). Von klein an lernten die Kinder das sogenannte `Sch`ma` Israel – Höre, Israel (5Mose 6,4-9) und das Hallil – das Lob (Psalm 113-118). Mit fünf Jahren lernten sie das Gesetz lesen und mit sechs Jahren besuchten sie die Gesetzesschule, in der sie das Gesetz und den Talmud (die Sammlung der Traditionen – Satzungen der Ältesten) erlernten. Mit zehn Jahren lernten Kinder die `Mischna` (das mündliche Gesetz) und mit zwölf bzw. dreizehn Jahren bekamen sie persönliche Verantwortung für das Einhalten des Gesetzes und durften mit den Männern in der Synagoge sitzen. Mit fünfzehn Jahren erhielten sie Unterricht im jüdischen Recht. Dieser Schwerpunkt in der Ausbildung ist auf die Anordnung Gottes zurückzuführen, welche dem Mose gegeben wurde: „Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore4 schreiben“ (5Mose 6,6-9). Doch auch schon Abraham wurde von Gott mit einem bestimmten Schulungsprogramm für seine Nachkommen beauftragt. So lesen wir in 1Mose 18,19: „Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des HERRN bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der HERR auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat.“
Wie früher üblich, lernte der Sohn den Beruf des Vaters. Nach Apostelgeschichte 18,3 übte Paulus den Beruf als Zeltmachers aus. „Ein besonderes Tuch, das Cilicium aus Ziegenhaar, das hervorragend vor Kälte und Nässe schützte, wurde in Tarsus hergestellt. Möglicherweise diente es als Stoff für Zelte. Der Zeltmacher (gr. σκηνοποιός) webte seine Planen aus Ziegenhaar; gelegentlich wurde auch Leder verarbeitet. Gebraucht wurden diese Arbeiten für verschiedene Gelegenheiten. Die Antike war weitgehend eine Zelt-Gesellschaft. Es gab Prunk- und Trauerzelte, die mehr als vierhundert Festgäste fassen konnten. Zelte wurden aufgeschlagen, um die Besucher religiöser Feiern unterzubringen und in Zelten wurden Gefallene aufgebahrt. Auch auf Wagen hatte man oft zeltartige Aufbauten, ebenso wurden Schiffe damit ausgerüstet (Hildebrand: 1989, 64). Obwohl diese Berufsbezeichnung im Neuen Testament nur an dieser Stelle vorkommt, wurde dieses Handwerk zu jener Zeit häufig ausgeübt.
Paulus hatte noch mindestens eine Schwester, die in Apostelgeschichte 23,16 erwähnt wird. Sie wohnte später in Jerusalem, war verheiratet und hatte einen Sohn (Apg 23,16). Nur zweimal gebraucht Paulus den Begriff `meine Mutter` (Röm 16,13; Gal 1,15), es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es in Römer 16,13 um seine leibliche Mutter geht. In Römer 16,7 und 16,21b nennt uns Paulus einige Personen, die er als seine Stammverwandten bezeichnet. Über seinen Vater erfahren wir jedoch gar nichts.
Für die Eltern war es nicht leicht, ihren Sohn vor den verschiedenen Einflüssen einer heidnischen Stadt zu schützen. Wegen des bedeutenden Hafens trafen sich dort Kaufleute aus Ost und West, Süd und Nord, welche die Stadt nicht nur mit verschiedenen Waren auffüllten, sondern auch zum moralischen Zerfall beitrugen. Tarsus war eine durch und durch heidnische Stadt, in der der Polytheismus mit allen seinen Abarten und sittenlosen Auswüchsen blühte.

Bei gutem und schönen Wetter mochte das Reisen auf Schiffen recht angenehm gewesen sein (Foto: P. Schüle 15. April 2011).
Die Begabung des jungen Paulus, die Wünsche und Hoffnungen der Eltern, sowie die Gefahren der heidnischen Umwelt könnten Gründe dafür gewesen sein, dass er Tarsus wahrscheinlich schon als Jugendlicher verließ. In Begleitung seines Vaters oder anderer Vertrauenspersonen, die nach Jerusalem zu einem der Feste reisten, besstieg Paulus ein Schiff, welches ihn nach Cäsarea brachte.
Je nach Windverhältnissen und Zwischenstopps entlang der phönizischen Küste konnte diese mindestens 500 km lange Schiffsreise etwa 7-10 Tage gedauert haben. Dann ging es zu Fuß hinauf in das etwa hundert Kilometer entfernte Jerusalem.
1.2. Ausbildung zu den Füßen Gamaliels in Jerusalem
In Jerusalem wohnte Paulus entweder bei Verwandten oder bei Freunden. Die Stadt mit ihrer langen Geschichte und dem Tempel als Mittelpunkt des jüdischen Gottesdienstes machte auf ihn einen tiefen Eindruck. Im Dunkel des Allerheiligsten wohnte Jahwe, im Vorhof des Tempels verrichteten die Priester ihren Opferdienst.

Abbildung 6: Die Stadt Jerusalem vom Ölberg aus gesehen. Zwischen dem Ölberg und dem Tempelgelände erstreckt sich das Kidrontal von Nord nach Süd. Im nordwestlichen Bereich des Tempelgeländes stadt zur Zeit des Paulus der herodianische Tempel mit dem Eingang nach Osten ausgerichtet (Foto: R. Luft Juli 1994).
Hier war der höchste Repräsentant des jüdischen Volkes, der Hohepriester, Zu dieser Zeit bekleidete dieses höchste Amt Kaiphas (18-36 n. Chr.). Hier in Jerusalem waren die besten Gesetzeslehrer und die höchsten geistlichen Autoritäten anzutreffen. Paulus muss bei seiner Ankunft in Jerusalem noch relativ jung gewesen sein, denn später in seiner Verteidigungsrede vor dem König Agrippa vermerkt er, dass die Juden ihn seit seiner Jugendzeit kannten (Apg 26,4). Und auch noch zur Zeit der Steinigung des Stefanus (etwa im Jahr 34 n. Chr.), wird Paulus als ein Junger Mann (νεανίος – neanios) bezeichnet (Apg 7,58). In der Apostelgeschichte 22,3 sagt Paulus über sich selbst: „Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, in Zilizien; aber auferzogen (großgezogen worden) in dieser Stadt, zu den Füßen Gamaliels unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes (Apg 22,3). Für Erziehung steht der gr. Begriff ´ανατεθραμμένος – anatethrammenos´, den Lukas auch für Jesus gebraucht (Lk 4,16). Dies ist auch ein Hinweiss, dass er schon in jungen Jahren nach Jerusalem kam. Die Ausbildung zu den Füßen Gamaliels wird mit dem gr. Begriff ´πεπαιδευμένος – pepaideumenos´ beschrieben. Mit dem gleichen Begriff wird die umfassende Ausbildung Moses in Ägypten beschrieben (Apg 7,22). Die Ausbildung, welche Paulus genoß, geschah in der Genauigkeit des Gesetzes und der Überlieferungen der Väter. Sein theologischer Rabbi Gamaliel (der Name bedeutet ´Gott hat Gutes getan´), war Pharisäer und Schriftgelehrter. Er gehörte ebenfalls dem Hohen Rat (Synedrium) der Juden an. Er war einer der bedeutendsten jüdischen Theologen seiner Zeit und genoß hohes Ansehen. Gamaliel gehörte dem gemäßigten theologischen Flügel der Pharisäer an (Apg 5,34-40), den sein Großvater Hillel begründet hatte. Wer also bei diesem Mann seine theologische Ausbildung gemacht hatte, konnte mit einer guten Karriere im Judentum und hohem Ansehen rechnen. Er starb ca. 50 n. Chr., denn als Paulus sich auf ihn in seiner Verteidigungsrede beruft (ca. 58/59) lebte er nicht mehr.
Die Erziehung in Jerusalem konnte durchaus auch das Erlernen (oder die Fortsetzung der Ausbildung) des Berufes als Zeltmacher mit eingeschlossen haben. Im Unterricht bei Gamaliel musste Paulus es lernen, den genauen Sinn von Gesetzesstellen festzustellen und dazu jüdische Traditionen heranzuziehen; er musste genau angeben, was der Text verlangt, um die Forderung des Gesetzes zu erfüllen. Die Methoden im Unterricht waren Dialog und Disputation. Gamaliel legte Wert auf große Gewandtheit im Umgang mit der Schrift. Bei praktischen Fragen mussten die in Frage kommenden Schriftstellen zitiert werden.
So wuchs Paulus in Jerusalem zu einem bedeutenden Schriftgelehrten mit tadelloser Lebensführung heran (Phil 3,6b: „der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden“). Um so einen Mann hätte sich wohl jede Synagoge in der Diaspora bemüht.
Aus fehlenden Hinweisen über persönliche Begegnungen mit Jesus und seinen Jüngern können wir schließen, dass Paulus Jerusalem nach seiner Ausbildung wieder verlassen hat. Es liegt nahe, dass er nach Tarsus zurückkehrte, denn den Kontakt zu seiner Heimatstadt hat er nicht abgebrochen. Auch später wird Paulus nach Tarsus geschickt (Apg 9,30). Schließlich besaß er das Bürgerrecht jener Stadt (Apg 21,39) und konnte dort sowohl als Schriftgelehrter in der Synagoge als auch als Zeltmacher arbeiten und seinen Lebensunterhalt verdienen.
Der Hinweis des Paulus in 2Korinther 5,16 „… wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so“ ist keine direkte Aussage, dass er Jesus noch zu dessen Lebzeiten gesehen hat (die Wir-Form benutzt er auch an anderen Stellen, ohne jedoch sich persönlich miteinzuschließen). Nach dem Damaskusaufenthalt reiste Paulus nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen (Gal 1,18), somit kannte er diesen und damit wohl auch Jesus vorher nicht. Wäre Paulus zum Zeitpunkt der Auferstehung und Pfingsten in Jerusalem gewesen, hätte er, wie viele Tausende andere, Petrus kennengelernt. Sicher haben die Ereignisse des Pfingstfestes auch Tarsus erreicht (Apg 2,5-11). So ist es möglich, dass Paulus von sich aus nach Jerusalem zurückkehrte oder sogar gerufen wurde.
Es gibt keinen Hinweis darüber, dass Paulus verheiratet war. Die Empfehlungen in 1Korinther 7 müssen nicht zwingend aus eigenem Erleben und Erfahrung stammen. Die Aussage in 1Korinther 9,5 „Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas“,
betont eher den freiwilligen Verzicht auf die Ehe.
I.3. Paulus macht Karriere in Jerusalem
Nach Pfingsten (33 n. Chr.) breitete sich das Evangelium so schnell aus, dass schon nach kurzer Zeit die Zahl der Gläubigen in Jerusalem in die Tausende ging (Apg 2,41; 4,4; 5,14). Das Ansehen der Gemeinde bei dem Volk wuchs (Apg 5,13b). Diese Entwicklung forderte die jüdische Führung zum Handeln heraus. Kaiphas, mit dem eigentlichen Namen Josef, im Amt von 18-36 n. Chr., der uns schon aus den Evangelien (Joh 18) und Apostelgeschichte (4,5-6) als Hoherpriester bekannt ist, führt den Hohen Rat an. Im Text wird betont, dass sie mit Eifersucht erfüllt wurden. Diesmal werden alle Apostel ins Gefängnis geworfen (Apg 5,17-18). Der Versuch, die Apostel zum Schweigen zu bringen, misslingt jedoch (Apg 5,19-20). Ihre Unerschrockenheit vor dem Hohen Rat (Apg 5,29) und das Wirken des Heiligen Geistes bewirken Glauben in vielen Priestern (Apg 6,7b). Eben in diese Situation kommt Saulus hinein. Als Schriftgelehrter und Pharisäer war für ihn die Besonderheit der Lehre von der Auferstehung nichts Ungewöhnliches, aber die Behauptung der Anhänger des Nazoräers, der von den Juden und Heiden ans Holz gehängte Jesus sei der Messias, konnte er von der Schrift her nicht begreifen, denn im Gesetz steht geschrieben (5Mose 21,23): „ein Gehängter ist ein Fluch Gottes.“ Somit konnte dieser Jesus unmöglich der von Gott Gesalbte sein.
Wir müssen festhalten, dass man allein durch Bibelwissen Jesus als den Messias nicht erkennen kann. Dazu bedarf es einer Offenbarung Gottes (Mt 16,16-17): „denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist.,“ sagte Jesus dem Petrus. Auch in Lukas 24,44-45 lesen wir: „dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden.“
So fing Saulus als Eiferer für Gott (Apg 22,3c) mit aller Macht seiner Schriftkenntnis an, die für das Judentum so gefährliche Lehre zu bekämpfen (Apg 22,4a). In Jerusalem gab es viele Synagogen (Apg 24,12), unter denen eine sich besonders hervor tat. Dies war die Synagoge der Libertiner, Kyrenäer, Alexandriner und derer aus Zilizien und Asien (Apg 6,9), also eine gemischte Synagogengemeinde, in der wahrscheinlich unter anderem auch Griechisch gesprochen wurde. Ludwig Schneller nimmt an, dass sich Paulus bei seiner Rückkehr nach Jerusalem dieser Synagoge angeschlossen hat, wo er auch Landsleute aus der Provinz Kilikien traf (Schneller: 1926, S. 22).
Auch Stefanus mag dieser Synagoge angehört haben, bevor er sich der neuen Bewegung anschloss. Das Streitgespräch, welches Stefanus mit den Leuten aus dieser Synagoge führte, löste bei ihnen nicht Einsicht, sondern Eifersucht aus. Sie bestellten falsche Zeugen, hetzten das Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und führten Stefanus vor den Hohen Rat. Es entsteht der Eindruck, dass der Prozess gegen Stefanus am Anfang mit unrechten Mitteln wie falschen Zeugen geführt wurde. Dann wurde dem Prozess der Schein einer Rechtmäßigkeit gegeben, indem Stefanus vor den Hohen Rat gestellt wurde und sich verteidigen konnte. Schließlich endet der Prozess, ohne einen ordentlichen Urteilsspruch, durch Lynchjustiz.
Obwohl Saulus erst während der Steinigung des Stefanus erwähnt wird, ist es wahrscheinlich, dass er schon bei den Streitgesprächen und dem Prozess dabei war. Es wäre höchst ungewöhnlich, wenn er erst draußen vor den Toren Jerusalems zu der Menge hinzugekommen wäre, um dann eine nicht unbedeutende Aufgabe zu erfüllen (Apg 7,58b; 22,20). Lukas schreibt in Apostelgeschichte 8,1a: „Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein“, und in Apostelgeschichte 22,20 sagt Paulus von sich selbst: „Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte mit ein und verwahrte die Kleider derer, die ihn umbrachten.“ Für Saulus war ein Lästerer mehr aus dem Volke Gottes entfernt worden. Er hatte entweder die Ehre, die Kleider der Zeugen zu bewachen oder er hat damit eine Art Aufsichtsaufgabe erfüllt. Nach Deuteronomium 17,7 mussten die Zeugen als erste Steine auf den Verurteilten werfen.
Etwa drei bis vier Jahre später erwähnt Paulus den Vorfall mit Stefanus im Gebet im Tempel (Apg 22,20). Aus seinen Worten klingt Mitschuld durch. Seine Aussage in Apostelgeschichte 26,10: „und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu“, drückt Mitverantwortung aus. Sofern Saulus Stimmrecht gehabt hatte und dem Hohen Rat angehörte, dann nur als Schriftgelehrter (Schneller: 1926, S. 22).. Der Hohe Rat hatte drei Gruppen von Mitgliedern: Priester, Älteste und Schriftgelehrte. Den beiden ersten Gruppen konnte Saulus als Benjaminit und als junger Mann (unter dreißig Jahren, unverheiratet) nicht angehört haben.
Stefanus wurde von gottesfürchtigen Männern bestattet (Apg 8,2). Es waren Jünger, die furchtlos Gott ehrten, indem sie den Bestattungsdienst an Stefanus vollbrachten, ähnlich wie es Josef und Nikodemus an Jesus taten (Joh 19,38-40).
Am gleichen Tag entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem (Apg 8,1b), bei der Saulus eine entscheidende Rolle einnahm. In Apostelgeschichte 8,3 schreibt Lukas: „Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging; und er schleppte sowohl Männer als Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis.“ Saulus war natürlich nicht allein (Apg 26,10b); er wurde von den Oberpriestern mit Vollmachten ausgestattet, denn sie erkannten in ihm nicht nur seine geistigen Qualitäten als Schriftkenner, sondern auch – und dies war für sie besonders wichtig – seinen unbeugsamen Willen und die Entschlossenheit, die neue Bewegung zu zerstören (Apg 8,3a; 9,21b).
Die Römer räumten den unterjochten Völkern ein großes Maß an Autonomie ein. In Sachen Religion und Gerichtsbarkeit mischten sie sich bei den Juden nicht ein. Nur die Todesstrafe durften Juden nicht ohne Urteil des Statthalters vollstrecken (Joh 18,31). Die Vollmachten des Saulus waren umfangreich.
- Mit seinen Helfern drang er in Häuser ein (Apg 8,b), schleppte Männer und Frauen fort
- und ließ sie zunächst in den Synagogen schlagen und geißeln (Apg 22,19b).
- Er zwang sie zur Lästerung (wohl zum Widerruf)
- und dann überlieferte er sie in die Gefängnisse (Apg 8,3c).
Der Platz reichte bald in einem Gefängnis nicht mehr aus (Apg 26,10a; 22,4b). Dabei nahm Saulus keine Rücksicht auf das Geschlecht, auch Frauen wurden misshandelt (Apg 22,4b; 8,3b). Saulus ging gründlich ans Werk, die Hausgemeinden wurden systematisch zerstört (Apg 8,3). Diejenigen, die den Mut hatten, zu bleiben oder nicht schnell genug fliehen konnten, landeten in Gefängnissen; einige wurden getötet (Apg 9,1a; 26,10c). Entweder geschah dies durch Lynchjustiz oder es gab ein Abkommen mit Pilatus. Mindestens jedoch hat Pilatus die jüdischen Eiferer gewähren lassen. Hat er schon Jesus gegen besseres Wissen verurteilen lassen, so zeigte sich wohl auch hier seine Charakterschwäche.
Die meisten Gläubigen zerstreuten sich in die Landschaften Judäas und Samariens (Apg 8,1c) und predigten dort das Wort (Apg 8,4a). Einige gingen weiter bis Phönizien, Zypern und Antiochien (Apg 11,19). Die Aussage in Apostelgeschichte 8,1b „alle wurden zerstreut“, ist nicht in der summarischen Vollzahl zu verstehen, sondern als Hyperbel, wie z.B. auch in Markus 1,33: „und die ganze Stadt war an der Tür versammelt.“ Die Gläubigen taten das, was Jesus für die Verfolgungszeiten geboten hatte (Mt 10,23): „Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere.“ Durch Verfolgung wurde die Ausbreitung des Evangeliums keineswegs aufgehalten, sondern eher noch mehr gefördert. Die Verfolgungsaktionen des Saulus beschränkten sich nicht nur auf die Stadt Jerusalem (Apg 26,11b). An dieser Stelle sind die Städte im Plural genannt, außerhalb von Jerusalem. Schon bei dieser ersten großen Verfolgungswelle um ca. 33/34 n. Chr. erfüllten sich Jesu Worte bis in die Details. In Matthäus 10,17 sagte Jesus voraus: „Hütet euch aber vor den Menschen; denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln.“ In Lukas 21,12 sagte Jesus: „Vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen um meines Namens willen.“
Es ist durchaus möglich, dass sich in jenen Tagen die Voraussage in Lukas 21,16a über Verrat von Familienangehörigen und Freunden ebenfalls erfüllten. In Lukas 21,16b fährt Jesus fort: „Und sie werden einige von euch töten.“ Die erste Gemeinde war auf die Verfolgung vorbereitet und verhielt sich richtig. Sie erinnerte sich an Jesu Worte aus Johannes 16,1-4: „Es kommt sogar die Stunde, daß jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Opferdienst darzubringen.“
Saulus machte Fortschritte im Judentum, mehr als viele Altersgenossen in seinem Volk. In besonders hohem Maß war er ein Eiferer für die väterlichen Überlieferungen (Gal 1,14). Mit seinem Verfolgungseifer meinte er in der Tat, Gott zu dienen. Aber er hatte aus Unwissenheit und im Unglauben gehandelt (1Tim 1,13), und später bezeugt er, ihm sei als dem „ersten“ Sünder Erbarmen und Gnade widerfahren, damit an ihm die ganze Langmut Christi offenbar werde (1Tim 1,14-16).
Vorbildlich, echt, ohne Übertreibung und an den richtigen Stellen legt Paulus seine Vergangenheit offen dar. Er ordnet sie in seinen Lebensplan ein und ist uns damit ein Vorbild, wie man mit den dunklen Seiten des Lebens umgehen kann.
Veröffentlicht unter Vom Traditionalisten zum Evangelisten
Schreib einen Kommentar
5. Kapitel: Jesu Wirken in Galiläa
Kapitel 5: Jesu Wirken in Galiläa
5.1 Heilung des Sohnes des königlichen Beamten von Kapernaum
(Joh 4,43-54)
Zur zeitlichen Einordnung dieses Zeichen-Wunders. Nach dem Passahfest in Jerusalem hält sich Jesus noch eine Zeitlang in Judäa auf, bevor er durch Samarien wieder zurück nach Galiläa wandert. In Joh 4,35 weist Jesus auf die reifen Felder[106], will aber eigentlich auf die reife geistliche Ernte unter den Samaritern hinweisen. Wollte Jesus mit dem Hinweis: „Sagt ihr nicht: Es sind noch vier Monate, und die Ernte kommt“? auf den Abschluss der Jahresernte Ende September /Anfang Oktober (Laubhüttenfest) hinweisen? Dann wäre es in der Zeit um die Mitte Juni des Jahres 30.
Jesus geht nach Galiläa, da er weiß, dass er im eigenen Vaterland (hier meint er wohl Judäa mit Jerusalem, vgl. auch Joh. 1,11) keine Ehre hat. Im Gegensatz dazu nehmen ihn die Galiläer gerne auf. Die Wunder während des Festes in Jerusalem (Joh 4,45) beeindrucken sie.
5.1.1 Die Notsituation
Ausgangspunkt dieses Berichtes ist ein leidender, gequälter Mensch! Jesus und der Notleidende – darauf konzentrieren sich in den Evangelien die Geschichten von Heilungen. Hier ist es wahrscheinlich ein Hofbeamter von Herodes Antipas. Aus Joh 4,48 wird deutlich, dass er zusammen mit den Schaulustigen Jesus anspricht. Ob es der einzige Sohn ist, ob er jung oder alt ist, ja sogar an welcher Krankheit er leidet spielt in der Geschichte keine Rolle. Er war krank und litt an einem hohen Fieber. Es bestand Gefahr. Man sah das Ende schon kommen.
Warum werden Menschen krank, verunglücken, gehen viel zu früh von uns? Paulus bittet viel später um Heilung eines uns unbekannten körperlichen Leidens drei Mal. Er bekam die Antwort:
Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2Kor 12,9
Auch der Theologe Paulus fand keine andere Antwort. Alle scheinbare Seelsorge, die verborgene Sünden als Grund für Leid aufdecken will ist damit hinfällig – auch alle Selbstprüfungen und Selbstvorwürfe und besonders die selbstauferlegten Qualen.
5.1.2 Die Begegnung mit Jesus
Woher auch immer – dieser Mann hatte die entscheidende Info: … der neue Rabbi Jesus soll die Gabe der Krankenheilung haben! Doch der Beamte wohnt in Kapernaum und Jesus ist in Kana. Dort ist Jesus bei den Menschen, erreichbar, nahe – einer der zu Fuß im Dorf unterwegs ist, den man ohne Scheu ansprechen darf.
Was jetzt folgt ist Gottes Programm: Hilfe kommt nicht gönnerhaft von oben her – sondern als Hilfe von unten her. Inkarnation = Fleischwerdung nennt man dies in der theologischen Fachsprache. Gott als der Souverän dieser Welt will von unten her den Menschen begegnen. Darin wird Gottes ds,x chesed Gnade deutlich. Das hebräische Wort, am besten übersetzt mit dem alten deutschen Wort Huld (engl.: lovingkindness). Gott will liebevolle, freundliche Gemeinschaft. Gott sieht sich selbst weniger als ein Richter, der mal ein gnädiges Urteil fällt, sondern als ein Vater der von Anfang an und dann immer wieder die Gemeinschaft will. GOTTES Gemeinschaftssinn ist der Grund, dass er für uns ist – trotz Leid, Not und Krankheit. Ja Gott ist für uns mit oder ohne Heilung! Auch wenn uns das eine viel lieber ist, als das andere!
Typisch Jesus: Er wird vom königlichen Beamten in seiner großen Sorge nicht im Palast, sondern mitten bei den Menschen – bei Ihrer Not angetroffen! Jesus wird also vom Beamten angesprochen, nachdem er von Kapernaum nach Kana geeilt war, um Jesus schnell zu seiner Familientragödie zu rufen! Wir wissen heute nicht genau wo Kana liegt. Der nächste Ort, der in Frage kommt ist wenigstens 20 km Luftlinie von Kapernaum entfernt – allerdings ist dies eine bergige Gegend. Rettungsdienste, Notärzte kennen dass, schnell, schnell kommen Sie zu unserer unendlichen Not! Jede Minute zählt so unendlich viel. Was wird der Vater gerannt sein!
Jesus hört die Bitte bei dieser Begegnung zwei Mal (einmal in indirekter Rede und einmal in direkter Rede): „Herr, komm herab, ehe mein Kind stirb!“ (Joh 4,49). Die Antwort von Jesus ist erst einmal seltsam… doch sie ist der eigentliche Schlüssel: „Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben (Joh 4,48). Ja, Jesus genau dass ist das Problem – wir wollen Zeichen und Wunder sehen! Hier und heute vor allen! Kann das Jesus? Ja! Doch wie ist mein Verhältnis zu Jesus, wenn ich heute nach Hause gehe und mein Leid wieder mitnehme. Dürfen wir in allem Nichtverstehen dann noch DANKE – sagen – auch wenn dann ein Gemeindeglied Jahrzehnte in unserer Mitte leidet?
Der Vater fasst sich nach diesem Hinweis von Jesus ein Herz und drückt all seinen Glauben in dieser wiederholten Bitte aus: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt!
5.1.3 Das Lösungswort
In Joh 4,50 finden wir die Worte von Jesus: „Geh hin, dein Sohn lebt!“ und dann weiter: „Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin.“ Typisch Jesus: Er legt keinen Wert auf Sensation und Reklame. Das wunderschaffende Wort zur Aufhebung dieser menschlicher Not ist im Griechischen und deutschen sogar sehr kurz nur vier Worte: „Geh, dein Sohn lebt!“ Dies ist die Antwort von Jesus auf die Notlage des Hilfesuchenden. Jesus spricht keine magischen Zaubersprüche – es sind ganz schlichte Worte. Jesus sagt nicht: dein Sohn wird irgendwann einmal in Ewigkeit leben… ER LEBT JETZT! Die Allmacht und das Allwissen von Jesus werden in dieser Situation sehr deutlich. Der Sohn wird wieder völlig gesund! Der Vater steht vor dem Rabbi Jesus. Er hat nur dessen Wort. Was soll er machen? Er glaubt und geht!
Auf dem Nachhauseweg wird der Vater die Szene immer wieder reflektieren: So anders ist dieser Jesus! So anders diese angebliche Heilung! Gar nicht wie ich mir das gedacht habe! Keine Berührung des Kranken, kein an die Handfassen, auch keine Medizin – doch der Vater glaubt ohne Beweis. Er glaubt und geht!
Hier kommt etwas in Spiel, was wir nie ganz zusammenbekommen. Während wir noch beten, bitten und Gott sagen, was er bei mir, in meiner Familie, in meiner Region oder in meinem Land noch alles ändern solle, handelt Gott. Die Familie in Kapernaum merkt, dass es dem Sohn rapide sehr viel besser geht. Doch in Kapernaum weiß keiner warum! Also werden Boten gesandt: „Holt den armen verzweifelten Vater von seiner verzweifelten Mission zurück! Alles hat sich „von allein“ gelöst. Wir brauchen keinen Arzt mehr – auch keinen JESUS. Alles ist von allein gut geworden. Klar so dachte die Familie in Kapernaum, weil sie nicht nach Kana schauen können. So treffen die Freuden-Boten und der besorgte glaubende Vater aufeinander: DEIN SOHN LEBT! Schnell wird der Zeitpunkt der Besserung ausgetauscht: ein Uhr nachmittags (die siebte Tagesstunde).
5.1.4 Die Wirkung
Der Vater und sein Haushalt (Frau, Kinder, Verwandte, Bedienstete!) glauben. Auch ihr Glauben musste wachsen. Wir sehen die Glaubensschritte hier recht deutlich:
- verzweifelter Glaube an irgendeinen Wunderheiler (Strohhalmglaube: Kann ja nicht schaden!)
- Glaube an das Wort von Jesus: Dein Sohn lebt
- Glaube an die Person Jesus mit der ganzen Familie
Jesus als Gottes Sohn – nichts ist ihm unmöglich! Wunder berichtet uns der Evangelist Johannes als Zeichen für die Gottessohnschaft von Jesus. Er lässt nie den Anschein entstehen, Jesus sei der professionelle Wundermann, der von sich aus Wunder tut, um die Leute in einer Art Show mit seinen Wunderkräften zu beeindrucken.
Die Heilungserzählung von damals möchte aber auch uns heute beteiligen! Im Echo des Wunders fragen wir uns: Wie handelt Jesus bei heutigem Leid, heutiger Not? Greift er ein? Spricht er das Lösungswort?
Wie wird Jesus mit deinem Leid verfahren? Darum wollen wir auch heute unsere Not zu ihm rufen – gemeinsam – dann soll er, Jesus, so handeln wie er entscheidet.
Wundergeschichten wie diese in den Evangelien machen uns als Nachfolger von Jesus deutlich: Wir können nicht so weiter leben, als seien Krankheit und Not, Gebundenheit und Tod die letzte Wirklichkeit unseres Lebens. Bei Jesus gibt es Befreiung aus unentrinnbarer Gefangenschaft!
Wollen wir uns so sehen: Wir sind in Kapernaum und rufen und beten … Jesus handelt in Kana… Doch wie, dass wissen wir nicht. Wir wollen auf Jesus unser Vertrauen setzen – auch wenn wir Tag für Tag die Not der Menschen sehen. Wir können und wollen uns entscheiden: Wir vertrauen Jesus!
Fragen:
- Wie können wir dazu beitragen, dass Jesus wieder zur Anlaufstelle in Krisen wird?
- Wie wollen wir die gute Nachricht von Gottes HULD heute praktisch Mitmenschen mitteilen?
- Wie sieht ein „inkarnatorischer“ Lebensstil heute aus?
- Glaube an die Heilung und Kraft zum Tragen einer Krankheit – wie verhalten sich diese beiden Haltungen zueinander?
- Heilungen geschehen ohne dass wir es ahnen – wie kann das unser Gebet verändern?
5.2 Das Gleichnis vom Sämann
(Mt 13,1-23; Mk 4,1-20; Lk 8,4-15 )
Man kann sich vorstellen, dass Jesus nach Kapernaum hinab geht. Nach den Evangelisten Matthäus und Markus erzählt Jesus im Rahmen seiner Lehrtätigkeit dieses Gleichnis am Ufer des Sees in der Nähe von Kapernaum (Mt. 13,1-2; Mk 4,1.35). Markus ergänzt, dass Jesus wegen der großen Volksmenge in ein Boot einsteigt und so vom Wasser aus die Menschen lehrt. Nach Abschluss der Gleichnissreden von Jesus sagt Matthäus, dass Jesus von dort weg geht (Mt. 13,53). Markus berichtet präzis: „Und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war: Lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen“ (Mk 4,35f). Lukas verbindet das Gleichnis nicht direkt mit dem Übersetzen von Jesus an das andere Ufer (Lk 8, 22). Wir folgen hier der Anordnung des Evangelisten Markus.
Wir finden das Gleichnis in allen drei synoptischen Evangelien. In allen Berichten erklärt Jesus (auf ausdrücklichen Wunsch seiner Jünger) die Bedeutung der Details des Gleichnisses. Alle drei Evangelisten ergänzen hier einander.
Die Zuhörer von Jesus, auch seine Jünger, sind mit den alltäglichen Details der Landwirtschaft hinreichend vertraut. Ein Gleichnis vom Säen eignet sich daher für diese Zuhörerschaft gut, um damit göttliche Wahrheiten zu verdeutlichen. Zwar verstanden alle die natürlichen Vorgänge, aber den tiefen Sinn und Wahrheitsgehalt des Gleichnisses verstanden nicht einmal seine Jünger.
In Palästina wird eine hundertfache Ernte als ein hervorragender Ertrag angesehen (1Mo 26,12): „Und Isaak säte in dem Lande und erntete in jenem Jahre hundertfältig; denn der HERR segnete ihn“. Dabei ist unter Umständen schon eine Ernte mit dreißigfachem Ergebnis als eine gute Ernte angesehen worden, verglichen mit den gänzlich fruchtlosen Jahren, in denen das Saatgut ohne jeglichen Ertrag verloren ging.
In der folgenden Tabelle sind die Gleichnistexte aller drei Evangelien zur besseren Übersicht parallel aufgelistet.
| Matthäus 13,3-9. 18-23 | Markus 4,3-9. 13-20 | Lukas 8,5-8. 11-15 |
| Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. |
Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg; da kamen die Vögel und fraßen’s auf.
Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es.
Einiges fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen empor und erstickten’s.
Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreißigfach.
Wer Ohren hat, der höre!
Hört zu! Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und es begab sich, indem er säte, dass einiges auf den Weg fiel; da kamen die Vögel und fraßen’s auf.
Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging alsbald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es.
Und einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten’s, und es brachte keine Frucht.
Und einiges fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges trug dreißigfach und einiges sechzigfach und einiges hundertfach.
Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre!Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen.
Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen’s auf.
Und einiges fiel auf den Fels; und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte.
Und einiges fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erstickten’s.
Und einiges fiel auf gutes Land; und es ging auf und trug hundertfach Frucht.
Als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre!So hört nun ihr dies Gleichnis von dem Sämann: Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist; das ist der, bei dem auf den Weg gesät ist.
Bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt; aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch; wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so fällt er gleich ab.
Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht.
Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt; und der eine trägt hundertfach, der andere sechzigfach, der dritte dreißigfach.
Und er sprach zu ihnen: Versteht ihr dies Gleichnis nicht, wie wollt ihr dann die andern alle verstehen? Der Sämann sät das Wort.
Das aber sind die auf dem Wege: wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Desgleichen auch die, bei denen auf felsigen Boden gesät ist: wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch; wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so fallen sie sogleich ab.
Und andere sind die, bei denen unter die Dornen gesät ist: die hören das Wort, und die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem andern dringen ein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht.
Diese aber sind’s, bei denen auf gutes Land gesät ist: die hören das Wort und nehmen’s an und bringen Frucht, einige dreißigfach und einige sechzigfach und einige hundertfach.Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort Gottes.
Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören; danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden.
Die aber auf dem Fels sind die: wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel; eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab.
Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht.
Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld.
Alle Evangelisten berichten über die verschiedenartigen Saatuntergründe in der gleichen Reihenfolge. Vom Textumfang her fasst sich Lukas am kürzesten. Während Matthäus beim guten Ackerboden mit dem hundertfachen Fruchtbringen beginnt, fängt Markus mit dreißigfachem an und Lukas hat nur das hundertfache Fruchtbringen festgehalten. Während bei Matthäus und Markus diese Staffelung in der gleichen Reihenfolge auch bei der Deutung des Gleichnisses wiederholt wird, unterstreicht Lukas lediglich das Fruchtbringen in Geduld.
Abbildung 12 Aus einem Weizenkorn entstehen dutzende Körner (Foto am 14. August 2016).
Wichtig und unbedingt notwendig ist also, dass überhaupt Frucht gebracht wird. Es gibt jedoch Unterschiede im Umfang und der Intensität des Fruchtbringens.
Wir fragen an dieser Stelle: Was sagen andere Bibelstellen der Schrift über das Fruchtbringen?
- Im Gleichnis vom Weinstock und den Reben spricht Jesus vom Fruchtbringen, von mehr Frucht bringen, von viel Frucht bringen, ebenso von Fruchtlosigkeit – letztlich jedoch, dass unsere Frucht eine bleibende Frucht sein soll (Joh 15,1-16).
- So wie der Umfang und die Qualität der Frucht von der Beschaffenheit des Bodens abhängt, so hängt auch das „Viel-Frucht-Bringen“ von der Aufnahmebereitschaft unseres Herzens und der Hingabe unseres Lebens an Gott ab (Mt 19,29): „Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird’s hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben“ (Vgl. auch Mk 10,30). Beim Säen, oder Investieren in das Reich Gottes, verspricht Jesus also hundertfaches Ergebnis, oder eine hundertfache Vermehrung.
- „Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen – wurde aber bisher gehindert -, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter andern Heiden“ (Röm 1,13). Durch die Verkündigung des Wortes Gottes, entsteht geistliche Frucht unter den Heiden in Form von Menschen, die für Gott gewonnen werden.
- „Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße“ (Mt 3,8). Der Mensch wird aufgefordert, das Wort Gottes tief und vertrauensvoll in sein Herz aufzunehmen. Dabei kann niemand sich auf seine Herkunft, gute Werke, fromme Leistungen oder auf eine äußerliche Zugehörigkeit zu einer christlichen Gemeinschaft stützen.
- „Lass aber auch die Unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie kein fruchtloses Leben führen“ (Tit 3,14). Die Gläubigen, in diesem Fall Mitarbeiter sind aufgerufen, sich keinesfalls ein ruhiges oder faules Leben zu leisten, sondern in allem den jüngeren Christen (auf Kreta) ein nachahmendes Vorbild zu sein.
- „So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen“ (Hebr 13,15). Kleine, oft unscheinbare Bekenntnisse zu Jesus (stilles Tischgebet in der Öffentlichkeit, oder, andere schlichte Bekenntnisse zu Christus) ehren Gott und werden von Gott als geistliche Frucht angesehen und bewertet.
- „Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird“ (Phil 4,17). Paulus freut sich über die finanzielle Unterstützung der Philipper (hat er ihnen doch das Evangelium verkündigt), doch in erster Linie lernen sie dabei ihre Einkommen und ihren Besitz zu teilen und dies sieht Gott als geistliche Frucht an.
- Warum kommt das Gleichnis vom Sämann in allen drei Evangelien vor?
- Warum erklärt Jesus dieses Gleichnis nur seinen Jüngern?
- Suche nach Informationen über die optimale Bodenvorreitungen vor der Saat. Erkläre den geistlichen Sinn, der durch die vier verschiedenen Saatuntergründe verdeutlicht wird?
- Was sagt das Gleichnis über den säenden Bauer und über das Saatgut aus?
- Erkennst du in deinem Leben geistliche Frucht?
5.3 Jesus stillt den Sturm auf dem See
(Mt 8,23-27; Mk 4,35-41; Lk 8,22-25)
Nach dem Ende seiner Gleichnisrede wünscht Jesus, dass seine Jünger eine Überfahrt zur anderen Seite des Sees Gennesaret organisieren (Mk 4,35). Lukas und Matthäus verbinden diese Überfahrt nicht mit den vorhergehenden Gleichnisreden. Daher orientieren wir uns in Bezug auf die Reihenfolge der Darstellung nach dem Bericht des Evangelisten Markus.
Die Jünger sind bereit mit Jesus weiter zu wandern – auch wenn die Kosten hoch sind. Im Gegensatz dazu werden im Matthäusevangelium im gleichen Kapitel kurz vorher zwei Jüngeraspiranten erwähnt, denen diese Kosten zu hoch sind. So findet sich bald die ganze Gruppe um Jesus auf mehreren Fischerbooten (Mk 4,36) unterwegs auf dem See – dem vertrauten Arbeitsplatz mancher Jünger. Die Bauweise dieser Boote ist heute recht genau nachvollziehbar, da ein ähnliches Boot am Seeufer ausgegraben wurde: 2000 Jahre alt, 8 Meter lang und mehr als 2 Meter breit.[107] Doch bald geraten alle Passagiere in ein plötzliches Unwetter. Der Evangelist Markus spricht von einem großen Wirbelsturm – Matthäus nennt es eine große seismo.j seismos Erschütterung auf dem See. Am nördlichen Ende des Jordantals liegt der See etwa 209-215m unter N.N. Er ist bis zu 21 km lang, 12 km breit und mit einem Umfang von ca. 53km (Tendenz abnehmend, da in den letzten Jahren mehr Wasser entnommen wurde, als zufloss – 50% des Wasserbedarfs Israels wird von hier gedeckt).
Die Berge an der Ostseite des Sees ragen relativ steil empor. Die kühlen Fallwinde vom Berg Hermon (2814 m) stoßen besonders heftig von Mai bis Juli auf die heiße Luft der Jordansenke, was den schnellen Wetterwechsel mit Sturmwind erklärt. Hinzu kommen die heftigen Winde die entstehen, weil kühlere Luftströme vom Mittelmeer das galiläische Gebirge überwinden und auf die über den See auf steigenden warmen Luftmassen stoßen. Für Boote ohne Kiel sind diese Stürme und die Wellen von bis zu 3 m Höhe eine Gefahr, da die Steuerung sehr schwierig ist und ein Kentern droht. Panik bei den Profis im Boot – doch Jesus schläft auf einem Kissen tief. Jesus hat viel gearbeitet und ist sehr müde. Als der Sturm sie in Lebensgefahr bringt, wecken die Jünger Jesus mit einem Gemisch aus Furcht und Glaube (wir können nicht mehr – kannst du Jesus?). Was die Wellen und der Wind nicht schaffen – die Jünger können es. Jesus wacht auf. Jesus spricht in dieser bedrohlichen Situation seltsamerweise die Jünger auf ihren Kleinglauben an. Woher können die Jünger denn wissen, dass es keinen Grund für eine Panik gibt? Doch mit Jesus im Boot und einem großen Auftrag – wer soll diese Passagiere aus der Hand Gottes reißen? Schließlich sind die Jünger als Apostel berufen und haben in der Zukunft noch viel im Reich Gottes zu tun – noch ist ihr Lebensende nicht da. NUR – wer im Boot weiß dies? Noch ist nichts unter Kontrolle. Doch Jesus steht auf und bedroht Wind und Wellen – und es entstand eine große Stille. Jesus hat Autorität – sogar über die Mächte der Natur. Was uns verwundert ist, dass auch der starke Wellengang sofort aufhört. Die Jünger realisieren: Jesus ist immer noch größer als sie denken können!
Fragen:
- Nenne Situationen, in denen du in Panik geraten bist?
- Was bedeutet das Schlafen von Jesus – damals… heute?
- Warum trifft uns der Vorwurf des Kleinglaubens heute noch stärker?
- Nenne Erlebnisse mit Jesus, in denen er dich positiv überraschte.
- Warum neigen wir immer wieder zu Kleinglauben?
5.4 Jesus heilt dämonisch Belastete im Bereich der Dekapolis
(Mt 8,28-34; Mk 5,1-20; Lk 8, 26-39)
Die unterschiedlichen geo- und topographischen Angaben der Evangelisten zu dieser Heilung lassen sich so zusammenfassen:[108]
- Gebiet der Gerasener (Mk 5,1)
- Galiläa gegenüber (Lk 8,26)
- Land der Gadarener (Mt 8,28)
- in der Nähe von Grabhöhlen (Mt 8,28; Mk 5,5; Lk 8,27).
- in der Nähe einer Stadt (Mt 8,34.39)
- in der Nähe einer Stadt und einigen Dörfern (Mk 5,14; Lk 8,34).
- im Bereich der Dekapolis (Mk 5,20).
Man kann vermuten, dass der Ort des Geschehens in der Nähe der Stadt El Kursi liegt.
Weitere Unterschiede in den Berichten:
- Nach dem Bericht des Evangelisten Matthäus begegneten ihnen nach dem Landgang zwei Besessene (Mt. 8,28). Die anderen beiden Evangelisten sprechen von einem Belasteten Menschen. Der Evangelist Matthäus hat hier wohl mehr Interesse an der genauen Anzahl, als die anderen beiden Evangelisten. Dies bestätigen seine weitere Berichte z. B. heilte Jesus zwei Blinde bei Jericho (Mt 20,30)
- Lukas berichtet, dass der Belastete von der Stadt kam (Lk 8,27). Die anderen Evangelisten berichten, wie er/sie von den Grabhöhlen kam/en.
- Matthäus bezeichnet die Belasteten als calepoi chalepoi hart, schwierig, bösartig oder gewalttätig. Sie belästigen Menschen auf der Straße. Markus nennt viele Details des ungewöhnlichen Verhaltens. Lukas nennt den Umstand, dass er kein Obergewand trug (i`ma,tion himation bezeichnet Kleidung allgemein, aber besonders das Obergewand).
Jesus und seine Reisegruppe gehen also bewusst in einer heidnischen Gegend an Land. Jesus weicht damit von seinem Dienstprogramm und seiner eigentlichen Zielgruppe den Verlorenen Kindern Israels zeitweise ab und wendet sich bewusst den Heiden zu. Als erstes trafen sie in jener Gegend auf belastete Menschen in einem jämmerlichen Zustand. Der Durcheinanderbringer raubte ihnen jegliche Menschenwürde und quälte sie weiter dadurch, dass sie auch andere in Not und Gefahr brachten. Wird der Fürst der Dunkelheit gerade sie als Empfangskomitee für den Fürsten des Lichts gesandt haben? Die Menschen werden vom Evangelisten Matthäus als Dämonenbesessene bezeichnet. Im weiteren Bericht wird deutlich, dass diese Menschen einen Kontrollverlust über ihr Denken, Sprechen und Verhalten erlitten haben. Wie zu erwarten werden diese kranken Menschen stigmatisiert und aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Man mied möglichst ihren bekannten Aufenthaltsort: die örtlichen Bestattungshöhlen. Doch genau in dieser bekannt unangenehmen Gegend hält sich Jesus mit seiner Gruppe wohl kaum aus Versehen auf.
Jesus wird aus dem Mund der jämmerlichen Menschen vom geistlich gesehenen Fürsten recht offensiv als Sohn Gottes angesprochen und somit als Feind der bestehenden geistlichen Machtverhältnisse erkannt. Auch wird deutlich, dass diese dunklen Mächte um ihre nur noch begrenzte Macht und Zeit wissen (siehe Eph 2,2; 6,12).
Die dunklen Mächte wissen um das Ende ihrer Zeit als Quälgeister und bitten Jesus um einen Aufenthaltsort in den ca. 2000 Schweinen (Mk 5,13), um diese zu quälen und zu vernichten – natürlich auch um ihren Besitzern großen Schaden zuzufügen. Sollten diese Besitzer so gegen Jesus aufgehetzt werden? Wir finden in den Texten keinen Hinweis darauf, warum Jesus dieser Bitte entspricht – also lassen wir diese Frage bewusst offen.
Doch eines wird klar – geheilte Menschen sind vielmehr wert, als sehr viele Schweine (Mensch oder Besitz). Selbst die wahrscheinlich etwas entfernt zu schauenden Schweinehirten stellen diese Verbindung sofort her: hier endlich Heilung von sehr schwierigen Zeitgenossen und dort der sehr große Verlust von Tieren. Ihr Bericht wird in den angrenzenden Ortschaften als vertrauenswürdig eingestuft und so kommen die geschädigten Bewohner und bitten erstaunlich milde Jesus nur die Region wieder zu verlassen. Es ist wohl die Macht des Aberglaubens, der durch diese Bitte hindurch scheint.
- Doch wo bleibt die Freude der Familien über die Heilung der beiden Unausstehlichen?
- Warum bringen sie nicht weitere Belastete und ihre vielen Kranken?
Am Ende ihrer Berichte zeichnen die Evangelisten Markus und Lukas ein sehr differenziertes Jesusbild. Er, der den Bitten der dunklen Mächte und sogar der geschädigten abergläubischen Bewohner jeweils entspricht, widerspricht der Bitte des Geheilten. Die positive oder negative Beantwortung der Anliegen lässt also an sich noch keine weiteren Schlüsse zu. Die beiden Evangelisten berichten von der Sendung des Geheilten zu den Bewohnern der Gegend. Jesus selbst sorgt so für die weitere Verbreitung der Siegesbotschaft. Wahre missionarische Aktivität beginnt zu Hause. Dort muss das Handeln von Jesus berichtet, erklärt und glaubwürdig gelebt werden. Jesus sieht den Widerstand und hört die Bitte zu gehen – doch er unterläuft diese Aufforderung in seiner Art. Heiden hören die siegreiche Botschaft!
Fragen:
- Wie ist der bewusste Aufenthalt von Missionaren in einer problematischen Gegend (in religiöser, kultureller, politischer Hinsicht) Gegend zu beurteilen?
- Warum sendet der Fürst der Dunkelheit gerne Empfangskomitees? Wo sehen wir heute seine Macht?
- Wie gehen wir mit einem JA oder einem NEIN von Jesus um?
- Verpassen wir den Segen von Jesus auch heute manchmal?
- Wo sehe ich meinen konkreten Missionsauftrag?
Gadara: Befreiung zweier Besessener
Mt 8,28 Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης.
29 καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί, υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;
30 ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη.
31 οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἀπόστειλον ἡμᾶς εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.
32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τοὺς χοίρους· καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.
33 οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.
34 καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῷ Ἰησοῦ καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
Mk 5, 1 Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν.
2 καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ,
3 ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασιν, καὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι
4 διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσιν δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρῖφθαι, καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι·
5 καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις.
6 καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ
7 καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει· τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; ὁρκίζω σε τὸν θεόν, μή με βασανίσῃς.
8 ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ· ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου.
9 καὶ ἐπηρώτα αὐτόν· τί ὄνομά σοι; καὶ λέγει αὐτῷ· λεγιὼν ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν.
10 καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα μὴ αὐτὰ ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας.
11 ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη·
12 καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες· πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν.
13 καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, ὡς δισχίλιοι, καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ.
14 Καὶ οἱ βόσκοντες αὐτοὺς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς· καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονὸς
15 καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα, καὶ ἐφοβήθησαν.
16 καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων.
17 καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 18 Καὶ ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς ἵνα μετ᾽ αὐτοῦ ᾖ.
19 καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ· ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σοὺς καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα ὁ κύριός σοι πεποίηκεν καὶ ἠλέησέν σε.
20 καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ πάντες ἐθαύμαζον.
Lk 8,26 Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντιπέρα τῆς Γαλιλαίας.
27 ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως ἔχων δαιμόνια καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν.
28 ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν· τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς.
29 παρήγγειλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτὸν καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαιμονίου εἰς τὰς ἐρήμους.
30 ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς· τί σοι ὄνομά ἐστιν; ὁ δὲ εἶπεν· λεγιών, ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ εἰς αὐτόν.
31 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν.
32 ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς.
33 ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη.
34 Ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγονὸς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς.
35 ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονὸς καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν.
36 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς.
37 καὶ ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γερασηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο· αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς πλοῖον ὑπέστρεψεν.
38 ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν λέγων·
39 ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ θεός. καὶ ἀπῆλθεν καθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.
5.5 Die Frage nach dem Fasten
Mt 9,14-17; Mk 2,18-22; Lk 5,33-39
Nach Matthäus 9,18 folgt nach der Frage in Bezug auf das Fasten unmittelbar die Auferweckung der Tochter des Jairus: „Während er dieses zu ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher herein…“. Nach Mk. 5,21-22 predigt Jesus am Ufer des Sees, als der Synagogenvorsteher Jairus zu ihm kommt. In diese Begegnung platzt eine Frau mit ihrem Heilungswunsch. So haben wir hier die zeitliche und örtliche Einordnung der Geschichte, bzw. der Doppelgeschichte. Details zum Fasten siehe Kap. 3.11.
5.6 Jesus heilt die an Blutfluss leidende Frau
(Mt 9,20-22; Mk 5,25-34; Lk 8,43-48)
Die Krankheit der Frau wurde durch ihre Familie und Umgebung so eingestuft, als hätte sie seit zwölf Jahren andauernde Menstruationsblutungen. In 3Mo 15,19-33 war geregelt, dass Frauen während dieser Zeit als zeremoniell unrein galten. Diese Frau war somit ständig sozial und religiös diskriminiert, mit einem Makel behaftet und ins Abseits abgeschoben. Es ist nachvollziehbar, dass mit der Regelung in 3Mo 15 Frauen ein Schutzraum während der Menstruation und nach Geburten geboten wurde. Da sie bestimmte Tätigkeiten ihrer hausfraulichen Pflichten nicht durchführen durften und Gesellschaften meiden mussten, Daher mussten andere Verwandte diese Aufgaben zeitweise übernehmen. Doch als diese Frau zu Jesus kommt, wird deutlich, dass Schutzräume des Gesetzes zu einem Werkzeug des Frauenhasses karikiert wurden. Jede Art von Körperausfluss – besonders bei Frauen – wurde mit Abscheu betrachtet. So steht nicht nur eine Frau mit einem gynäkologischen Problem vor Jesus, sondern insgesamt der weibliche Körper und die sehr negative Beziehung der Männer zum weiblichen Körper und zur weiblichen Sexualität. Diese Frau konnte entweder nie heiraten oder war wahrscheinlich inzwischen geschieden worden. Sie lebt in vielfacher Hinsicht am Rand der Gesellschaft. Der Evangelist Markus erwähnt die vielen kostspieligen Arztbesuche – Dr. Lukas stellt fest, dass sie nicht geheilt werden konnte.
Die unbekannte Frau wusste, dass wenn sie einen Mensch berührt, dieser für den Rest des Tages wie sie selbst zeremoniell unrein wird (3Mo 15,26-27). Alle Evangelisten machen klar, dass Jesus von einer Menschenmenge dicht umgeben ist. Die Frau hätte sich nicht in dieser Menschenmenge aufhalten dürfen. „Viele Schriftgelehrte vermieden es grundsätzlich, Frauen zu berühren, um gar nicht erst in Gefahr zu geraten, sich zu verunreinigen“ (Keener 1998, 97). In einem damals als Unverschämtheit empfundenen Glaubensakt berührt sie den Saum des Gewandes[109] von Jesus. Wir können darunter die tciyc ƒiƒit oder ~ylidIG> gedilim Quasten verstehen, die sich gesetzestreue Juden an den vier Enden ihres Obergewandes und später am Gebetsschal anbringen ließen (4Mo 15,38-41 und 5Mo 22,12). Diese Quasten waren aus blauweißer Kordel (Keener 1998, 97). Die Frau nähert sich Jesus von hinten, um so unerkannt geheilt zu werden und sich wieder schnell zu entfernen. Dieser seltsame Wunsch geht in Erfüllung – trotz unserer Bedenken angesichts mancher fast magischer Vorstellungen und Äußerungen in diesem Zusammenhang. Die Heilungskraft scheint bei der Berührung wie eine Energie aus Jesus zu fließen – Jesus scheint dabei passiv zu sein, denn er sagt später, dass eine Kraft von ihm gegangen sei. Die Frau meint, eine Berührung von Jesus sei notwendig und auch, dass Jesus es nicht bemerken würde. Trotz dieser Vorstellung wird sie sofort und vollständig gesund. Jesus äußert sich erst missverständlich (V. 30 …wer hat mein Gewand angerührt?) – doch er lobt dann ihren Glauben, der zwar nicht der Grund aber doch der Kanal für diese Heilung ist. Die Frau fasst sich entgegen der damalige Sitte ein Herz und berichtet öffentlich von ihrer Krankheit und der spontanen Heilung. Petrus versteht den Zusammenhang wie auch viele von uns heute erst einmal nicht und fragt milde lächelnd: Meister das Volk drängt dich und du fragst wer hat mich angerührt? Jesus nennt diese Frau liebevoll Tochter und nimmt sie wieder in die Gesellschaft mit einem umfassenden Schalom auf.
Fragen:
- Beschreibe den verborgenen Glauben der Frau. Wo kann uns solch ein verborgener Glaube heute begegnen?
- Der Glaube wird trotz ungewöhnlicher Wege belohnt. Geschieht dies auch heute?
- Der Glaube der Frau wird von Jesus öffentlich gemacht – trotz der peinlichen Umstände. Warum ist das öffentliche Bezeugen des Glaubens u.U. hilfreich?
- Wie verhalten wir uns in Gemeinde und Familie gegenüber Frauen verachtenden Tendenzen? Wie sieht ein positiver Umgang mit unser Körperlichkeit aus?
Mt 9,18 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδοὺ ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων ὅτι ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ ζήσεται.
19 καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
20 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ·
21 ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ· ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ σωθήσομαι.
22 ὁ δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν· θάρσει, θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
Mk 5,22 Καὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι Ἰάϊρος, καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ
23 καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει, ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ.
24 καὶ ἀπῆλθεν μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολὺς καὶ συνέθλιβον αὐτόν.
25 Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη
26 καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρ᾽ αὐτῆς πάντα καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα,
27 ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ·
28 ἔλεγεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ σωθήσομαι. 29 καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος.
30 καὶ εὐθὺς ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν· τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων;
31 καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε καὶ λέγεις· τίς μου ἥψατο;
32 καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν.
33 ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.
34 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· ὕπαγε εἰς εἰρήνην καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου.
Lk 8, 42 ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὐτὴ ἀπέθνῃσκεν. Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν.
43 Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις [ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον] οὐκ ἴσχυσεν ἀπ᾽ οὐδενὸς θεραπευθῆναι,
44 προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς.
45 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος· ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν.
46 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· ἥψατό μού τις, ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ᾽ ἐμοῦ.
47 ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν, τρέμουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ δι᾽ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα.
48 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· πορεύου εἰς εἰρήνην.
49 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ
5.7 Jesus weckt die Tochter des Jairus vom Tod auf
(Mt 9,18-19. 23-26; Mk 5,21-24.35-43; Lk 8,40-42.49-56)
Der Evangelist Matthäus gibt den Hinweis, dass Jesus Jairus in Kapernaum trifft (Mt. 9,1 seine eigene Stadt). Markus weist uns daraufhin, dass er danach in seine Vaterstadt nach Nazaret geht (Mk 6,1). Markus gibt noch das Detail an, dass die Bitte am Ufer des Sees an Jesus herangetragen wird. Matthäus ist im Vergleich zu Markus und Lukas in seiner Berichterstattung sehr kurz. Er spricht nur von einem Vorsteher, von einem Ältesten, während Lukas neben seinem Namen Jairus[110] auch noch seine Amtsbezeichnung nennt, nämlich: „Vorsteher der Synagoge“ (Lk 8,41). Markus ergänzt, dass Jairus einer der Synagogenvorsteher war (Mk 5,22). Das heißt, dass es einen aus mehreren Personen bestehenden Synagogenvorstand gibt. Lukas erwähnt in Lk 7,5 dass der in Kapernaum stationierte Zenturio das Volk (der Juden) liebte und ihnen die städtische Synagoge erbaut bzw. finanziert hatte. War Jairus in eben dieser Synagoge in verantwortlicher Position? Noch heute können wir in Kapernaum recht gut erhaltene Synagogenreste aus dem 2. Jh. sehen, die mit Wahrscheinlichkeit am selben Ort stehen.
Das Mädchen war nach Lukas die „einziggeborene“[111] Tochter des Jairus und ungefähr[112] zwölf Jahre alt. Markus nennt das Alter des Mädchens mit 12 Jahren (5,42).
Die Evangelisten Markus und Lukas überliefern uns die Worte des Vaters:
„Meine Tochter befindet sich im letzten Zustand, (im Endstadium ihrer Krankheit); „Meine Tochter ist eben gestorben“. Wie soll man diese zwei Aussagen zuordnen?
Eine mögliche Lösung:
Matthäus fängt mit seiner Erzählung dort an, wo die Diener (Lk. spricht von einem) des Jairus kommen und die Meldung bringen: „Deine Tochter ist soeben gestorben, was bemühst du noch den Meister“ (Mk. 5,35; Lk. 8,49)? Dann ist folgender Gesprächsablauf denkbar:
- Jairus kommt zu Jesus fällt ihm als Zeichen der Ehrfurcht und Verehrung zu Füßen und bittet ihn inständig: „Meine einziggeborene Tochter von etwa zwölf Jahren befindet sich in den letzten Zügen; komm, in mein Haus, lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt!“ Nur einem sehr viel Höherstehenden (etwa einem König) oder Gott werfen sich die Zeitgenossen von Jesus zu Füßen. Hier drückt dieser hochrangige Vorsteher der Synagoge sehr deutlich aus, wie groß in seinen Augen die Macht von Jesus ist (Keener 1998, 97)
- Jesus ist sofort bereit mit ihm zu gehen, doch während Jesus Jairus folgt, umdrängen ihn viele Menschen. Dann folgt die Geschichte der Heilung der kranken Frau. Während Jesus der Frau Rettung und Frieden zusagt, kommen einige und berichten Jairus: „Deine Tochter ist soeben gestorben, was bemühst du noch den Meister?
- Jesus hört diese Worte nebenbei mit.
- Jairus spricht Jesus erneut an und teilt ihm mit (Mt 9,18b): „Meine Tochter ist soeben gestorben“.
- Jesus sagt daraufhin zu dem Synagogenvorsteher: „Fürchte dich nicht, glaube nur und sie wird gerettet werden“!
- Jairus, ermutigt durch diese Zusage, sagt: „Komm und lege die Hand auf sie, und sie wird leben!“
- Nach dem Bericht des Markus nimmt Jesus nur Petrus, Jakobus und Johannes mit ins Haus des Jairus. Als er in das Haus des Jairus kommt, findet er schon die Flötenspieler[113] und eine lärmende Menge vor, welche die Tote beweinen und betrauern[114]. Die größere Anzahl der Klagefrauen und Flötenspieler weist auch auf die hohe Stellung und das hohe Vermögen von Jairus hin (Keener 1998, 97).
- Jesus spricht zu ihnen: „Weint nicht, Geht weg! Denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft“. Dies ist weniger ein Hinweis auf einen Koma-Zustand (auch nicht bei Lazarus Joh 11,11-14), sondern Worte von Jesus, die nicht wörtlich zu verstehen sind ( so auch: Joh 2,20.21; 3,3.4; 4,14,15.32.33; 6,51.52; 7,34.35; 8,51.52; 11,11.12.23.24; 14,4.5). Nicht die wörtliche Auslegung, sondern die übertragene Aussage von Jesus ist hier wesentlich: Der Tod hat nicht das letzte Sagen (Hendriksen 1974, 433)
- Die Anwesenden lachen über ihn, wissend, dass das Kind gestorben ist. Jemanden wörtlich: „auslachen“ indem man mal kurz das Klagen unterbricht, zeigt die innere Haltung der bezahlten Klagenden. Zwar gibt es auch ein im Westen weniger bekanntes Lachen um Schamgefühle zu überspielen. Doch hier will man Jesus bewusst demütigen.
- Jesus treibt alle hinaus und nimmt nur den Vater und die Mutter des Kindes zu sich und geht mit seinen drei Jüngern in das Zimmer in dem das Kind liegt.
- Jesus ist sich bewusst, dass die schlimmste rituelle Verunreinigung im jüdischen Bewusstsein die Berührung von Toten ist, dennoch ergreift er die Hand[115] des Mädchens und ruft aramäisch: „Talita kum(i), was bedeutet: „Mädchen[116], steh auf!
- Sogleich kehrt ihr Geist[117] zurück (Lk 8,55), sie steht sofort auf und geht umher.[118]
- Ihre Eltern geraten außer sich vor Freude. Jesus befiehlt ihnen aber nachdrücklich, diese Heilung für sich zu behalten.
- Jesus weist sie an, dem Mädchen Essen zu geben. Diese kleine Nebensächlichkeit offenbart die innere Einstellung von Jesus. Er ist besorgt, umsichtig und offensichtlich mitfühlend in seiner Zuwendung zu diesem Mädchen und seinen Eltern.
Fragen:
- Warum lässt sich Jesus nicht aus der Ruhe bringen? Warum lässt er es zu, dass die Frau ihn aufhält?
- Wie verhält sich Jesus angesichts des Todes? Wie denkt er, wie fühlt er?
- Was können wir daraus lernen?
- Welches Ziel hat Jesus im Auge?
- Wie gehen wir mit außergewöhnlichen Ereignissen in der Seelsorge um?
5.8 Jesus heilt drei Menschen mit Behinderungen
(Mt 9,27-34)
Auch diese Heilungsgeschichte finden wir nur beim Evangelisten Matthäus. Wahrscheinlich ereigneten sie sich am gleichen Tag, wie auch die Auferweckung der Tochter des Jairus und die Heilung der Frau. Matthäus schildert uns diesen arbeits- und ereignisreichen Tag in vielen liebevollen Details. Als Jesus das Haus des Synagogenvorstehers Jairus verlässt, folgen ihm zwei Blinde, die in der Art der Bettler unaufhörlich und störend laut rufen: „Erbarme dich unser, Sohn Davids!“ (Mt 9,27). Diese Bettler sprechen Jesus auf ganz besondere Weise an. Obwohl die Details der Geburt von Jesus in Bethlehem zu dieser Zeit in Galiläa wenig bekannt sind, ist es allgemein bekannt, dass Josef und damit auch Jesus aus Bethlehem stammt und ein Nachkomme Davids ist. Weiterhin wird hinter dieser Anrede auch der Messiastitel zu verstehen sein. In 2Sam 7,12.13 lesen wir von der Zusage Gottes, dass er einem leiblichem Nachkommen Davids …den Thron für ewig festigen wird. Der Evangelist Matthäus bekräftig diese Verbindung von Sohn Davids und Messias am Ende seiner Schrift: Mt 21,9 und 22,41-45.
Jesus hat trotz des Rufens und der besonderen Verehrung nicht auf diese beiden Menschen reagiert. Ob ihm die irdischen und zumeist politischen Hoffnungen, die mit diesem Titel verbunden waren, eher zurückhaltend reagieren ließen? Matthäus schreibt nur sehr wage, das Jesus „in das Haus gekommen war.“ Hier fragen wir uns, ob es „sein“ Haus in Kapernaum war. In Mt 4.13 haben wir den Eindruck, dass uns der Evangelist Matthäus mitteilen möchte, dass Jesus einen ständigen Wohnsitz in Kapernaum hat – wir nehmen an das Haus eines seiner Jünger.[119] Wir haben den Eindruck, dass Jesus später dann das Haus von Martha und Maria in Betanien als sein „Zuhause in Juda“ betrachtet. Die blinden Menschen können Jesus ins Haus folgen – im realen und übertragenen Sinn gibt es für behinderte Menschen einen barrierefreien Zugang.
Der Evangelist Matthäus überliefert uns aus dem Gespräch zwischen Jesus und den beiden Blinden nur die Frage von Jesus: „Glaubt ihr, dass ich dies tun kann?“ Nun war der Glaube der Menschen an Jesus als den Messias nicht die Bedingung, dass Jesus an Menschen ein Wunder vollbringen kann (Mt 8,28ff; 11,20-24; und Lk 17,17), doch hier fragt Jesus diese beiden Menschen, ob sie ihm die Heilung der Blindheit zutrauen. Das griechische Wort pisteu,w pisteuœ glauben hat einen weiten Bedeutungsumfang – hier passt recht gut: habt ihr Vertrauen in mir? Doch nicht der Glaube der beiden Blinden bewirkt die Heilung – es war allein das Handeln von Jesus. Die sehr respektvolle Antwort „Ja, Kyrie (Herr)“ weist auf ihre Einschätzung von Jesus hin. So antwortet man nur einer sehr hochstehenden Persönlichkeit. Jesus berührt mitfühlend ihre Augen – so kommt Jesus in einen für Blinde sehr wichtigen Körperkontakt. Sie spüren es ist Jesus, der sie berührt – von ihm geht die Heilung aus. Jesus will rettenden Glauben ermöglichen. Bei den beiden Blinden geschieht dies durch eine spontane vollständige Heilung. Ihre Augen werden aufgetan. Das erste was sie sehen ist Jesus! Das Sehvermögen an sich wiederzuerlangen ist ein gewaltiges Erlebnis. Doch gleichzeitig den Messias, den Erlöser der Welt zu sehen – wirklich umwerfend. Jesus allein zu sehen, nie wieder diesen Jesus zu vergessen und trotz mancher Dunkelheit alle Hoffnung auf ihn zu setzen wird die Lebensaufgabe dieser beiden Männer sein. Dies ist auch unsere Lebensaufgabe. Jesus trägt ihnen vergeblich auf, aus dieser Heilung keine „große öffentliche Sache“ zu machen. Jesus weiß, dass diese beiden Heilungen das öffentliche Interesse noch weiter in falscher Weise auf ihn lenken wird. Er will diese falsche Aufmerksamkeit in keiner Weise. Doch hier erscheint er uns in ganz menschlicher Weise – gegen Neugierde und Sensationslust (nicht nur der Presse) scheint auch Jesus machtlos zu sein.
Doch kaum geht die eine Gruppe kommt schon die nächste. Es scheint fast wie in einem Wartezimmer zuzugehen. Diesmal wird ein Stummer zu Jesus gebracht. Der Evangelist Matthäus teilt uns mit, dass dämonische Mächte die Ursache für diese Behinderung sind. Hier fällt dem Bibelleser auf, dass der Evangelist Matthäus nicht alle Krankheiten und menschlichen Abnormalitäten Dämonen zuschreibt. Trotz sehr ähnlicher Symptome unterscheidet er zwischen Krankheit und Besessenheit (siehe Mt 12,22 im Vergleich mit Mt 15,30). Nach Matthäus reicht auch die Erklärung, dass Besessenheit auf eine multiple Persönlichkeit hinweise nicht aus. Denn gemäß dem Evangelisten können Dämonen Menschen verlassen, in Schweine fahren und seien immer böse und destruktiv. Besessene werden vom Evangelisten in einem Zustand beschrieben, in dem eine unterscheidbare fremde böse Macht Einfluss über ihre Persönlichkeit gewinnt. Diese Macht könne sogar in unterscheidbarer Weise in Kontakt mit der Umwelt des Besessenen treten (Mk 5,7-10; Lk 4,41; Apg 16,18; 19,13-15).
Dieser in mehrfacher Weise ausgegrenzte Mensch wird geheilt. Der Evangelist nennt hier keine Details – nur die Tatsache, dass der Dämon ausgetrieben wird. Hier haben Horrorfilme und ungesunde „Sensations-Seelsorge“ ein scheinbar spektakuläres Umfeld geschaffen. Der Evangelist schildert diese Heilung sehr nüchtern, fast in Nebensätzen und vermeidet alle Details. Doch die erstaunte Reaktion der Zeitzeugen beschreibt der Evangelist im Detail. Diese Befreiung zum Leben, zum Sprechen und zur Gemeinschaft ist für sie einzigartig. Dieses Staunen kann sich auf alle Heilungen und Befreiungen dieses besonderen Tages beziehen. Doch wie schon öfter, ist die Reaktion nicht einhellig positiv. Religiöse Eiferer – hier die Pharisäer – leugnen zwar nicht die Befreiung, aber sehr wohl die Quelle. Sie schreiben diesen freisetzenden Einfluss dem Obersten der Dämonen zu. Diese schwerwiegende Auseinandersetzung wird uns noch im Detail beschäftigen, wenn wir zu Mt 12,24 kommen. Aufmerksame Leser der prophetischen Texte dagegen werden an Jes 35,5.6 erinnert:
„Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, und jauchzen wird die Zunge des Stummen.“
Fragen:
- Warum hört Jesus nicht auf alle Hilferufe? Wie gehen wir mit den vielen Hilferufen unserer Zeit um?
- Als was sehen wir Jesus im normalen Alltag?
- Sind unsere Häuser für Hilfesuchende barrierefrei?
- Hat uns Jesus seine „neue Sicht“ für unsere Umwelt gegeben?
- Wer hinderte damals – wer hindert heute Menschen am mutigen lauten Sprechen der Wahrheit?
- Warum ist die Stille und eine verschwiegene umsichtige Seelsorge hier dringend notwendig?
- Wollen wir heute auch mutig die Quelle für Heilung und Befreiung nennen?
5.9 Jesus in der Stadt Nain
(Lk 7,11-17)
Der Evangelist Lukas verbindet diesen Bericht eng mit dem Bericht von der Heilung des Knechtes des Hauptmanns (Lk 7,1-10). In der Bibel erwähnt nur der Evangelist Lukas die Ortschaft Nain und nur einmal in diesem Zusammenhang. Man nimmt an, dass der Ort in der Nähe des heutigen Ortes Nein liegt – auf dem nordwestlichen Abhang des Jebel ed-Duchy (Berg Moreh) 10 km südöstlich von Nazareth und 40 km südwestlich von Kapernaum. Anhand der Ruinen und der ausgedehnten Grabanlagen kann man annehmen, dass dies eine wichtige Ortschaft war. Lukas erwähnt besonders ein befestigtes Stadttor war.
Jesus nähert sich diesem Ort mit seinen Jüngern und vielen anderen Begleitern. In der ersten Phase seines Dienstes – in der „Beliebtheitsphase“ zog Jesus Menschenmassen an, die auch weite Wegstrecken nicht scheuten (Joh 6,66). Menschen wollten Jesus sehen und hören, denn seine Botschaft war anders (Mt 7,28.29) und für ihre Kranken und Belasteten war er die Hoffnung (Lk 4,42; 5,29; 6,17-19; 9,37; 14,25).
Gerade als Jesus die Stadt betreten will, fordert uns der Evangelist Lukas als seine Leser auf, eine Szene genau zu betrachten: „Siehe!“ Ein Trauerzug verlässt gerade den Ort. Tote wurden immer außerhalb der Stadt bestattet. Was wie purer Zufall aussieht – war doch ein wichtiger Punkt in Gottes Plan für alle Beteiligten. Bibelleser kennen manche dieser „Zufälle“:
- Abraham findet sofort ein Ersatzopfer (1Mo 22,13)
- Abrahams Knecht findet an einer Viehtränke die Braut für Isaak (1Mo 24,15)
- Gideon hört bei seiner Spionagetour durch das feindliche Lager einen Traum und die für ihn ermutigende Auslegung (Ri 7,9-25)
- Ruth sammelt Ähren genau auf dem Feld ihres späteren Lösers und Ehemann Boas
- Jeremia wird gerade noch rechtzeitig durch den afrikanischen Knecht aus einer Zisterne gerettet (Jer 38,7; 39,1ff)
Waren nicht alle diese menschlich gesehen ungeplante Zufälle wichtige Teile des göttlichen Planes, der dennoch die menschliche Verantwortung nicht schmälert.
Der Tote, der aus dem Ort getragen wird, ist der einzige Sohn einer Witwe.[120] Für diese Frau ist neben dem schrecklichen Verlust als Mutter auch die Existenz an sich gefährdet. Ihr Sohn ist Garant für Schutz und Versorgung. Durch ihn allein würde sie Enkelkinder haben, die dann die Familientradition aufrechterhalten würden. Doch nach dem frühen Verlust ihres Ehemanns muss sich diese Frau fragen, ob nicht auch Gott sie verlassen hat. Sie muss sich unaufhörlich die Frage stellen lassen oder sogar selbst stellen, ob nicht ein Fluch Gottes auf ihr liegt. Gab es eine Gesetzesübertretung, ein Handeln, ein Reden… dass Gott erzürnen ließ und sie nun die Strafe bekommt? Die vielen Hinweise im Gesetz (z.B. 2Mo 22,21) und bei den Propheten (z.B. Jer 7,6) zum Schutz der Witwen und Waisen als Zeichen für wahre Frömmigkeit, machen deutlich, das ihr unsicherer Status sich durch die Jahrhunderte zog und auch zurzeit von Jesus noch bestand. Als Einschränkung dieser Aussagen dürfen wir etwas aufatmend vom Evangelisten Lukas zur Kenntnis nehmen, dass die Witwe von einem recht großen Trauerzug auf dem letzten Gang begleitet wird. Es sind Anteilnahme und damit auch soziale Bindungen erkennbar.
Doch der Evangelist Lukas wendet den Fokus zu Jesus – hier nennt ihn Lukas als Autor bewusst HERR – auch über den Tod. Jesus spricht die Witwe an, die mit an der Spitze des Trauerzuges ist. Lukas nennt uns die herzliche innerliche Anteilnahme/Bewegung von Jesus an ihrer Trauer. Doch es muss sehr seltsam klingen, als Jesus zur Witwe die allen Grund zu vielen Tränen hat, die auch berechtigt von vielen anderen Weinenden begleitet wird, spricht: „Weine nicht!“ Solche Worte können nur dann tröstend sein, wenn der eigentliche Grund für die Tränen weggenommen wird – alle anderen Lebensweisheiten sind hier wenig tröstend. Doch die Trostworte von Jesus sind zutiefst aufrichtig – nicht aufgesetzt, gespielt oder gar geheuchelt. Jesus benötigt auch keine hilflosen Opfer um seine Selbstbestätigung als Helfer zu erhalten – noch ist die Not anderer ein Mittel sich selbst und anderen die eigene Unersetzbarkeit („kein anderer sieht die Not und hilft wie ICH!“) zu beweisen. Die Anteilnahme von Jesus ist tief (siehe Jes 53,4 und Mt 8,17), echt und dann auch effektiv.
Im weiteren Bericht des Lukas wird deutlich, dass niemand Jesus etwas bittet, da der Tod schon eingetreten ist – da gibt es absolut keine Hoffnung mehr! Jesus handelt aus eigener Initiative heraus. Doch der HERR über Leben und Tod hält allein die Schlüssel des Todes und des Hades in seinen Händen (Offb 1,18). Mit dem Bewusstsein dieser Autorität tritt Jesus an die Tragbahre heran und stoppt die Träger durch seine Berührung. Wieder sehen wir, wie Jesus sich nicht um die rituelle Verunreinigung kümmert, die damit einhergeht (4Mo 19,11-22; vgl. Tit 1,15). Jesus überwindet nicht nur die Verunreinigung durch den Tod, sondern den Tod selbst. Jesus spricht dann zu dem Toten: „Jüngling (neani,ske neaniske) ich sage dir, steh auf!“ In noch zwei weiteren Berichten erfahren wir von den Evangelisten, dass Jesus zu den Toten sprach:
- Tochter des Jairus (Lk 8,54)
- Lazarus (Joh 11,43)
Die ausgesprochenen Worte von Jesus gelangen nach dem Bericht des Lukas in wiederbelebte Ohren. Die eigentliche Auferweckung geschah in dem äußerst kurzen Zeitraum zwischen dem Senden und dem Empfangen dieser Lebensbotschaft – dies ist geheimnisvoll und zu groß für unser Verständnis! Doch trotz aller Zweifel – damals wie heute – der Evangelist und Arzt Lukas mutet es uns zu: der junge Mann setzt sich auf und beginnt zu sprechen – er war wirklich und vollständig ins Leben zurück gekehrt. Es fällt uns auf, dass alle Auferweckungsberichte der Evangelien Jesus im Mittelpunkt sehen und in besonderer Hinsicht ein Zurückbringen in die Familie sind. Jesus und sein himmlischer Vater lieben die Familie und wollen sie stärken, schützen und wo möglich wiederherstellen. Während Elia (1Kön 17,20-22) und Elisa (2Kön 4,32-35) lange kämpfen mussten, bis das Leben den Tod verdrängte, spricht der HERR über den Tod ein Wort und die Tochter, der Sohn oder der Freund kehren ins Leben zurück.
Alle Anwesenden sind durch dieses Ereignis tief beeindruckt: „…Furcht ergriff sie und sie verherrlichten Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden, und Gott hat sein Volk besucht.“[121] Die Menschen sehen ganz unerwartet Gottes Kraft aber auch sein liebendes Erbarmen. Gott kommt den Menschen ganz nahe – sein Sorgen, seine praktische Hilfe, seine Liebe zu Menschen wird ganz real. Gott hat sein Volk besucht – dies ist ein Zitat aus dem Alten Testament (Ruth 1,6 z.T. auch 1Sam 2,21). Jesus wird als bevollmächtigter Prophet Gottes gesehen – doch in aller Konsequenz setzt sich diese Einsicht nicht in der Breite des Volkes durch – denn Jesus beansprucht schließlich auch noch mehr. Er weiß von seinem Status als Messias und Gottes Sohn.
Die Nachricht von Jesus – seinen Worten und Taten verbreitet sich überregional, selbst bis nach Judäa und die anderen angrenzenden Regionen.
Fragen:
- Berichte von sogenannten Zufällen, die sich für dich doch als Wirken Gottes entpuppten.
- Berichte von deinen Eindrücken angesichts von einem hoffnungslosen Fall.
- Was empfindest du beim Gang zur „Letzten Ruhestätte“?
- Die Worte von Jesus sind Worte des Lebens! Hast du solche Worte schon gehört?
- Hat Gott deiner Familie Gutes getan? Hat er deinen Wohnort schon mal „besucht“?
5.10 Die Frage des Täufers
(Mt 11,1-19; Lk 7,18-35)
Dieser Bericht lässt sich in folgende Abschnitte aufteilen:
- Jünger des Johannes übermitteln Jesus dessen Zweifel (1-3)
- Die Antwort von Christus (4-6)
- Das Lob von Jesus auf Johannes dem Täufer- (7-19)
Der Evangelist Lukas verbindet seinen Bericht mit der Verbreitung der Sensationsmeldungen von Jesus bis hin nach Judäa und Peräa. Dort erreichen sie auch Johannes den Täufer, der im Gefängnis von Herodes Antipas wahrscheinlich in Machärus eingekerkert ist (Mt 4,12; 14,3.4). Der Evangelist Matthäus dagegen verbindet diesen Bericht mit einer Lehreinheit von Jesus in Galiläa (Judäa vor?) nach einem Kurzzeiteinsatz seiner zwölf Jünger. Matthäus leitet seinen Bericht mit dem Hinweis auf die ausgedehnte regionale Lehr- und Predigttätigkeit von Jesus ein.
Der Unterschied zwischen Predigen und Lehren ist zwar u. U. nicht so groß, doch vor dem Hintergrund der benutzten griechischen Worte schon erheblich. Das griechische Wort khru,ssw k¢ryssœ bedeutet laut (wie ein Herold) verkünden, bekannt machen (Öffentlichkeitswirkung). Das griechische Wort dida,skw didaskœ bezeichnet die detaillierte Information, die einer Ankündigung folgt (Inhaltsvermittlung).
Die Kerkerhaft des Johannes ist hart, aber dennoch darf er Kontakt zu seinen Jüngern halten. Von diesen erhält er aktuelle Nachrichten – auch von den Jesustaten. Doch die Erwartungen und Prophetien von Johannes in Bezug auf Jesus als den „gekommenen“ Messias decken sich nicht mit dessen aktuellen Aktionen. Johannes fragt sich, ob sie jetzt doch auf „einen ANDEREN warten sollen? Johannes hatte damals am Jordan verkündet, dass Jesus gekommen sei zu bestrafen und zu zerstören (Mt 3,7.10; Lk 3,7.9). Diese Worte waren eine göttlich inspirierte Botschaft – doch wie schon die alttestamentlichen Propheten vor ihm, konnte er nicht zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias unterscheiden. Diese schwierige Unterscheidung zwischen dem Vergangenen, Gegenwärtigen und dem Zukünftigen muss auch heute noch der Leser der prophetischen Abschnitte der Bibel treffen. Johannes trifft hier eine gute Entscheidung, er schweigt nicht leidend, schwätzt nicht mit anderen Nichtinformierten darüber, sondern sendet eine Abordnung zur richtigen Person. So hofft Johannes zu Recht, dass sein Problem gelöst wird. Als Jesus von den Gesandten die Frage überbracht bekommt, antwortet er gleich, in dem er sie auffordert zu Johannes mit dem Dienstresümee aus seinem eigenen Mund zurückzukehren. Dies wird Johannes recht vertraut vorkommen, da es unter anderem ein kombiniertes Zitat aus Jes 35,5-6a und 61,1 ist. Im Jesajabuch lesen wir:
„Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, und jauchzen wird die Zunge des Stummen..“ (Jes 35,5-6a).
„Der Geist des Herrn, HERRN, ist auf mir; denn der HERR hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen“ (Jes 61,1a).
Jesus formuliert von diesen Texten ausgehend: „Blinde werden sehend, und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, und Taube hören, und Tote werden auferweckt, und Armen wird gute Botschaft verkündigt“ Mt 11,5.
Zwar wird Johannes von den Taten an sich gehört haben, aber diese heilsgeschichtliche Einordnung durch Jesus eröffnet ihm eine neue Sichtweise. Jesus sieht diese Messiasverheißungen in seinem Dienst erfüllt und damit als Messias-Beweis. Beide Verheißungen beziehen sich auf Heilungen und das Predigen der frohen Botschaft. Jesus erweitert diese Zusammenfassung noch mit dem noch recht aktuellen Fall der Totenauferweckung in Nain. Jesus schließt seine Antwort mit dem Hinweis: „…glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird“(Mt 11,6). Man kann fast ahnen, dass in diesen Worten auch ein sanfter Tadel an einen lieben Freund steckt – an einen, der durch den so ganz anderen „Christus“ ins Zweifeln geraten ist (entäusch und verärgert war). Doch der erste Teil dieses Schlusssatzes darf nicht übersehen werden: „Glückselig…!“ Jesus geht mit Johannes genauso liebevoll um, wie mit dem Blindgeborenen, der Ehebrecherin, Petrus, Thomas… letztlich mit jedem der sich an Jesus reibt. Doch bei Johannes war die Situation beengter – er war enttäuscht. Jesus geht auf diese Enttäuschung ein – so korrigiert Jesus in sanfter und offener Art die Messiaserwartung bei seinem Freund (siehe auch Lk 24,25).
Dieser zutiefst sensible und liebevolle Umgang mit dem zweifelnden Johannes wird deutlich, wenn wir das höchste Lob bedenken mit dem Jesus nach diesen Worten Johannes überschüttet. Jesus nimmt Johannes den Täufer vor Kritik in Schutz. Er erinnert seine Zuhörer an ihre begeisterte Wanderung hinab ins Jordantal, um dort Johannes predigen zu hören. Johannes war nicht das vom Zeitgeist hin- und herbewegte Schilfrohr – sondern die standhafte Eiche im Wetter. Jesus wählt dann das Stilmittel der Ironie, als er die weiche (teure) Kleidung des Johannes als Grund für den Andrang der Massen nennt. Johannes ist ja genau für das absolute Gegenteil bekannt: er ist der Mann im sehr kratzigen Kamelhaarmantel, der in offensichtlichen Spannungen mit den weich gekleideten „Bücklingen“ am Königshof steht.
Jesus weiß, dass Johannes als Prophet damals der Volksheld war. Doch in den Augen von Jesus ist er noch mehr. Er ist der Wegbereiter des Messias – sein Wegbereiter, wie er in Mal 3,1 angekündigt wurde. Jesus beschreibt Johannes als den Größten unter uns Menschen. Die Gründe für diese hohe Stellung können sein:
- Er verkündigt das unmittelbare Kommen des Messias und offenbart seinen Zuhörern, wer dieser Messias ist (Joh 1,29).
- Er betont die Umkehr (Buße) als notwendigen Schritt, um in das Reich des Messias eintreten zu können (Mt 3,2).
- Er ist bereit angesichts des gekommenen Messias in den Hintergrund zu treten (Joh 3,30).
Doch im Licht von Mt 13,16.17 ist auch der Geringste, der ins Reich Gottes eingeht, noch größer als dieser Große Johannes. Die Zeitgenossen und Zuhörer sind nicht wie Johannes von Jesus durch Mauern getrennt. Sie können die Zeichen des angebrochenen Gottesreiches mit den eigenen Augen sehen. Auch werden alle Jünger nach Johannes, der im Gefängnis sitzt und dort sterben wird, Golgatha, Ostern und die Himmelfahrt erleben. Weiter beschreibt Jesus den Anteil von Johannes an der Erfüllung seiner eigenen Mission mit respektvollen Worten. Der Dienst von Johannes ist für ihn wesentlich und keineswegs vergeblich.
Der Begriff: dem Reich der Himmel wird Gewalt angetan lässt sich auch so übersetzen: das Reich Gottes (= der Himmel) drängt kräftig vorwärts. Unter Gewalttuenden die es an sich reißen verstehen wir: Männer drängen entschlossen vorwärts, um das Reich anzunehmen. Diese jeweiligen Übersetzungsvarianten unterscheiden sich erheblich. Betrachtet man die sehr frühen Übersetzungen, sieht man, dass auch damals schon diese beiden Sätze kaum verstanden wurden.
Wir wollen unsere Übersetzung begründen: Wir merken beim Lesen, dass eine negative Bedeutung nicht durch den Kontext gestützt wird. Beide Aussagen hängen an dem nur hier und im Paralleltext (Lk 16,16) im Neuen Testamen vorkommenden Verb bia,zw biazœ. Dieses Verb hat im Passiv und im Medium (griechische Mittelform zwischen Aktiv und Passiv) eine identische Schreibweise. Liest man es im Passiv hat es eine negative Bedeutung (jemandem wird Gewalt angetan), liest man es dagegen im Medium kommt man zu der positiveren Richtung der „Gewalt.“[122] (kraftvoll vordringen). Mit anderen Worten – das Reich breitet sich kraftvoll aus, aber keiner kommt schlafend ins Reich Gottes, sondern es fordert entschlossenes Handeln (Lk 13,24; 16,16; Joh 16,33; Apg 14,22).
Jesus macht weiter deutlich, dass mit Johannes der Paradigmenwechsel begonnen hat. Das Gesetz und die Propheten (= das Alte Testament) kommen zu einem Ende. In Johannes als den Wegbereiter erfüllen sich die Verheißungen für die Wende. Er hält beides zusammen: das Alte und das Neue. Er ist der Volksheld für eine ganze Generation, doch welche Konsequenzen ziehen seine Zuhörer und Zeitgenossen aus seiner Predigt? Jesus weist auf das kindische Verhalten einer spielenden Gruppe von Kindern auf einem leeren Marktplatz. Einige wollen erst Hochzeit und dann eben Beerdigung spielen – doch die Spielkameraden spielen jeweils nicht mit. Da werden natürlich, die Kinder mit den Ideen ärgerlich und beschimpfen die lustlosen Mitspieler. Jesus wirft seinen Zeitgenossen dieses kindische Verhalten vor: den einen ist Johannes ein seltsamer Außenseiter, der noch nicht einmal richtig mit den Menschen feiern kann. Den anderen ist aber ist Jesus der Weinsäufer und Fresser, der Freund der Mafia und anderer Gesetzesloser – einer der nicht richtig „fromm“ ist und zuviel mit den falschen Menschen herumhängt.
„Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken.“ Die Weisheit von Johannes, der am Bußruf angesichts des anbrechenden Gottesreiches festhält und die Weisheit von Jesus, der die Hoffnung auf das Heil – auch für die Randexistenzen – hoch hält, wird in den Herzen und Leben derer offenbar, die aus tiefem Herzen mit Glauben antworten. „Kinder der Weisheit“(Lk 6,35) sind alle Menschen, die die Botschaft von Johannes und Jesus zu Herzen nehmen. So ist es Gottes Weisheit, dass aus dem Spottnamen: Freund der Zöllner und Sünder die hoffnungsvollste Ehrenbezeichnung für Jesus wurde.
Fragen:
- Kennst du Zeiten der Enttäuschung? Hast du Mut Gründe für deine Zweifel zu nennen?
- Welche Beweise siehst du heute in deiner Gemeinde für die Realität des angebrochenen Reiches Gottes?
- Was können wir von Jesus im Hinblick auf den enttäuschten Johannes lernen?
- Was bedeutet menschliche „Größe“ in den Augen von Jesus?
- Wie gehen wir mit Menschen um, die meinen „schlafend“ in den Himmel zu kommen?
- Welches kindische Verhalten begegnet uns auch heute noch bei Erwachsenen?
5.11 Jesus im Haus des Simon
(Lk7,36-50)
Diesen Bericht überliefert nur der Evangelist Lukas, deshalb ist er zeitlich schwierig einzuordnen. In beiden Werken des Evangelisten Lukas spielt das ´Haus´ eine wesentliche heilsgeschichtliche Rolle – so auch hier. Jesus ist wie so oft zu einem Bankett eingeladen. Gastgeber ist ein nicht näher bezeichneter Simon, einer der am häufigsten im Neuen Testament vorkommenden Namen. Dieser hält sich zur Gruppe der Pharisäer. Die Gründe für diese Einladung werden uns nicht genannt – war es kritische Neugierde? Zurzeit von Jesus legt man sich an einen niedrigen Tisch, bzw. auf den gepolsterten Boden. Es wird zwar im Bericht nicht ausdrücklich betont, aber wir können doch damit rechnen, dass außer Jesus und seinen Jüngern noch viele andere geladen waren. Simon muß ein wohlhabender Pharisäer gewesen sein und entsprechend war dann auch sein Haus groß genug, um viele zum Mahl einzuladen. Bei dieser festlichen Versammlung spielt sich folgende ungewöhnliche Szene ab. Eine Frau, die Simon später als „eine Sünderin“ [123] bezeichnet, betritt den Festraum. Die Bezeichnung Sünderin regte die Phantasie besonders männlicher Leser seit vielen Generationen an. Manche betrachten sie als Prostituierte. Doch wir müssen fair bleiben. Im Text wird diese Frau nicht als solche bezeichnet. Auch muss man die sehr zu Lasten der Frau gehenden Regeln im Umgang der Geschlechter kennen. Junge Frauen wurden nicht selten gegen ihren Willen zu Objekten von sexuellen Handlungen, bei denen sich oft nur der Mann ehrenhaft herauswinden konnte. Frauen dagegen konnte dann lebenslang ein schlechter Ruf angehängt werden, auch wenn sie u. U. nur die Opfer waren. Diese Frau hört von Jesus und eilt zum Haus des Pharisäers. Sie bringt allen Mut auf, um gerade bei diesem Festessen ganz nahe zu Jesus zu gelangen. Wieder weist uns der Autor Lukas mit dem Wort „Siehe!“ auf eine ungewöhnliche Szene – die Frau betritt vor aller Augen das Haus des strikten Pharisäers. Hat sie die rettende Botschaft von Jesus an einem anderen Ort selbst gehört? Wir haben den Eindruck, dass sie die Botschaft der göttlichen Vergebung durch die Jesusworte erlangte und jetzt ein „Liebesopfer“ aus Dank bringen möchte. Dazu hat sie sich einen Plan zurechtgelegt, denn sie bringt ein teures Alabaster-Parfümgefäß mit sich. Dieses gipsartige Gefäß hat einen langen Hals, der zum Öffnen abgebrochen wird.
Trotz aller inneren und äußeren Barrieren findet diese Frau einen Weg zu Jesus, der mit anderen zu Tisch liegt, den Kopf mit der linken Hand abgestützt und die Füße jeweils nach außen gestreckt. So kann die Frau hinter ihn treten und die Füße salben. Ihr sehr teures Parfüm ist Narde aus Indien[124]. Ihr früheres Leben, gerade mit der uns nicht bekannten Not, tut ihr von Herzen leid. Demjenigen, der ihr die Vergebung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft angeboten hat, dem will sie damit die Füße salben. Nichts ist ihr dafür zu kostbar. Ihr Herz scheint von einer Mischung aus Ehrfurcht und überfließender Liebe zu Jesus erfüllt zu sein. Sie kann bei Jesus angekommen nicht mehr anders und bricht in Tränen aus, die auf die Füße von Jesus tropfen. Entgegen aller damaligen Konventionen löst die Frau ihre Haare, versucht damit die Füße zu trocknen, zu küssen und zu salben.
Der Pharisäer Simon fühlt sich als Gastgeber durch dieses ungehörige Verhalten tief beleidigt. Das Verhalten der Frau und die Duldung durch Jesus bringen ihn in ein schlechtes Licht. Er gerät durch diese Szene in noch größere Zweifel, ob dieser Jesus wirklich ein Prophet sei. Als Prophet hätte er die Frau als Sünderin erkennen und von sich stoßen müssen. Interessant ist hier die Frage – woher kannte denn Simon diese Frau und ihr Vergehen so genau. War hier ein kaltherziger Richterspruch gefällt worden, an dem er beteiligt war? Oder sollte er sogar in ehrenrühriger Beziehung zu ihr gestanden haben? Der selbstgerechte Simon kann die gute Nachricht für Sünder – ihre Rettung durch Gnade nicht akzeptieren (Lk 5,31.32; 15,1.2; 18,14).
Doch in den Versen Lk 7,40-48 beweist Jesus,
- dass er die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Frau kennt;
- dass er die verborgenen Gedanken von Simon kennt;
- dass er wirklich ein Prophet ist, der die Regungen des Herzens und des Verstandes unterscheiden kann und
- dass er selbst der von gottgesandte Retter ist, der die Autorität zur Sündenvergebung hat.
Jesus verdeutlicht diese Selbstoffenbarung durch die Erzählung eines kurzen Gleichnisses aus der Finanzwelt. Ein Schuldner hat eine Schuld von 500 Arbeitstagen bei einem Geldverleiher, der andere von 50 Arbeitstagen. Da beide nicht zurückzahlen können, wirft er sie nicht etwa ins Gefängnis, bis ihn die Verwandten herauslösen, sondern erlässt beiden die Schuld. Vermutlich schaut Jesus Simon in die Augen und fragt dann, wer den Geldverleiher jetzt mehr liebt. Simon kann nicht anders, als zuzugeben, dass es wohl derjenige sein wird, dem die größere Schuld erlassen wurde.
Geduldig erklärt Jesus, dass Simon mit seiner Antwort richtig liege. Doch dann weist Jesus auf die Frau und fragt ihn, ob er sie sehe und ob er ihre Aktion verstünde. Dann beschreibt Jesus, wie er in Simons Haus kam (er lässt weg: auf deine Einladung hin!) und wie alle Regeln des orientalischen Gästeempfangens ignoriert wurden (kein Fußbad, kein Willkommenskuss, keine Salbung). Doch gerade „diese“ Frau habe das verpasste alles wett gemacht. Es war sogar vielmehr als notwendig, statt Olivenöl Nardenöl, statt Wasser Tränen, statt einem Fußtuch die eigenen Haare. Sie liebt viel, weil ihr viel vergeben wurde. Jesus endet in einer indirekten Frage, die das Verhältnis von Simon zur unbekannten Frau auf den Kopf stellt: „Ist der Person, die wenig liebt, wenig vergeben worden?“ Liebe ist also Reaktion auf Vergebung, aber nicht Voraussetzung.
Jesus entlässt die Frau mit der öffentlichen Zusicherung der Sündenvergebung. Dies war die Zusicherung dessen, was sie ja zu Jesus getrieben hatte. Simon und seine Kollegen verharren in ihrer Kritik an den, der sich so unmöglich benimmt und dann noch Sünden vergibt.
DOCH JESUS INGNORIERT SIE!
Nur Menschen die von der Vergebung leben – gehen/leben im Frieden!
Fragen:
- Welches Stigma wird heute noch Mitmenschen verpasst – von dem sie sich kaum lösen können?
- Welche Liebes-Taten des Dankes für die erlangte Vergebung sind heute vorstellbar?
- In welchen Bereichen sind die bürgerlichen „Benimm-Dich-Regeln“ für das Evangelium ein Hindernis?
- Wie äußert sich heute bei mir der Beginn der Selbstgerechtigkeit?
- Wie kann ich in einem Leben der Vergebung bleiben?
Veröffentlicht unter UNTERWEGS MIT JESUS
Kommentare deaktiviert für 5. Kapitel: Jesu Wirken in Galiläa
4. Kapitel: Der erste Jerusalembesuch
4.1 Der erste Jerusalembesuch
(Bibeltext: Joh 2,13; 3,22; 4,3)
Jesus zieht es immer wieder nach Jerusalem. Schon früher reisten seine Eltern jedes Jahr zum Passahfest nach Jerusalem. Als er zwölf Jahre alt war, blieb er sogar unbegleitet dort allein im Tempelbezirk. Seine damalige Begründung des Fernbleibens von der elterlichen Pilgergruppe lautete: „Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist“ (Lk 2,49). Diese Begründung birgt mehr in sich als eine bloße Zugehörigkeitserklärung zum Tempel in Jerusalem. So sind seine Jerusalembesuche nicht nur Gesetzeserfüllung (2Mose 34,24), sondern auch inneres Bedürfnis und Verantwortung gegenüber seinem himmlischen Vater und dem Volk Israel. Die Aussage in Matthäus 23,37b „Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt…“, spricht von seinen mehrfachen Versuchen Jerusalem zu gewinnen.
Nur der Evangelist Johannes berichtet von diesem ersten Besuch in Jerusalem. Wir haben schon in der Einleitung festgestellt, dass Johannes drei Passahfeste ausdrücklich nennt (Joh 2,13; 6,4; ab 11,55 das letzte Passah), in Joh 7,1ff ein Laubhüttenfest und in Joh 5,1 ein nicht näher beschriebenes Fest der Juden. Die Synoptiker dagegen berichten nur vom letzten Passahbesuch in Jerusalem.
Fragen:
- Gibt es gute Gründe für die Beachtung des Kreislaufes der biblischen Feste?
- Wie nutzt Jesus diese Feste?
- In welcher Weise lassen sich Traditionen im Sinne von Jesus füllen?
4.2 Jesus reinigt den Tempel und macht ihn zum Ort der Anbetung
(Joh 2,14-25; Mt 21,12-17; Mk 11,15-19; Lk 21,45-48)
Alle vier Evangelisten beschreiben den gewaltsamen Eingriff von Jesus in die Tempelordnung.
Abbildung: Modell des Herodianischen Tempels, an dem 46 Jahre gebaut wurde und der von den Römern im Jahre 70 n. Chr. zerstört wurde (Foto: P. S. April 1986).
Die Synoptiker ordnen sie harmonisch in die Passionsgeschichte ein. Dies ist verständlich, denn sie beschreiben nur einmal den letzten Passahbesuch. Der Evangelist Johannes, der mindestens drei Passahfeste erwähnt, versucht dieses Ereignis wahrscheinlich eher chronologisch in seinen Bericht einzubauen. Er berichtet von der Tempelreinigung beim ersten Passahbesuch in Jerusalem (Joh 2,13ff). Der Evangelist macht damit deutlich, dass Jesus schon zu Beginn seines Dienstes auf die Unordnung und die Fehlentwicklung bei den Tempelordnungen reagiert. Dieser Eingriff in die Tempelordnung erfolgt vor dem Passahfest (2Mose 12,1-14). Im Jahr 30 n. Chr. fällt das Fest, also der 14. Nisan (5./6. April) wahrscheinlich auf einen Mittwoch.
4.2.1 Wer hat das Sagen im Haus Gottes?
Jesus zögert keinen Augenblick, die Missstände die er im Tempel antrifft offen zu kritisieren. Sie sind auch für andere gottesfürchtige Juden offensichtlich. Manche wie z. B. die Qumran-Gruppe haben sich angesichts der Zustände ganz vom Zentralheiligtum in Jerusalem und besonders von der Priesterschaft gelöst und sind aus religiösen Gründen fern der Dörfer und Städte in eigene klosterähnliche Anlagen gezogen.
Bei diesem Fest sehen wir eine ungewöhnliche Seite von Jesus, besonders die angewandte Gewalt und Strenge erstaunt uns. Wir können sie als Glied folgender Kette sehen:
- Jakob ordnete in seiner Familie an, sich von den fremden Götzen zu trennen
- Mose zerschlug angesichts des Goldenen Kalbes im Eifer um den Herrn die ersten zwei Tafeln des Bundes
- Josia – einer der wenigen frommen Könige – renovierte das Haus Gottes, verbannte den Bilderdienst und führte religiöse Reformen im ganzen Land durch
- Judas Makkabäus entfernte alle fremden Gegenstände aus dem Tempel im 2. Jh. v. Chr.
- Der Eifer um das Haus des Herrn (Ps 69,10) ergreift auch Jesus. Mit einer Peitsche aus Binsenstricken treibt er Verkäufer von Ochsen, Schafen und Tauben aus dem Tempel hinaus. Den Geldwechslern stößt er die Tische um. Zwei Vorwürfe spricht er dabei aus:
- „Macht nicht meines Vaters Haus zu einem Kaufhaus“
- „Ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht“
Was Gott selbst angeordnet hatte, wurde auf gewinnbringende Weise missbraucht (5Mose 14,24). Manche vermuten, dass zu diesem Zeitpunkt im Tempel eine organisierte Geschäftsstruktur herrscht, die wir heute als mafia-ähnlich beschreiben würden. Der Hohepriester muss seine Bestätigung im Amt „kaufen“ und kontrolliert daraufhin gewinnbringend das Geschäft mit Opfertieren und dem Geldwechsel (unreines Geld mit Bildprägungen wird gegen Opfergeld ohne Bild getauscht). Religion und Mafia scheinen sich zu vertragen. Nichts Neues unter der Sonne – denn schon die Söhne des Hohenpriesters Eli, missbrauchten schamlos ihre Position als Priester zu ihrem eigenen Vorteil (1Sam 2,12).
Nach der zeitweisen Räumung des Tempels übergibt Jesus ihn wieder seiner eigentlichen Bestimmung: „Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für alle Völker“ (Jes 56,7).
„Und es traten Blinde und Lahme in dem Tempel zu ihm und er heilte sie“ (Mt 21,14).
„Als aber die Hohenpriester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten: Hosanna dem Sohn Davids! Wurden sie unwillig und sprachen zu ihm: „Hörst du, was diese sagen“ (Mt 21,15-16a)?
Jesus antwortet ihnen mit dem Wort aus der Schrift:
„Ja, habt ihr nie gelesen: Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet“ (Vgl. Mt 21,16b mit Ps 8,3). Wie gut steht es um eine Gemeinde, wenn Säuglinge und Unmündige im Gottesdienst zu hören sind!
Auch Markus und Lukas berichten von der Unzufriedenheit und den Mordplänen der Schriftgelehrten nach diesem Eingriff in die Tempelordnung (Mk 11,18; Lk 19,47-48). Sie fragen Jesus: „Wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du dies tun darfst“? Oder: „Was tust du für ein Zeichen, dass du dies tun darfst“? Jesus antwortet ihnen: „Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten“. Jesus redet hier verschlüsselt vom Tempel seines Leibes, weiss aber, dass die aufgestachelten Gegner damit nur den vor ihnen aufragenden Gebäudekomplex meinen können. An dieses verschlüsselte Wort erinnern sich später die Autoren der Briefe:
- Der Tempel seines Leibes ist die Gemeinde (1Kor 6,16; Eph 2,21).
- Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr (1Kor 3,17).
4.2.2 Hinweise zur Prüfung:
- Frömmigkeit kann zum Gewerbe werden – doch unser Einkommen soll dem Reich Gottes dienen, nicht umgekehrt (1Tim 6,5).
- Habsucht und Gewinnsucht können sich sehr leicht in den frommen Alltag einschleichen (2Petr 2,3; Kol 3,5).
- Ehrsucht, Stolz, Überheblichkeit, Eigennutz kann sich breit machen.
- Status und Karriere kann mehr zählen als Gottes Ehre.
- Die Ellenbogenmetalität oder Ichbezogenheit kann sich auch in unserer Gemeinde ausbreiten und Schwache verdrängen.
- Neid kann uns blind machen für Gottes wunderbares Wirken an anderen – besonders, wenn sie erfolgreicher sind als wir.
Die Stätte der Anbetung ist in erster Linie unser Herz, dann die Familie, dann die Ortsgemeinde, dann die Stadtgemeinde, dann die weltweite Gemeinde. Wahre Anbetung geschieht im Geist und in der Wahrheit
Gottes Haus – ein Bethaus für alle Völker – das motiviert zum Gebet für die lokale, regionale und globale Mission!
Fragen:
- Warum wird die Tempelreinigung bei den Synoptikern am Ende und bei Johannes am Anfang beschrieben?
- Warum ergriff Jesus der Eifer um das Haus seines Vaters?
- Was geschah nach der Reinigung des Tempels?
- Wie reagierten die Priester und die Schriftgelehrten im Volk auf die Tat von Jesus?
- Was hat diese Episode mit uns oder unserer Gemeinde heute zu tun?
4.3 Das Ergebnis seines Dienstes in Jerusalem
(Joh 2,23-25)
Jesus bleibt während des ganzen Passahfestes in Jerusalem und viele kommen zum Glauben an ihn. Viele Festpilger bemerken seine Autorität und erkennen ihn als großen Propheten und auch als Messias an. Der Hauptgrund für diesen Glauben sind die Zeichen, welche er tat (Joh 2,23). Doch dieser Glaube ist meist nicht so tief gegründet, dass es ein rettender Glaube wird. Die Worte und Taten von Jesus beeindrucken und stützen den rettenden Glauben (Joh 20,30.31) doch führt er nur bei wenigen Zeitgenossen von Jesus zum ewigen Leben. Auffallend ist hier, dass der Evangelist Johannes kein einziges Zeichen nennt oder ausführt, vielmehr geht es ihm darum, zu zeigen, wie die Menschen darauf reagieren.
Wir lesen weiter, dass Jesus sich ihnen nicht anvertraut. Hier wird auch im griech. Text jeweils das gleiche Wort genutzt: Sie vertrauten ihm evpi,steusan episteusan doch Jesus vertraute sich ihnen nicht an ouvk evpi,steuen auvto.n ouk episteusen auton. Die Menschen vertrauen – doch Jesus vertraut nicht? Jesus hält also zu den begeisterten Massen Distanz. Er betrachtet sie nicht als wahre Gläubige, denen er sich anvertrauen kann. Jesus weiss, wie sich diese gleichen Menschen bald gegen ihn stellen werden. Er sieht dem einzelnen ins Herz und erkennt die tieferen Motive, Absichten und Interessen (=Herzenseinstellung). Jesus ist Menschensohn, doch hier wird auch deutlich, dass er als gesandter Sohn vom Vater die Fähigkeit besitzt, Gedanken und sogar Motive im Herzen vieler Menschen gleichsam zu erkennen. Dort sieht er unaufrichtige und oberflächliche Begeisterung – er sieht wie rasch diese Zustimmung verfliegen wird, wenn seine Leidenszeit anbricht. Jesus ist nicht der Star, der den Beifall seiner Fans benötigt. Sein Dienst ist unabhängig von der Aufnahme oder Ablehnung seiner Person oder Botschaft.
Fragen:
- Jesus sieht/erkennt Gedanken von Menschen und sogar deren Motive,- tröstet es uns, oder macht es uns vielleicht sogar unruhig?
- Wie können in unserer Gemeinde Beziehungen entstehen, bei der tiefes Vertrauen wachsen kann?
- Wem kann man sich anvertrauen – wem besser nicht?
- Wie können wir in unserer Mitarbeit unabhängiger und beständiger werden, gerade angesichts von Menschen, die schnell Zustimmung oder Ablehnung äußern?
4.4 Nikodemus besucht Jesus bei Nacht
(Joh 3,1-21)
Dieser längere Abschnitt kann in drei Abschnitte eingeteilt werden: Einleitung, drei Fragen und drei Antworten und eine umfangreichere Lehreinheit von Jesus.
Nur der Evangelist Johannes nimmt uns mit in die angenehmere Kühle einer orientalischen Nacht, bei der Jesus den wohlhabenden (Joh 19,39) Mann mit dem griechischen Namen Nikodemus[101] zu einem vertraulichen Gespräch empfängt. Der griechische Name des Gastes muss nicht auf eine griechische Herkunft hinweisen, da seit der Zeit der Makkabäer viele Juden auch griechische Namen tragen.
Nikodemus gehört zur Gruppe der Pharisäer, die wahrscheinlich auch während der Zeit der Makkabäer entstand. Seit dem 2. Jh. v. Chr. lehnten sich gottesfürchtige Juden gegen den um sich greifenden Bilderkult griechischen Ursprungs auf. Während der Verfolgungszeit unter Antiochus Ephiphanes standen die chasidim oder Frommen fest zu ihrem Glauben. Diese waren die Vorläufer der Pharisäer (der Abgesonderten), die sich ab ca. 135 v. Chr. etablierten.
Die positiven Absichten der Pharisäer sind:
- Betonung von Gottes verbindlicher Torah (Unterweisung, auch Gesetz)
- Bereitschaft zu einem Leben als Gottes Volk im bewussten Kontrast zu den Völkern der Nachbarschaft
- moralische Verantwortlichkeit des Menschen
- Bereitschaft zum vorbildlichen Lebensstil
- Unsterblichkeit der Seele
- Auferstehung des Leibes
- Existenz von Dämonen
- Hinweis auf Gericht, Strafe und Belohnung am Ende der Tage
So gibt es doch auch die negative Seite:
- Veräußerlichung der Frömmigkeit
- juristisches Denken
- Standesdünkel (ich bin frömmer als die dort)
- Hartherzigkeit gegenüber Leid, Schwäche, Sünde, Stigmatisierte, Ausgegrenzte
- Tendenz: Gerecht wird der Mensch durch seine guten Werke
Jesus findet harte Worte für sie (Mt 5,20; 16,6.11.12; 23,1-39; Lk 18,9-14). Entgegen der heutigen Antipathie sind Pharisäer damals die geachteten Mitbürger eines jeden Ortes. Viel von ihrer Sympathie gewinnen sie durch ihren festen Stand gegen das Herrschaftshaus Herodes. Zu dieser Gruppe gehört Nikodemus – noch dazu zu den leitenden Kreisen, denn er ist ein Mitglied des Hohen Rates (Sanhedrin). Weiter ist er ein professioneller Ausleger und Lehrer des alttestamentlichen Gesetzes. Dieser findet nun angemessen in der Kühle der Nacht, nachdem die Tagesaktivitäten beendet sind, in einer eher ruhigen Stunde seinen Weg zu Jesus.
Nikodemus begrüßt Jesus mit dem Bekenntnis, dass er und andere die ähnlich wie er denken, ihn als wahren Prophet betrachten. Niemand könne schließlich solche Wunder bewirken, als nur ein göttlicher Prophet. Übrigens wissen wir nicht, ob dies Gespräch in Aramäisch oder Griechisch geführt wurde. Wir haben Hinweise, dass beide Gesprächspartner beide Sprachen beherrschen.
Ohne dass Nikodemus irgendein Anliegen vorbringt, berichtet uns der Evangelist Johannes, wie Jesus die Initiative ergreift und die ungestellte Frage beantwortet: „Was muss ich tun um das Reich Gottes zu ererben?“ Diese Frage stellte ja auch der reiche, junge Vorsteher (der Synagoge? Mt 19,16). Die Antwort von Jesus ist ein Rätselwort (mashal), typisch für Rabbis zurzeit von Jesus. Im Griechischen haben wir das Problem, was Jesus mit dem „von oben geboren“ a;nwqen anœthen meint. Es kann „von oben“ bedeuten (Joh 3,31; 19,11; 19,23). Jesus würde damit auf eine „Geburt von oben“ hinweisen. Dennoch hat dieses Wort noch weitere Bedeutungen: aufs Neue, nochmals (Gal 4,9) oder von Beginn, vom ersten (Lk 1,3; Apg 26,5). Da die letzte Bedeutung wegfällt, so hat Nikodemus – und wir heute – die Wahl zwischen zwei Bedeutungen. Sprechen die beiden Gelehrte Aramäisch, so würde die Doppeldeutigkeit dieses einen Wortes wegfallen – dennoch muss sich dann Nikodemus mit dem Argument beschäftigen, dass jeder noch einmal geboren werden muss. Jesus macht damit deutlich, dass weder die natürliche Abstammung von Abraham, noch die kultische Zugehörigkeit zu Gottes erwähltem Volk oder gar die frommen Leistungen der Abgesonderten zur ewigen Errettung genügen. Menschen müssen von oben neu geboren werden, dh. der Heilige Geist pflanzt in das Leben eines Gläubigen dieses Leben, das seinen Ursprung nicht auf der Erde, sondern im Himmel hat. Diese Wende ist so radikal, dass Jesus sie als eine Geburt bezeichnet.
Im weiteren Gespräch wird deutlich, dass Nikodemus diesen Punkt missversteht. Es ist absurd: Ein Erwachsener soll nochmals geboren werden… Niemand kann das – bestimmt kein Alter! Jesus weist jetzt auf die Geburt aus Wasser und Geist hin.
- Ein möglicher Schlüssel für dieses Rätselwort finden wir in Joh 1,22. Dort finden wir beides dicht beieinander: Wasser und Geist. Mit Wasser getauft zu sein ist gut, doch reicht nicht. Das reinigende Werk des Heiligen Geistes muss als Siegel hinzukommen. Beides ist wichtig: das Wasser zu Beginn (Taufe) und dann das fortdauernde Werk der Reinigung durch den Heiligen Geist im Prozess der Heiligung.
- Eine andere Erklärung finden wir in 1Petr 1,23: „Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das lebendige und bleibende Wort Gottes bewirkt die Wiedergeburt. Im Zusammenhang von Eph 5,26 lesen wir von dem reinigenden Wasserbad des Wortes: „…um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort.“ Das Wasser = Wort bewirkt zusammen mit dem Geist das neue Leben.
Jesus wiederholt seine Worte, daraus können wir schließen, dass diese sehr, sehr fremd in den Ohren von Nikodemus klingen.
Das Beispiel vom Wind macht die Souveränität des Heiligen Geistes beim Prozess der Geburt von oben deutlich – niemand kann die Winde dieser Erde lenken oder gar stoppen. So wirkt auch der Heilige Geist unabhängig von uns – immer überraschend, immer wieder aus einer andere Richtung – ohne die Auswirkungen vorhersagen zu können – immer ein Geheimnis! Was für ein komplett anderer Ansatz ist dies für Nikodemus, dem seit frühester Kindheit eingetrichtert wurde, dass Rettung durch vollkommenen Gehorsam gegenüber dem göttlichen Gesetz, also Disziplin, Kontrolle und Selbstbeherrschung möglich sei.
Nikodemus kann dieses verinnerlichte System nicht einfach abstreifen – doch gerade diese Art der Selbsterlösung macht ihn immun für das Wirken des Heiligen Geistes. Jesus spricht ihn darauf höflich als respektierten Lehrer in Israel an, der trotz aller seiner Studien, trotz des Predigten von Johannes dem Täufer und den Predigten von Jesus immer noch nichts „versteht“. Doch das eine „Verstehen“ gewinnt man durch menschliches Reflektieren – das andere „Verstehen“ durch die Nähe zum himmlischen Vater. Jesus spricht hier in der 1. Person Plural: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an.“ Sieht er sich hier mit Johannes dem Täufer in einer Linie? Zumindest Joh 3,5 deutet daraufhin – während Joh 1,7.8.34 direkt auf das Zeugnis durch Johannes den Täufer hinweisen. Während der Bußprediger am Jordan schon eine „harte Nuss“ ist – was ist erst der Sohn eines Bauhandwerkers aus Nazaret, wenn dieser von Wiedergeburt spricht? Wenn der aufrichtige Fromme von der Unmöglichkeit der Rettung durch Gehorsam nicht zu überzeugen ist – wie soll Jesus ihm dann den göttlichen Heilsplan von der Sendung seines Sohnes erklären? Nur er, der Sohn, hat darüber Informationen aus erster Hand. Ihm, den Menschensohn allein haben wir in Bezug auf den göttlichen Plan zur ewigen Erlösung zu vertrauen. Hier nimmt Jesus zu einer recht seltsamen Episode bei der Wüstenwanderung des Volkes Israel Bezug: die erhöhte Schlange aus Metall (4Mo 21). Das murrende Volk (nicht genug Wasser und Brot) wusste sich durch tödliche Schlangebissen der göttlichen Strafe ausgesetzt. Hier war die einzige Rettung die erhöhte Schlange aus Metall, die Mose auf Befehl des Herrn herstellen ließ. Jeder mit dem tödlichen Gift in seinem Körper konnte durch einen Blick auf die Schlange gerettet werden (4Mo 21,8.9). Folgende ähnliche Dinge fallen uns zwischen der erhöhten Schlange und dem erst ans Kreuz und dann zum Vater erhöhten Christus auf:
- der Tod wartet auf die Menschen
- Gott bietet in seiner Barmherzigkeit einen Ausweg an
- der Mensch hat zur Hilfe aufzublicken
- Heilung erfolgt bei jedem mit einem aufrichtigen glaubenden Herzen
Klar geht es im AT um den zeitlichen, bei Jesus dagegen um die Rettung vor dem ewigen Tod; damals ging es um körperliche Heilung, jetzt aber um ewige Heilung; von der Schlange selbst ging keine Kraft aus, dagegen aber von Christus.
Über den goldenen Vers Joh 3,16 selbst, sollte man Seiten schreiben – er ist das Evangelium in Kurzform! Wir hören von:
- Gottes Charakter,
- von Gott als Urheber des Heils
- vom göttlichen Objekt: alle Menschen dieser Welt
- vom göttlichen Geschenk,
- von dem Ziel des Heilsplans!
In Joh 3,17 wird es nochmals deutlich wiederholt: nicht das von Pharisäer erwartete Gericht über die Heiden ist das Ziel des Heilshandeln Gottes (alle Heiden sind ja letztlich nur Feuerholz für die Hölle), sondern Rettung aller! Schon Amos 5,18-20 weist darauf hin, dass das Gericht besonders Gottes Volk hart treffen wird. Gott will alle auf dieser Welt retten – Gott hat kein Gefallen am Strafurteil.
Jesus geht dann noch einen wesentlichen Schritt weiter und antwortet auf den nicht geäußerten Kommentar: „Na ja, keiner kann Gottes Richterspruch am Ende der Tage im Voraus kennen!“ DOCH, wir können es wissen, wenn wir das nächste Mal ans offene Grab treten: Jeder der an Jesus glaubt ist schon gerichtet; jeder der nicht glauben wollte, ist es aber auch schon! Geht es noch eindeutiger? Jesus macht seinen Anspruch am Bild des Lichtes und der Dunkelheit seinem Gesprächspartner Nikodemus deutlich: Er ist das in die Welt gekommene Licht – doch besonders seine fromme Zeitgenossen, lieben die Finsternis mehr als das Licht. Ihre böse Absichten und Taten wären nicht das Problem – die können alle vergeben werden. Doch genau dies ist die Entscheidung lieber Pharisäer:
- entweder Jesus und die Vergebung (auf den Knien am Kreuz) annehmen
- oder aufrecht stehend selbstbewusst die Umkehr ablehnen: Zeige mir was ich falsch gemacht habe!
Die zweite Variante endet in einem fatalen Tunnelblick – das durchaus auch fromme auf den Kopfstellen aller geistlichen Erkenntnis ist die Folge. Die Wahl ist: Selbstrechtfertigung oder Zerbruch am Kreuz. Geht dein Weg zum Licht oder in die Dunkelheit, lieber Pharisäer Nikodemus – so lauten die einladenden Worte von Jesus. Die Antwort muss jeder selbst geben. Für Nikodemus haben wir Hoffnung, da uns sein Verhalten rund um das Kreuzesgeschehen überliefert ist. Nach Joh 19,39 trug er zur ordentlichen Bestattung von Jesus bei. Dies kann in seinem Umfeld als Glaubenstat verstanden werden.
Fragen:
- Nehmen wir uns ausgiebig Zeit für vertraute Gespräche mit Suchenden?
- Wie erkläre ich die Geburt von oben meinem interessierten Zeitgenossen?
- Wie erkläre ich Menschen heute, dass nicht Leistung, sondern ein Geschenk die Heilsgrundlage ist?
- Wie können wir Menschen aus der Dunkelheit ins Licht begleiten?
4.5 Jesus im judäischen Land
(Joh 3,22-4,3)
Jesus verlässt die Stadt Jerusalem und wandert in Judäa umher. Dort bleibt er eine Zeit lang mit seinen Jüngern. Sehr wahrscheinlich ist, dass Jesus Jerusalem in Richtung Osten verlässt. Es ist möglich, dass er sich im Jordantal aufhält. Dort leitet Jesus seine Jünger bei der Taufe an – ohne selbst zu taufen (Joh 4,2). Diese Taufe war wohl im Übergang von der Taufe des Johannes zur späteren „christlichen Taufe“ begriffen – hin zur Taufe auf den dreieinigen Gott (Mt 28,19). Johannes ist parallel zu den Jüngern auch weiterhin in Änon[102] am Jordan aktiv. Da diese Stelle relativ zentral liegt, kommen Menschen aus allen vier Provinzen zu Johannes dem Täufer. Doch der Zustrom wird dünner – mehr und mehr Menschen zieht es zu Jesus. Hier wird deutlich, dass zwischen der Versuchung von Jesus und der Inhaftierung von Johannes dem Täufer, also zwischen Mt 4,11 und 12 (ebenso Mk 1,13 und 14; Lk 4,13 und 14) eine erhebliche Zeitspanne liegt, während der beide aktiv sind.
Die schwindende Popularität bereitet den Johannesjüngern Probleme. Folgendes fällt auf beim Gespräch der Johannesjünger mit ihrem Meister auf:
- Die von Eifersucht geplagten Jünger vermeiden den Namen Jesus auszusprechen
- Es klingt so, als seien sie nicht zu begeistert über das Zeugnis des Täufers in Bezug auf Jesus
- Sie übertreiben wohl ein wenig, wenn sie sagen alle würden zu Jesus gehen.
Der Evangelist Johannes macht seinen Lesern in Kleinasien klar, dass es grundsätzlich falsch ist, Johannes den Täufer über Jesus zu stellen. Er berichtet uns die Antwort des Täufers, dass niemand etwas erhält, es sei denn, es sei ihm von oben gegeben – hier besonders die Gunst des Volkes. Nochmals betont Johannes der Täufer, dass er nur der Vorläufer von Jesus ist – Jesus aber und das Volk vergleicht er mit einem Bräutigam und einer Braut. Bei diesem Bild sieht sich Johannes der Täufer als bester Freund von Jesus, der sich freut die Stimme des Bräutigams zu hören. Richtig – Johannes sagt, dass seine Freude zunimmt, wenn er hört, dass mehr und mehr Menschen sich Jesus zu wenden. Matthias Grünewald hat dies Szene gemalt und im Museum Unter Linden in Colmar kann man das Zentralbild des Isenheimer Altarbildes anschauen: Johannes mit dem überlangen Finger, der auf den gekreuzigten Schmerzensmann Jesus zeigt. Daneben schrieb der Maler in lateinischer Schrift: „Er muss wachsen, ich aber abnehmen (Joh 3,30). Johannes weiß um seine irdische Herkunft im Gegensatz zur himmlischen Herkunft von Jesus. Nur Jesus kann unmittelbar vom Himmel reden – aus eigener Anschauung und Erfahrung. Jeder der den Anspruch von Jesus der Sohn Gottes zu sein im Glauben annimmt, der sagt damit auch, dass Gott im Himmel die Wahrheit sprach, als dieser sagte: „Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe“ (Lk 3,22).
Dann macht es der Evangelist mit den Worten des Täufers sehr klar: In Fragen des Heils hängt alles am Sohn! Es gibt seit dem die Wahl zwischen Leben oder Zorn Gottes (Joh 3,35). Diese deutlichen Worte von Johannes dem Täufer, die wachsende Popularität und die zunehmende Ablehnung durch die religiöse Elite in Jerusalem weisen auf die drohende Krise hin. Jesus kennt den Heilsplan seines Vaters und betrachtet diese Krise als vorzeitig – noch ist sein Werk nicht vollendet, um das letzte Mal nach Jerusalem hinaufzugehen. Deshalb verlässt er Judäa und wandert wieder nach Galiläa.
Fragen:
- Wie erleben wir Neid oder Eifersucht im Rahmen des Gemeindelebens?
- Wie können wir beweisen, das Eifersucht und/oder Neid im Rahmen der Zusammenarbeit der Kirchen uns nicht plagen?
- Wie erklärst du dir die Freude des Johannes an der eigenen schwindenden Popularität?
4.6 Gefangennahme des Täufers
(Mt 14,3-5; Mk 6,17-20; Lk 3,19-20)
Herodes Antipas ist der Herrscher von Galiläa (westlich des Jordans und des Sees Gennesaret) und dem südöstlichen Peräa von 4 (1) v.Chr. bis 39 n. Chr. Seine Residenz in Peräa hatte er in Machärus, dem Ort der traditionell für den Ort des Martyriums von Johannes dem Täufer gehalten wird.
An dieser Stelle führt uns er Evangelist Johannes zurück zum tragischen Ende des Täufers. Josephus berichtet uns von der Angst des Vierfürsten[103] seine Macht über das Volk zu verlieren, angesichts des großen Einflusses von Johannes dem Täufer (Ant. XVIII 5,2). Jede Aktion gegen ihn – besonders eine schnelle Hinrichtung – kann in eine Rebellion des Volkes münden. Da Johannes allerdings öffentlich die Eheschließung des Herodes mit Herodias kritisiert, ist die Inhaftierung die mildeste mögliche Reaktion. Herodias war die Tochter von Aristobul und damit eine Enkelin von Herodes dem Großen. Sie hatte ihren Halbonkel (den Halbbruder ihres Vaters) geheiratet: Herodes Philippus I. (Sohn von Herodes dem Großen durch Mariamne II.). Aus der Ehe mit Herodes Philippus ging eine Tochter hervor, die Josephus mit dem Namen Salome benennt (Anti. XVIII.136).[104] Um die Sache noch etwas komplizierter zu machen: Salomes Mutter Herodias hatte einen Bruder der später König Herodes Agrippa I. wurde.
Bei einem Besuch von Herodes Antipas bei Herodes Philippus wurden er und seine Schwägerin Herodias ein illegitimes Liebespaar. Doch die beiden vereinbarten die Trennung von ihren rechtmäßigen Partnern um zu heiraten. Dies gelang ihnen. Als Johannes der Täufer von diesen Vorgängen hörte, schalt er öffentlich seinen Fürsten, denn dies war Blutschande (3Mo 18,16; 20,21) und Ehebruch (Röm 7,2.3). Diese herbe Kritik galt natürlich genauso der Herodias. Diese beschloss daraufhin nach damaliger „Gutsherrenart“ Rache – seinen Tod. Herodes Antipas war hier wohl zurückhaltender (Mk 6,20). Dies erklärt den längeren Gefängnisaufenthalt von Johannes dem Täufer wahrscheinlich in einer tiefen Grube in der Residenz Machärus. Doch dies macht Johannes noch populärer. Das Volk hält Johannes mehr und mehr für einen Propheten – Propheten zu töten hat zwar eine lange Tradition in Israel, aber in unruhigen Zeiten wie Herodes Antipas sie erlebt, ist es unklug Märtyrer zu schaffen. Während der Gefangenschaft suchte Herodes wiederholt das Gespräch mit Johannes (Mk 6,20). Trotz der unerhörten Kritik an seinem Eheleben hörte er gerne auf die Worte des Täufers.
Frage:
- Warum ist Angst ein schlechter Ratgeber?
- Sollen wir Ungläubige auf ihr ethische Fehlverhalten ansprechen?
- In welchem Bereich sollten Väter und Mütter Vorbilder sein?
4.7 Jesus in Samarien am Jakobsbrunnen
(Joh 4,4-42)
In Joh 4,1 wird beschrieben, wie Jesus und seine Jünger Judäa verlassen – dies wird wohl auch in Mt 4,12 beschrieben. Die Gefangennahme des Johannes kann kurz vorher erfolgt sein und die Rückkehr von Jesus nach Galiläa ausgelöst haben (Mt 4,12; Mk1,14a).
In Joh 4,4 wird betont, dass Jesus durch Samarien reisen muss. Wenn er sich in der Nähe des Jordans, also in der Jerichogegend aufhielt, dann bedeutet das Wort „muss“ eher einen göttlichen Auftrag. Denn eine Reise durch das bergige Samaria war auf dem Weg nach Galiläa ein erheblicher Umweg. Die Samariter sind seit der Eroberung durch die Assyrer im Jahre 722 (721) v. Chr., der Deportation vieler Juden und der Ansiedlung verschiedener besiegter Völker ein Mischvolk. Bis heute ist eine Gruppe der Samariter in Israel erhalten geblieben. Sie haben seit den Tagen von Nehemia und Esra eine eigene religiöse Tradition, besonders hinsichtlich des Gebetsortes – dies ist der Berg Garizim – und der heiligen Bücher, dies sind nur die fünf Bücher Moses.
Der Berg Garizim liegt in der Nähe der Stadt Sychar (Sichem). Die Juden meiden die Samariter und benutzen lieber den längeren Weg durch das Jordantal auf ihren Reisen zwischen Galiläa und Judäa. Auch gab es in den Jahrhunderten vor Christus immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Samaritern und Juden. Vor diesem historischen Hintergrund bekommt der Aufenthalt von Jesus am Jakobsbrunnen[105] seine besondere Bedeutung. Übrigens ist es eigentlich falsch von einem Brunnen zu sprechen, es ist eine Quelle. Die Jünger von Jesus gehen alle in die Stadt, um Brot zu kaufen. Ob sie sich aus Angst als ganze Gruppe in eine fremde und feindlich gesonnene Stadt aufmachen? Jesus bleibt allein (wahrscheinlich auf eigenen Wunsch) am Brunnenrand sitzen, denn der Evangelist Johannes fügt hier an, dass Jesus von der Reise müde ist (Joh 4,6). Der Evangelist Johannes will mit seinem Evangelium zum Glauben an den Gottes Sohn führen. Wenn er hier allzu menschliche Details einfügt, ist dies bedeutungsvoll: Gottes Sohn war ein müder Mensch. Die Zeitangabe deutet auf 12 Uhr mittags hin – was vom Frühjahr bis Herbst die Zeit der Mittagshitze und -ruhe ist.
An den Brunnen kommt um diese ungewöhnliche Zeit eine a) samaritische b) Frau – beide erkennen die Gesprächshindernisse sofort. Denn zwei Gründe kommen zusammen, die das Gespräch normalerweise verhindert hätten: a) Samariter und Juden sind nun wirklich nicht für ihre gepflegte gemeinsame Gesprächskultur bekannt; b) ein Rabbi spricht normalerweise eine alleinkommende Frau nur in der Not oder mit zweideutigen Absichten an. Jesus hat wohl kein Schöpfgefäß bei sich und bittet daher diese Frau um Wasser. Doch diese Bitte ist so ungewöhnlich, dass die überraschte Frau eine Begründung für diesen Tabubruch verlangt. Dies führt zu den Erklärungen von Jesus in Bezug auf die Gabe Gottes. Hier und auch in der Apostelgeschichte ist die Gabe (das Geschenk) Gottes immer der heilige Geist. In Apg 7,37-39 finden wir die hier anklingende enge Beziehung zwischen Wasser und Geist wieder. Diesen Geist kann nur Jesus schenken.
Hätte die Frau gewusst, dass ihrem Gesprächspartner die Macht verliehen war, auch ihr solch ein Geschenk zu machen, hätte sie ihn darum gebeten: lebendiges Wasser (im Gegensatz zum Wasser des alten Gesetzes Spr 13,14; Jer 17,13; Sach 14,8). Doch dieses Rätselwort verstehen selbst wir heute nach Pfingsten schwer, wie viel schwerer war es für diese Frau. Im weiteren Gespräch geht es um manches Missverständnis. Zum einen ist das Wasser schwer zu schöpfen, dann geht es um die Bedeutung des Stammvaters Jakob, der diesen Brunnen grub, dann um das Wasser im geistlichen Sinn, dass zum ewigen Leben führt. Jesus sieht mit Scharfblick die geistliche Not der Frau. Doch zunächst versteht sie dies nicht, da sie beim natürlichen Wasser und der Aussicht nie wieder zum Schöpfen kommen zu müssen verbleibt.
Doch Jesus wird in diesem ungewöhnlichen Vieraugengespräch persönlich. Unvermittelt fordert er die Frau auf, ihren Ehemann zu holen. Die bedrückende Realität ihres Alltags wird Gegenstand des Gesprächs. Jesus erkennt das typisch orientalische Geständnis an, obwohl es uns ausweichend erscheint. Die Antwort der Frau ist aber für die Gesprächssituation schon recht mutig. Die Frau war fünf Mal verheiratet und wusste sich von Jesus in der Tiefe ihrer Not erkannt. Jesus konfrontiert sie mit ihrer Vergangenheit und Gegenwart. Dabei gesteht Jesus ihr zu, dass sie aus tiefen Herzen die Wahrheit spricht: „… ich habe keinen Mann!“ (V. 18). Jesus gibt der Frau recht, dass auch ihre aktuelle Beziehung zu einem Mann ihr keinen Schutzraum und legalen Status gibt. Die Frau merkt jetzt, dass sie nicht einen der üblichen männlichen Ankläger vor sich hat. Die fanden gewöhnlich aus ihrer männlichen Sicht des Lebens viele Anklagepunkte. Doch hier geht es diesem fremden Mann offensichtlich nicht um Spott, Vorurteil, Anklage oder Verurteilung!
Sie kommt zum Schluss, dass er ein Prophet sein muss. Angesichts dieser Erkenntnis kommt sie auf ein weniger persönliches Thema zu sprechen. Da Jesus darauf eingeht, wollen auch wir es nicht als plattes Ausweichmanöver einstufen. Es geht um den alten Streitpunkt zwischen Samariter und Juden. Ist der rechte Gebetsort der Berg Garizim oder Jerusalem. Doch Jesus spricht an diesem Tag viel in Rätselworten. Er verweist auf eine Zeit, wo nicht der Ort, sondern die geistliche Einstellung wesentlich sein wird. Der Evangelist Johannes reflektiert die Worte von Jesus in recht schwieriger Weise, aber dennoch wird klar, dass der Beter mit dem angebeteten Gott wesensmäßig übereinstimmen muss: Gebet ist ein geistliche Sache zu einem geistlichen Gott – nie etwas Äußerliches. Als die Frau von diesem Punkt auf den erwarteten Messias zu sprechen kommt, wird deutlich, dass sie die Schriften der Juden kennt. Denn es ist unklar in wieweit die Samariter auf den Messias hoffen, da dieser in den fünf Mosebücher nicht zu erkennen ist. Ein kommender Prophet ist allerdings aus 5Mo 18,15 erkennbar.
Die einprägsamen Worte von Jesus überliefert uns der Evangelist: evgw, eivmi egœ eimi „ich bin es…“ (Joh 4,26). Während die Synoptiker noch zurückhaltend vom Messiasanspruch berichten, ist hier Johannes freimütig und berichtet uns von diesen wesentlichen Worten des Vieraugengesprächs, die ja auch ihm nur überliefert worden sind. In Judäa wäre dies eine politische Aussage gewesen, die als Hochverrat gesehen und mit dem Tode bestraft worden wäre. Jesus mutet dieser Frau den Blick in tiefe theologische Zusammenhänge zu. Trotz vieler Missverständnisse, Ausweichargumente und dem Blick in ein bedrückendes Privatleben war diese Frau für das Gespräch vorbereitet.
Die Rückkehr der Jünger von ihrer Shopping-Tour hat sofort eine doppelte Wirkung:
- die Jünger staunen, als sie ihren Meister in einem tiefsinnigen Gespräch mit einer einzelnen Frau finden und bieten ihm recht verlegen etwas zu essen an.
- die Frau lässt ihren Krug stehen, eilt in ihre Stadt und berichtet von ihrer Begegnung mit einem Propheten, der ihre Vergangenheit ohne Beichte kannte.
Die Frau formuliert: „Ist dieser nicht der Christus?“ Damit weckt sie das Interesse des Ortes und lädt alle ausdrücklich zu einer Jesusbegegnung ein (V. 29). Jesus ist noch ganz von der Tiefe des Gesprächs angetan, so dass er die verlegene Bitte der Jünger, doch zu essen mit einem tiefsinnigen Gespräch über die geistliche Speise fortsetzt. Der Evangelist betont damit, dass sich Jesus seiner Sendung sehr bewusst ist. Die Ernte seiner Worte zu einer Frau würde bald sichtbar werden. Dies ist auch der Auftrag der Jünger. Andere haben schwer gearbeitet, bevor die Ernte eingefahren werden kann. Hier steht im Grundtext das Verb kopia,w kopiaœ hart arbeiten, sich müde arbeiten. Die anderen sind diejenigen, die Christus und seitdem den Jüngern zu allen Zeiten den Weg bereitet haben. Die Ernte an diesem Tag sind die vielen Samariter aus Sichem/Sychar die an Jesus glauben. Jesus bleibt zwei weitere Tage in dieser geistlich so vorbildlichen Stadt. Der Glaube dieser Menschen richtet sich dabei nicht auf das Glaubenszeugnis einer Frau, sondern auf die Worte von Jesus. So findet Jesus ohne eine spektakuläre Heilung oder durch ein außergewöhnliches Naturwunder Glauben in Samaria.
Fragen:
- Wie verhalten wir uns in ungewöhnlichen oder peinlichen Gesprächsituationen?
- Wie können wir den rechten Anknüpfungspunkt finden (hier die Bitte um Wasser)? Wie kann das „Eis“ gebrochen werden? Wie können Augen geöffnet werden?
- Wie erfahren wir die Leitung des Heiligen Geistes in einem evangelistischen Gespräch?
- Wie können wollen wir auf Nebenargumente oder gar Ausweichargumente eingehen?
- Wie können wir bewusst machen, dass andere vor uns im geistlichen Ackerfeld hart gearbeitet haben?
- Sind wir als Gemeinde für die geistliche Ernte vorbereitet?
Veröffentlicht unter UNTERWEGS MIT JESUS
Kommentare deaktiviert für 4. Kapitel: Der erste Jerusalembesuch
3. Kapitel: Jesus in Galiläa
Kapitel 3: Jesus in Galiläa

Abbildung 1 Von der Anhöhe Gadara am Südufer des Jarmuk reicht der Blick weit über den See Genezaret, die Berglandschaft von Galiläa und den Golanhöhen (Dekapolis) (Foto: 3. November 2014).
Mit dreißig aus- und weggezogen
Warum verlässt Jesus seine Vaterstadt Nazareth?
Als Jesus vom Jordan nach Galiläa zurückkehrt, kommt er in Begleitung seiner ersten Jünger, als erstes nach Nazareth in seine Heimatstadt. Aber dort hält er sich nicht mehr lange auf, Vielleicht ist der Entschluss, von Nazareth wegzuziehen, bereits schon früher gereift und hat sich am Jordan gefestigt. Die Gründe für den Wegzug können vielseitig gewesen sein:
- Die Stadt Nazaret war ein kleiner, unbedeutender Ort. Er war sehr gut geeignet, dass Jesus dort sozusagen im Verborgenen aufwachsen konnte. Für den Beginn seines öffentlichen Wirkens und als Ausgangsbasis war er ungeeignet.
- Die Nazarener kannten Jesus von seiner Kindheit und wären ein Hindernis gesesen für seinen Dienst, wie der spätere Besuch in seiner Heimatstadt deutlich macht (Lk 4,16ff).
- Die Tatsache, dass ein Prophet in seiner Heimatstadt nichts gilt, wurde von Jesus selbst bezeugt (Joh 4,44).
- Die leiblichen Brüder von Jesus glauben in der Anfangszeit noch nicht an ihn als den Messias (Joh 7,5) und wären in Nazaret für seinen Dienst eher ein Hindernis gewesen (Mk 3,21).
- Die familiäre und auch räumliche Loslösung von Maria seiner Mutter ist zusätzlich wichtig gewesen, wie die Episode in Kana kurz darauf zeigt (Joh 2,5). Ähnlich der spätere Versuch seiner Familienangehörigen, ihn in Schranken zu weisen (Mk 3,21). Sehr stark war damals der Einfluß der Mutter auf ihren Sohn.
- Nicht zuletzt war sein Wegzug aus Nazaret heilsgeschichtlich begründet (Mt 4,12-16).
So verlässt Jesus ganz bewusst seine Heimatstadt Nazaret, in der er seine Kindheit und sein Erwachsenwerden erlebte und wird erst viele Monate später hier einen Besuch abstatten (Lk 4). Wie wir aus Johannes 2,1 erfahren, hatte Jesus und seine Familie eine offizielle Einladung zu einer Hochzeit im Galiläischen Kana (Joh 2,1ff). Nachdem wir uns im nächsten Abschnitt mit den zeitlichen Aspekten des Umzugs beschäftigt haben, begleiten wir Jesus nach Kana und anschließend hinab nach Kapernaum.
Die zeitliche Einordnung des Umzugs
Aus Matthäus 4,12 und Markus 1,14 geht hervor, dass Johannes der Täufer recht bald nach der Versuchung von Jesus in der Wüste und vor dessen Rückkehr nach Galiläa, gefangen genommen wurde. Der Evangelist Johannes erwähnt die Versuchungsgeschichte von Jesus nicht. Aus Johannes 4,1-3 erfahren wir, dass Johannes der Täufer nach der Versuchung von Jesus noch eine längere Zeit in der Jordangegend in Freiheit wirkte und taufte. Zwischen der Versuchung von Jesus und der Gefangennahme des Täufers liegt also die Zeit der ersten Wirksamkeit von Jesus in Galiläa und Judäa. In dieser Zeit besucht er zum ersten Mal nach seinem öffentlichen Auftreten Jerusalem und wirkt anschließend in Judäa (Joh 2 und 3).
Die Synoptiker berichten insgesamt nur von einem Jerusalembesuch von Jesus und zwar anlässlich seiner Passion.
Das Wort `Synopse` bedeutet Zusammenschau. Die drei Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas haben eine ähnliche Schau und Aufbau ihrer Berichte, deshalb werden sie die `synoptischen` Evangelien bezeichnet – Griechisch: `συνόψις – synopsis – das Ganze zusammen sehend`. Johannes hat eine andere Zielsetzung und wiederholt nur selten Ereignisse, welche die Synoptiker aufgezeichnet haben Alle Evangelisten haben Zielgruppen vor Augen; Matthäus: Juden; Markus: Heidenchristen; Lukas: griechisch-römische Bildungsbürger (Theophilus Lk, 1,1-3) und Johannes: Christen aus dem griechischen Kulturkreis.
Entgegen den Synoptikern erwähnt der Evangelist Johannes mindestens drei Passahfeste (Joh 2,13; (5,1?) 6,4; 12,1) und fünf Besuche in Jerusalem (Joh 2: 5: 7: 11: 12). Die Synoptiker berichten von nur einer Rückkehr von Jesus aus Judäa nach Galiläa, Johannes dagegen von drei (Joh 1; 4; 5). Demnach ist der Satz: „Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, entwich er nach Galiläa (…)“ (Mt 4,12), chronologisch erst nach dem ersten Jerusalembesuch von Jesus einzuordnen (Joh 4). Da in den synoptischen Berichten Jesus nur einmal von Judäa nach Galiläa kommt, schrieben sie diese Aussage aus thematischen Gründen gleich zu Beginn auf (Mt 4,12; Mk 1,14; Lk 4,14).
Es ist auch für uns, die wir diese Texte verfassen, eine Herausforderung, die relativ vielen synoptischen Berichte und Ereignisse aus der Wirksamkeit von Jesus in Galiläa, in die etwa dreieinhalb Jahre dauernde Wirksamkeit von Jesus, chronologisch einzuordnen. Da Johannes uns keine exakte Chronologie und Dauer der Wirksamkeit von Jesus gibt, kann die Erwähnung von mindestens drei Passahfesten (Joh 2; (5,1?) 6; 12) auch als Mindestzahl angesehen werden.
Die von uns erstellte Chronologie ist darum auch nur ein Vorschlag, wie Texte chronologisch gelesen werden können, um so einen umfassenderen und geordneteren Überblick über das Leben und den Dienst von Jesus zu erhalten.
Fragen / Aufgaben:
- Was waren die Gründe für den Wegzug aus Nazaret?
- Wie begründen wir, dass der offizielle Umzug von Nazaret nach Kapernaum dem Hinabgehen nach Kapernaum in Lukas 4,31 voranging?
Jesus auf einer Hochzeit – Freude in Fülle
(Bibeltext: Joh 2,1-12)
Auf dem Weg hinab nach Kapernaum besucht Jesus das Galiläische Kana. Aus folgenden Gründen ordnen wir den Bericht vom Besuch einer Hochzeit in Kana hier ein:
- Es ist der Anfang der Zeichen, die Jesus tat (Joh 2,11).
- Gleich danach geht er hinab nach Kapernaum (Joh 2,12; ähnlich in Mt 4,13).
Jesus ist mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern auch zur Hochzeit eingeladen. So berichtet der Evangelist Johannes:
Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt’s dem Speisemeister! Und sie brachten’s ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam – die Diener aber wussten’s, die das Wasser geschöpft hatten –, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben nur wenige Tage dort. (Joh 2,1-12 – LÜ 2017).
Es scheint mehrere Orte Namens Kana gegeben zu haben. Bereits bei der Landverteilung wird ein Ort Namens Kana erwähnt und zwar im Grenzgebiet des Stammes Asser (Jos 19,28). Jenes Kana liegt etwa acht Kilometer südöstlich von Tyrus im heutigen Libanon. Seit der Kreuzfahrerzeit bis Ende des 16. Jh. wurde Chirbet Kana (Ruine Kana), 14 Kilometer nördlich von Nazaret, als das biblische Kana anerkannt. Es liegt auf einem Ruinenhügel am Nordende der Battof-Ebene (Asochis-Ebene). Grabungen/Vermessungen aus dem Jahre 1982 ergaben, dass der Ort bereits im 12. Jh. v. Chr. besiedelt war. Auf dem Ruinenhügel wurden 31 Wasserzisternen entdeckt.
Den Israelreisenden, die Nazaret besuchen, zeigt man heute mit Vorliebe das Dorf Namens Kafr Kenna, als den Ort des Weinwunders. Er liegt etwa acht Kilometer nordöstlich von Nazaret entfernt, auf dem Weg nach Tiberias. Seit die Franziskaner Ende des 19. Jh. in dem Ort eine Kirche errichteten (auszugsweise aus „Auf den Spuren Jesu“ Gerhard Kroll 1988, 79).
Dadurch wurde der Pilgerstrom hierher gelenkt. Unzählige Tonkrüge werden in diesem Dorf hergestellt und an Pilger und Touristen verkauft. Der Ruinenhügel Kana steht so gut wie nicht mehr in den Reiseangeboten der Anbieter für Israelreisen.
Das Wunderzeichen in Kana ist in einen besonderen Rahmen eingefasst. In Johannes 2,1 heißt es: „Aber am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa“. Wie schon oben erwähnt sind Zeitangaben im Johannesevangelium oft weiter zu fassen. So ist hier nicht der dritte Tag in Folge gemeint, sondern der dritte Tag der Woche.
Der übliche Wochentag für die Hochzeit war meist in der Wochenmitte – konkret eine Jungfrau heiratete man am Mittwoch, eine Witwe am Donnerstag (Edersheim 1979, 344).
Es war aber auch der Dienstag als Hochzeitstag beliebt, da Gott am dritten Schöpfungstag zweimal gesagt hatte: „Es ist gut“ (1Mose 1,10-12). Hochzeitsfeiern fanden spätestens am Sabbatbeginn (Freitagabend) ihr Ende.
Warum Jesus nach Kana kommt, könnte mehrere Begründungen haben:
- Zum einen ist es sein ausgesprochener Plan in so vielen Städten und Dörfern Galiläas wie nur möglich zu predigen (Mk 1,38-39).
- Zwei seiner Jünger kommen aus Kana: Nathanael (vgl. Joh 1,45 mit 21,2) und Simon der Eiferer (Mt 10,4; Lk 6,15). Es könnte sich also auch um eine Einladung von Nathanael gehandelt haben.
- „Jeder jüdische Rabbi hätte die Einladung zu einer Hochzeit angenommen.“ (Edersheim 1979, 355).
- Noch ein Grund könnte eine vermutete Verwandtschaftsbeziehung Marias zur Hochzeitsfamilie gewesen sein, denn nicht nur Jesus, als bereits bekannter Rabbi, sondern die ganze Familie war eingeladen. Maria scheint bei der Familie des Gastgebers „zu Hause“ zu sein und ergreift darum später die Initiative.
Seit Beginn des öffentlichen Auftretens von Jesus (Taufe, Versuchung, erste Jünger am Jordan) wird Josef von den Evangelisten nicht mehr erwähnt, daher liegt die Vermutung nahe, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr lebte.
In Kana wirkte Jesus sein erstes Zeichen, wörtlich: „Dies ist der Anfang der Zeichen“. In Apostelgeschichte wird diese Reihenfolge bestätigt mit den Worten: „Zu tun und zu lehren“ (Apg 1,1f). Das Tun, die Tat ist vorangestellt. Jesus beginnt seinen Dienst mit einer Tat, mit einem Wunder. In der Beziehung von Jesus zu seiner Mutter Maria ist zu diesem Zeitpunkt eine Veränderung eingetreten. Nach der Taufe am Jordan und dem Verlassen seiner Familie in Nazaret unterstellt sich Jesus ausschließlich der Leitung seines himmlischen Vaters.
Aus der Sicht des Evangelisten Johannes ist dies auch nicht verwunderlich – bezeichnet sich Jesus selbst im übertragenen Sinn doch auch als Bräutigam der Braut (Joh 3,29; Offb 19,7), das ist die Gemeinde.
Jesus macht im Laufe des Festes Wasser zu Wein. Wenn wir das nahe liegende Hohlmaß (μέτρητας – metr¢tas = hebräisch: bath) der Stadt Sepphoris als Einheit zu Grunde legen, dann wird bis zu 660 Liter Wasser zu Wein. Man sollte aber auch bedenken, dass zu solchen Hochzeitsfesten meist sehr viele Menschen eingeladen wurden und die Feiern oft mehrere Tage andauerten.
Schon hier wird deutlich: der Vater im Himmel und Jesus wollen schon beim ersten Wunder reichlich geben. Trotz mancher Bedenken – Jesus gab den Wein zur Freude des Festes. Doch zu Recht dürfen wir hinter diesem ersten Wunder weitere Botschaften von Jesus suchen. Der Evangelist Johannes verwendet das Wort Zeichen `σημείον – s¢meion` häufig. Die Zeichen sind Hinweise auf den Messias in seinen vielschichtigen Eigenschaften und Diensten. Jesus der reichlich im Bereich der irdischen Dinge gibt – wird sicher noch reichlicher im Bereich der geistlichen Dinge geben. Jesus, der aus irdischen Engpässen während einer Hochzeitsfeier heraushilft, wird sicher auch im Bereich der geistlichen Engpässe heraushelfen. Der Bedarf wird über die Maßen gedeckt.
Neben der Fülle und der Freude wird der tiefere Sinn dieses Wunders in der Bedeutung des Weines in der Bibel zu suchen sein. So ist Wein im Alten Testament u.a. positiv mit Freude verbunden (z.B. Ps 104,15; Pred 9.7) – allerdings genauso häufig steht er für Not und Gericht (z.B. Ps 75,9; Spr 20,1).
Der Weinstock, die Reben, der Traubensaft und der Wein spielen in der Heilsgeschichte eine besondere Rolle:
- 1Mose 14,18-19 „Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn (den Abraham).“
- 1Mose 49,11-12 „Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin Füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut.“
- 2Mose 29,40 „Und zu dem einen Schaf einen Krug feinsten Mehls, vermengt mit einer viertel Kanne zerstoßener Oliven, und eine viertel Kanne Wein zum Trankopfer.“ Ähnlich auch in 4Mose 28,7.
- Jes 5,1 „Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe.“
- Joh 6,51-55 „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten: Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am Jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank.“
- Mt 26,26-29 „Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach’s und gab’s den Jüngern und sprach: Nehmet, esset; das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus; das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich.“ (Vgl. auch Lk 22,18).
Neben der Teilnahme von Jesus an der menschlichen Freude einer Hochzeit und der Demonstration der Großzügigkeit, hat das Weinwunder in Kana eine geistliche Dimension. Es weist auf das Dienstende von Jesus hin – auf das letzte AT-Passah-Mahl und erste NT-Abendmahl das Jesus mit seinen Jüngern gehalten, bzw. eingeführt hat. Die Jünger scheinen den noch sehr verschlüsselten Hinweis auf den Messias zu verstehen, denn von ihnen heißt es: „Und seine Jünger glaubten an ihn“ – als den Messias! (Joh 2,11).
Die Anrede an seine Mutter: `γύναι – gynai ` „Frau was [habe] ich mit dir [zu tun]“ (Joh 2,4) war in Bezug auf die Wortwahl „Frau“ in keiner Weise unhöflich (siehe Joh 19,26). Allerdings macht Jesus hier deutlich, dass Maria in Bezug auf Jesus nicht mehr nur in der Kategorie der Mutter-Sohn Beziehung denken darf, auch wenn dieser sich so lange Maria ganz normal unterordnete. Die eckigen Klammern im Zitat verdeutlichen die sehr knappen Worte, die Jesus hier aussprach. Die Aussage: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen“ verdeutlicht, dass Jesus seine „Mission“ im Detail kennt. Seine Mutter versteht dieses sehr knappe Gespräch positiv und gibt darum entsprechende Anweisung an die Diener (hier Diakonoi): „Was er euch sagt, das tut“. Wie schön das Verhalten von Maria – sie lenkt die gesamte Aufmerksamkeit von sich weg und hin auf Jesus. Und Jesus gibt den Tischdienern eine sehr ungewöhnliche Anweisung. Diese ist zweiteilig:
- „Füllt die Wasserkrüge mit Wasser“. Anscheinend ist nicht nur der Wein ausgegangen, sondern auch die vorhandenen Wasservorräte in den steinernen Krügen. Und sie füllten sie bis oben, also randvoll. Noch geschah nichts ungewöhnliches.
- „Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister“. Dieser war für das gesamte Fest verantwortlich, wie sein griechischer Titel `αρχιτρικλίνος – architriklinos` deutlich macht, also der oberste Chef über den Bereich Versorgung. Die Diener schöpften und brachten es dem Speisemeister. Dieser kostet den Wein, nicht wissend, woher er ist und staunt nicht wenig über dessen hervorragende Qualität. Die Diener, selbst noch voller Staunen über dieses Wunder, scheinen ihrerseits auch noch Freude daran zu haben, ihrem Vorgesetzten die entsprechenden Informationen vorerst nicht mitzuteilen. Warum denn auch, sie werden doch gar nicht gefragt. Nachdem jedoch der Speisemeister den Bräutigam kontaktiert hatte, mussten wohl die Diener den Gesamten Vorgang erzählt haben. Jesus handelt sehr weise – er bezieht Menschen (die Diener, den Speisemeister, den Bräutigam) in das Heilsgeschehen mit ein. Er lässt sie teilhaben nicht nur an seinen Gaben, sondern auch an deren Austeilung.
Das wichtigste Ergebnis dieser Offenbarung des Messias durch sein schöpferisches Handeln an diesem Tag ist – „seine Jünger glaubten an ihn“. Es ist noch nicht das Vollmaß des Glaubens, aber der klare und eindeutige Beginn des Vertrauens in diesen Mann, den der Täufer Johannes so eindrücklich dem Volk am Ufer des Jordan als Messias bezeugt und vorgestellt hatte.
Von Kana aus zieht Jesus hinab nach Kapernaum. Schon seit der Abreise von Nazaret wird er von seiner Familie und seinen Jüngern begleitet, die mit ihm nun auch nach Kapernaum weiterwandern. In Kapernaum nimmt Jesus seinen Wohnsitz, wie oben beschrieben. Johannes macht hierzu eine Zeitangabe: „Danach zog Jesus hinab nach Kapernaum, er seine Brüder, seine Mutter und seine Jünger und blieb nicht viele Tage daselbst“ (Joh 2,13). Nicht viele Tage, kann heißen, etwa 10 Tage (vgl. Apg 1,5). Es fällt beim Evangelisten Johannes auf, dass er mit dem überleitenden Wort „danach“ nicht auf einen lückenlosen chronologischen Bericht hinweist, sondern einen weiteren Bericht oder Abschnitt einleitet (vgl. dazu den Übergang von 4,43 zu 5,1). So kann auch hier zwischen 2,12 und 2,13 ein längerer Zeitraum liegen – in diesem Fall die gesamte erste Wirkungsperiode in Galiläa mit regelmäßiger Rückkehr nach Kapernaum. Hier wird lediglich der erste kurze Aufenthalt in Kapernaum unterstrichen, welcher etwa 10 Tage dauerte. Während dieser Zeit wirkte Jesus die ersten der in den synoptischen Evangelien beschriebenen Wunder.
Fragen / Aufgaben:
- Forsche nach Informationen über die Stadt Kana?
- Beschreibe die Hochzeitsfeier im jüdisch-kulturellen Umfeld. Die freie Wahl auf Seiten des Mädchens war eher selten 1Mose 24,8. Liebeshochzeiten waren eher ungewöhnlich im AT – aber wir finden sie: 1Mose 29,20; 34,3; Ri 14,1.2; 1Sam 18,20).
- Wer war zu der Hochzeit eingeladen? Welche Stellung hat hier Maria? Wie war ihr Verhältnis zu Jesus?
- Ist das Eingreifen von Maria in die Notsituation und ihre vermittelnde Rolle in diesem Fall ausreichender Grund für ihre Stellung in manchen Kirchen als Vermittlerin?
- Warum wird dieses Wunder als Zeichen so hervorgehoben? Welche Ableitung dürfen wir für unsere Festbesuche wagen?
- Wie erklären wir die Reaktion der Jünger auf dieses Zeichen?
Jesus lässt sich in Kapernaum nieder
(Bibeltexte: Mt 4,13-16; 9,1; Joh 2,12; Mk 1,16)
Der Evangelist Johannes schreibt im Anschluss an den Besuch im Galiläischen Kana: „Danach zog er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben nicht viele Tage dort. (Joh 2,12). Der Evangelist Matthäus berichtet ausdrücklich den Umzug nach Kapernaum und zwar mit einer prophetischen Begründung:
(…) und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am Galiläischen Meer liegt im Gebiet von Sebulon und Naftali, auf dass erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht (Jesaja 8,23; 9,1): »Das Land Sebulon und das Land Naftali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen; und denen, die saßen im Land und Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen.« (Mt 4,13-16).
Wir sehen es als sinnvoll und logisch an, dass das Hinabgehen von Jesus nach Kapernaum, wie es der Evangelist Johannes in Kapitel 2 Vers 12 beschreibt, bereits wenige Tage nach dem offiziellen Wegzug aus Nazaret erfolgte (Mt 4,12). Im Kontext jener Zeit ist es auch leicht verständlich, dass er nicht allein loszog, sondern von seiner Mutter und seinen Brüdern begleitet wurde. An dieser Stelle wollen wir betonen, dass das Hinabgehen nach Kapernaum in Lukas 4,16 nicht identisch ist mit dem offiziellen Umzug von Jesus, wie ihn uns der Evangelist Matthäus beschreibt (Mt 4,12-16). Denn zu dem Zeitpunkt der Vertreibung aus Nazaret hat Jesus schon viele Wunder in Kapernaum getan (Lk 4,23 „Wie große Dinge haben wir gehört in Kapernaum geschehen, tu so auch hier“). Beachten wir auch, dass er dorthin umzieht, wo ein Teil seiner jetzigen und zukünftigen Jünger wohnt, Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, auch der Zolleinnehmer und spätere Evangelist Matthäus, der in Kapernaum seine Wirkungsstätte hatte (Mt 9,9; Mk 2,14; Lk 5,27).
„Kapernaum (aramäisch: Kafr Nahum = Dorf von Nahum) war eine größere Fischerstadt am Nordwestufer des Sees Genesaret. Die großen Handelsrouten – von Damaskus nach Cäsarea Maritima – führten viele Angehörige fremder Völker durch diesen Teil Israels.“ (Keener 1998, 66).
Jesus wählt Kapernaum zu seinem Ausgangspunkt für die Verkündigung des Reiches Gottes durch die Frohe Botschaft (= Evangelium). Diese Stadt wird später „seine“ Stadt genannt (Mt 9,1). Im Vergleich dazu wird Nazaret als seine Vaterstadt (gr. patri,da – patrida) bezeichnet, oder die Stadt wo er erzogen wurde (Lk 4,16.23). Dies begründet zusätzlich unsere Annahme, dass die Vertreibung aus Nazaret nach Lukas 4,29, nicht mit dem freiwilligen und bewussten Umzug, wie ihn der Evangelist Matthäus in 4,12-16 beschreibt, gleichzusetzen ist.
Der Umzug ist nach Matthäus heilsgeschichtlich zu werten, denn das von den (Juden in Jerusalem) verachtete Galiläa der Heiden bekommt in Gottes Plan einen besonders hohen Stellenwert zugeteilt. Die Stammesgebiete der Nachkommen von Sebulon und Naftali im südöstlichen Galiläa (Jos 19,10-16; 32-39) grenzten an den See Genezaret und den Jordan. Nach der Eroberung Samarias, der Hauptstadt des Nordreiches im Jahre 721/722 durch die Assyrer, wurden in diesen Gegenden viele Menschen aus anderen Kulturen und Sprachen angesiedelt. Daher lebten dort, wie auch im übrigen Galiläa zur Zeit von Jesus viele Nichtjuden. Nach der Prophetie des Jesaja ist sogar das Gebiet jenseits des Jordan in das Missionsfeld von Jesus eingeschlossen. Tatsächlich berichten die Evangelisten von mehreren Besuchen und Diensten östlich des Sees Genezaret, wo überwiegend Nichtjuden lebten. Aus den Berichten über Befreiungen von Dämonen besessener Menschen können wir den starken Einfluss des Heidentums unter den Juden in dieser Region ableiten (Mk 1,34.39; 6,13). Daher wird dieses Volk, das dort wohnte, als in der Finsternis wandelnde und im Schatten des Todes lebende Volk, beschrieben. Dies sagt aus, dass Jesus als das wahre Licht dieser Welt dort beginnt, wo es am Dunkelsten ist (Joh 1,5.9; 8,12). Es ist ein Galiläer der in Galiläa mit der Verkündigung des Reiches Gottes beginnt.
Zu beachten ist auch die Aussage: „Er kam und wohnte in Kapernaum“ oder „ließ sich nieder in Kapernaum.“ (Mt 4,13). Der griechische Begriff `katw,khsen – katök¢sen` bedeutet `sich niederlassen, wohnen`. Dieser Begriff kommt auch in Matthäus 2,23 vor, wo Josef nach Nazaret kommt und sich dort niederlässt, nachdem er mit Jesus und Maria aus Ägypten zurückgekehrt war (Mt 2,23).
Jesus unternimmt von Kapernaum aus seine Reisen und kehrt im Laufe seines Dienstes immer wieder nach Kapernaum zurück. Folgende Texte belegen, dass Jesus sehr stark mit dieser Stadt verbunden war.
- „Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause ist.“ (Mk 2,1).
- „Nachdem er alle seine Worte vollendet hatte vor dem Volk, ging er hinein nach Kapernaum.“ (Lk 7,1).
- „Als er aber nach Kapernaum hineinging, kam zu ihm ein Zenturio.“ (Mt 8,5).
- „Und eingestiegen in das Boot, kamen sie an das jenseitige Ufer des Sees, nach Kapernaum.“ (Joh 6,17).
- „Als sie aber nach Kapernaum kamen.“ (Mt 17,24).
- „Und sie kamen nach Kapernaum und als er in das Haus kam, fragte er sie: Was habt ihr auf dem Weg verhandelt?“ (Mk 9,33).
Einer Rückkehr nach Kapernaum ging immer ein vorheriges Weggehen aus dieser Stadt voraus. Jesus wird darum öfter und länger in „seiner Stadt“ gewesen sein, als dies die Evangelisten berichten. Im Bereich dieses Ortes geschehen die meisten seiner Taten (Mt 11,23f). Kapernaum ist der Ausgangspunkt für Missionstätigkeit von Jesus. Er ist oft in der Stadt und in der Synagoge, in den Häusern der Jünger und auch anderer Familien.
Obwohl er Baumeister war, baute oder besaß er dort kein eigenes Haus. Bei einer Gelegenheit sagte er: „Der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege.“ (Mt 8,20; Lk 9,58). Wenn er seinen Jüngern auf den Weg die Anordnung gab (Mk 6,10): „Wenn ihr in ein Haus kommt, da bleibt, bis ihr weitergeht“, so wird er selber sich an diese Regel gehalten haben. Auf die Frage des Petrus: „Siehe, wir haben alles verlassen“, antwortet Jesus: „Wer verlässt Häuser, Vater, Mutter, Kinder (…), der wird es hundertfach wieder empfangen.“ (Mt 19,29). Diese Hinweise geben Grund zur Annahme, dass er gerne die Gastfreundschaft seiner Jünger und Freunde angenommen hat. Es ist möglich, dass er immer wieder in Kapernaum im Haus der Familie des Zebedäus gastliche Aufnahme findet. Begründen ließe es sich auch damit, dass die Frau des Zebedäus, Salome, eventuell die Schwester der Mutter von Jesus ist, wie ein Vergleich von Mt 27,56 mit Mk15,40 und Mk.16,1 sowie Joh 19,25 nahe legt (siehe auch Mt 20,20; Mk 10,35-40). Wir können also annehmen, dass Jesus keinen eigenen Haushalt führte. Die notwendigen Bindungen und Verpflichtungen hätten seine kurzen aber sehr intensiven Dienstjahre stark und unnötig eingeengt.
Fragen / Aufgaben:
- Was waren die Gründe für die Niederlassung in Kapernaum?
- Wie begründen wir, dass der offizielle Umzug von Nazaret nach Kapernaum dem Hinabgehen nach Kapernaum in Lukas 4,31 voranging?
- Nenne inhaltliche Schwerpunkte in der Prophetie des Jesaja (Jes 8,23; 9,1).
- Was für Vorteile bot die Stadt Kapernaum für den Dienst von Jesus?
- Suche nach Material über die Stadt Kapernaum.
- Bist du schon oft umgezogen?
- Welche Bedeutung hat unser Wohnsitz für unseren geistlichen Dienst?
Jesus beginnt seinen Verkündigungsdienst in Kapernaum
In diesem Abschnitt wollen wir die zeitlichen und auch inhaltlichen Aspekte betrachten. Denn beide Aspekte sind vom Text her vorgegeben.
Der zeitliche Aspekt – wann begann Jesus mit der Verkündigung?
(Bibeltext: Mt 4,17; Lk 3,23)
Gleich im Anschluss an die Niederlassung von Jesus in Kapernaum, heißt es bei Mstthäus: „Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Denkt um, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen.“ (Mt 4,17). Hier ist also der eigentliche Beginn des Verkündigungsdienstes von Jesus beschrieben. Die Frage nach dem Zeitpunkt des Beginns seiner Lehrtätigkeit ist berechtigt und eine Zeitbestimmung ist hier lohnend, ja sogar wichtig. Der Evangelist Lukas gibt das Alter von Jesus an und zwar zum Zeitpunkt des Beginns seines öffentlichen Dienstes. So schreibt er: „Und er selbst, Jesus, war ungefähr dreißig Jahre alt, als er auftrat (…).“ (Lk 3,23). Auch Johannes der Täufer beginnt seinen Dienst (als Priestersohn) mit etwa dreißig Jahren. Ursprünglich hatte Gott für die Priester als Dienstbeginn für das öffentliche Amn der Priester, das Alter von dreißig Jahren festgesetzt (4Mose 4,3.23.30.35.39.43.47) und ihr aktiver amtlicher Dienst endete mit fünfzig Jahren. Daher nehmen wir an, dass Johannes und Jesus, entsprechend der ursprünglichen Anforderung, mit dreißig Jahren ihren öffentlichen Dienst begannen. Übrigens war dieses Alter eines von drei Voraussetzungen, um im Hohen Rat (Synedrium) Mitglied zu werden. Ungefähr (gr. ώσεί, – ösei) dreißig in Lukas 3,23 bedeutet, knapp dreißig. Der Historiker Lukas scheint zu unterscheiden zwischen darunter, genau und darüber. Aufgrund der Vergleiche der zeitlichen Angaben in seinen zwei Berichten, kann man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen, dass Jesus bei seinem Dienstbegeginn noch nicht ganz dreißig Jahre alt war. (Siehe Exkurs „Zeitangaben“ im Anhang).
Ausgehend von der Zeitangabe des Lukas in Kapitel 3,1ff: „Im fünfzehnten Jahr der Regierung des Tiberius Caesar“, beginnt Johannes mit seiner Tauftätigkeit – frühestens im Herbst 28 oder spätestens im Frühjahr 29 n. Chr.. Tiberius trat seine Herrschaft am 19. August des Jahres 14 n. Chr. an. Rechnet man 14 volle Jahre nach vorne, kommt man in den Sommer des Jahres 28 n. Chr. Das fünfzehnte Jahr des Tiberius begann also am 19. August 28 n. Chr..
Für den Beginn der Tauftätigkeit des Johannes müssen auch die jahreszeitlichen, bzw. die klimatischen Verhältnisse in Palästina berücksichtigt werden. Gut möglich, dass Jesus etwa ein halbes Jahr später sich von Johannes im Jordan taufen ließ und nach etwa zwei Monaten in Kapernaum öffentlich mit der Verkündigungstätigkeit begann. Der sechsmonatige Altersunterschied zwischen Johannes und Jesus, welcher von dem Engel Gabriel so deutlich unterstrichen wird, könnte in diesem Zusammenhang als Anhaltspunkt gewertet werden (Lk 1,26).
In der Apostelgeschichte 13,25 macht der Apostel Paulus Jahre später eine interessante und aufschlussreiche Zeitangabe im Zusammenhang der Wirksamkeit des Johannes. Er sagt: „Als aber Johannes seinen Lauf erfüllte, sprach er: was ihr meint, dass ich sei, bin ich nicht, sondern siehe, es kommt einer nach mir“. Die Aussage „seinen Lauf erfüllte“, meint nicht das Ende seines Dienstes generell, sondern den Höhepunkt seiner Berufung, denn zum Zeitpunkt dieser Aussage war Jesus noch nicht getauft (Mt 3,11; Lk 3,16; Joh 1,20). Der Höhepunkt im Dienst von Johannes war, den Messias Jesus dem Volk Israel bekannt zu machen (Joh 1,31). Daher kann man die Zeit zwischen Frühling bis Spätsommer des Jahres 29 n. Chr. für den Beginn des öffentlichen Auftretens von Jesus annehmen.
Fragen / Aufgaben:
- Wann begann Jesus seinen öffentlichen Dienst?
- Wie alt war Jesus zu Beginn seines Dienstes?
- Spielte das Alter eine Rolle für den Dienst von Jesus?
- Welche Etappen oder Vorbereitungen benötigst du noch, um guten Dienst im Reich Gottes tun zu können?
Das Hauptthema der Verkündigung von Jesus
(Bibeltexte: Mt 4,17; Mk 1,15)
Inzwischen ist Jesus kein Unbekannter mehr. Seine öffentliche Taufe und das Zeugnis über ihn durch Johannes den Täufer am Jordan haben ihn in kurzer Zeit weithin bekannt gemacht. Der Evangelist Lukas schreibt: „(…) und die Kunde von ihm ging aus in die ganze Umgegend.“ (Lk 4,14b). Das Hauptthema und der Hauptinhalt der Predigten von Jesus lautete: „Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Denkt um und glaubt an das Evangelium.“ (Mk 1,15). Das griechische Wort `,ευανγέλιον – evangelion` bedeutet gute Nachricht, frohe Botschaft. Die Begriffe „Reich Gottes“ (Lukas 32 mal) und „Reich der Himmel oder Himmelreich“ (Matthäus 31 mal) sind austauschbar und ergänzen einander. Matthäus hat mit Vorliebe den Himmelreichsbegriff verwendet und definiert damit das Reich Gottes nicht nur als vom Himmel kommend, sondern auch als nicht von dieser Welt. Christus ist gekommen die Herrschaft Gottes in dieser Welt aufzurichten. In seiner Person bricht die Herrschaft Gottes ganz real an. Diese anbrechende Herrschaft Gottes wird als die Frohe Botschaft verkündigt und gelebt. In jedem Wort und jeder Tat von Jesus offenbart sich Gottes Herrschaft.
Auffallend sind die Unterschiede und das Gleichbleibende (Kontinuität und Diskontinuität), wenn wir die Qualität des Reiches Gottes, offenbart im historischen Israel, mit der Qualität des Reiches Gottes, offenbart in Jesus, vergleichen. Beide Reiche sprechen von dem gleichen Bundesgott JAHWE und dem einen Heilsplan, darum kann man auch von dem einen Reich Gottes, dem einen Heilsbund Gottes sprechen. Doch auch die Unterschiede wollen wir sehen. Das Reich Israel ist zeitlich und auch räumlich begrenzt und der Qualität nach oft physisch-materieller Natur. Das Reich Gottes, das Jesus persönlich verkörpert und verkündigt, ist jedoch ein ewiges, himmlisches, göttliches Reich (Lk 1,31-33) also nicht von dieser Welt (Joh 18,36), nicht materiell physisch. Es wirkt sich aber sehr positiv und heilsam auf das Materielle/Physische (Schöpfung/Mensch) aus (Lk 17,21; Röm 14,17).
Dieses göttliche Reich kann nur der erfahren, der in dieses Reich eingeht, indem er umdenkt. In Johannes 3,3.5 sagt Jesus, dass nur durch eine Geburt von oben, bzw. Geburt durch Wasser (Wort Gottes) und Geist (Gottes Geist), kann ein Mensch das Reich Gottes sehen oder erfahren.
Für `denkt um` steht im griechischen das Verb `,μετανοίτε – metanoite` und meint eine Veränderung, bzw. Umkehr im Denken. Von Kindheit an wird der Mensch durch seine gefallene Natur in seinem Denken negativ beeinflusst und geprägt. Bereits bei Kindern bemerken wir, wie ungehemmt das Innere nach außen dringt. Sie geben sich, wie sie sind, mal ganz lieb, freundlich mitteilsam und ein andermal können sie sich sehr boshaft bis brutal benehmen. Erwachsene Menschen lernen im Laufe der Zeit ihr wahres Inneres zu verbergen. Dieses verformte Denken wirkt sich negativ auf das Verhalten und das Handeln aus. Durch verschiedene Einflüsse im Elternhaus, durch die jeweiligen gesellschaftlichen Ideologien, religiöse Prägungen, wird das Menschliche Denken geformt.
Gerade hier in der Schaltzentrale des Menschlichen Herzens setzt Jesus an. Überdenken, umdenken, aber in welche Richtung?
Jesus verwendete mehr als drei Jahre, um durch Predigt, Lehre, Gleichnisse, Beispiele, Bilder, sowie durch konkrete Handlungen, Menschen den Wert und die Notwendigkeit der NEUE Denkweise zu erklären. Denn „Das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt, und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein.“ (Lk 16,16). In dieser Frohbotschaft wird der Wille Gottes offenbart, denn er will das alle Menschen gerettet werden (1Tim 2,4). Dies wird möglich durch den Glauben an Jesus den Gesalbten und Gesandten Gottes (Joh 3,16-17).
Fragen / Aufgaben:
- Was war der Hauptinhalt der Verkündigung von Jesus zu Beginn seines Dienstes?
- Warum spielt das Umdenken, die Umkehr eine so große Rolle in der Botschaft von Jesus?
- Welchen Unterschied siehst du zwischen dem Reich für Israel und dem Reich Gottes, das in Jesus angebrchen ist?
- Auf was legst du in deinem Zeugnis für Jesus wert?
- Bist du im biblischen Sinne schon umgekehrt? Gelingt es dir seitdem weiterhin umzukehren, wenn du etwas falsch gedacht, gesagt oder gemacht hast?
Berufung der ersten vier Jünger und der Fischfang des Petrus
(Bibeltexte: Mt 4,18-22; Mk 1,16-20; Lk 5,1-11)
Die Berichte der Evangelisten Matthäus und Markus über die Berufung der ersten vier Jünger ähneln sich sehr. Der sich anschließende Fischfang des Simon Petrus wird nur vom Evangelisten Lukas beschrieben. Letzterer nennt jedoch so viele ergänzende Details, dass der Eindruck sich festigt – es handelt sich um dasselbe Tagesereignis am See Genezaret. In der folgenden Tabelle sind die Texte aller drei Evangelisten aufgeführt:
|
Folgender Ablauf der Ereignisse dieses Tages am Ufer des Sees von Genezaret ist vorstellbar.
Jesus geht morgens am See entlang. Da sieht er Simon und Andreas, wie sie ein ihre Wurfnetze in den See werfen, sie waren nämlich Fischer (Mt 4,18). Zum Fischfang wurden verschiedene Netzarten verwendet (Schleppnetze, Stellnetze, Wurfnetze), je nach den Gegebenheiten des Fischens.
Abbildung 33 Mit dem Wurfnetz fischten die Fischer im Uferbereich und im Flachwasser (Zeichnung von J. S. am 4. November 2017).
Mit dem Wurfnetz (gr. αμφιβληστρον – amphibl¢stron) konnte man vom Ufer aus oder im flachen Wasser fischen. Es handelte sich dabei um ein kreisrundes Netz, das drei bis fünf Meter im Durchmesser hatte. An den Rändern waren Gewichte angebracht und in der Mitte eine Schnur, mit der man den Netzrand nach dem Wurf ins seichte Wasser, zusammenzog. Somit waren die Fische im Netz eingeschlossen. Die Netze wurden wahrscheinlich mit Seil oder Schnur aus Flachs, Papyrus oder Hanf geflochten. Weil sie (Petrus und Andreas) gerade in dieser Nacht auf offener See nichts fingen (Lk 5,5), ist das morgendliche Fischen am Ufer mit Wurfnetzen verständlich.
„Die meisten Menschen im jüdischen Palästina ernährten sich von Weizen, Gerste und Salzfisch, die [regionale] Küche kannte daher viele Fischsoßen. Unter den Fischen im See Gennesaret fand sich eine besonders große Karpfenart; zur Haltbarmachung wurde der Fisch getrocknet oder eingelegt. Die Fischer waren eine der ökonomischen Hauptstützen Galiläas und hatten, gemessen am Durchschnitt, ein gutes Auskommen; jedenfalls ging es ihnen wesentlich besser als den vielen Kleinbauern im riesigen Römischen Reich“ (Keener 1998,67).
Dieses Bruderpaar ruft Jesus in seine Nachfolge. Es fällt auf, dass der Evangelist Matthäus Simons Beinamen `Petrus` hinzufügt. Damit erinnert er an die erste Begegnung von Simon mit Jesus am Jordan. Dort erhielt er ja diesen Bei- oder Zunamen, der seine Identität und seinen Charakter neu prägen sollte (Joh 1,42).
„Der Ruf in die Nachfolge unterscheidet sich erheblich vom Jüngerleben der anderen Rabbis. Es ging nicht um die korrekte Überlieferung von Schrifttexten, ihre Auslegung oder die viel diskutierten Lehren der Schrift! Auch sollte nicht ein schon erwählter Lebensstil verfeinert werden, sondern der Ruf bedeutete ein völlig neues Lebenskonzept. Die Jünger der Rabbiner und auch des Johannes des Täufers folgten ihren Meistern, um zu lernen. Jesus wollte Jünger der Tat – Jünger die sich aktiv an seinem Werk beteiligten = als Menschenfischer arbeiten“ (Edersheim 1979, 475).
Die sofortige Nachfolge ist nicht so ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass die Beteiligten
- sich am Jordan kennen lernten
- Jesus nach Galiläa begleiteten
- Jesus bei dessen Umzug von Nazaret nach Kapernaum begleiteten,
- Das erste Wunder in Kana erlebten und Jesus deshalb schon ihr Vertrauen genoss (Joh 1,35-41; 2,1.12).
Αuch dieses Bruderpaar ruft Jesus in seine Nachfolge. Auffallend dabei ist, dass nach der jüdischen Tradition sich junge Männer einen bestimmten Rabbi aussuchten um dann von ihm zu lernen und seiner Schriftauslegung zu folgen – nicht so bei Jesus, er ruft, bzw. beruft, wen er will (Joh 15,16). Die Annahme, dass die von Jesus Berufenen von so niedriger sozialer Rangstufe waren, so dass sie von keinem Rabbi angenommen wurden, findet kaum eine Bestätigung in der Schrift. Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus waren mit ihren Familie wirtschaftlich so gut gestellt, dass sie Tagelöhner anstellen konnten (Mk 1,20). Sie hatten also einen einträglichen Beruf und ihr festes soziales Netz (der Vater wird verlassen!) aufgegeben. Die sofortige Bereitschaft dieser Brüder lässt sich ebenfalls damit erklären, dass sie Jesus bereits von den Erlebnissen am Jordan her kennen und ihm vertrauen. Johannes und Andreas waren schon dort Jünger vom Täufer (Joh 1,35ff). Übrigens gehört Andreas und Johannes zu den ersten zwei, welche Jesus „nachgelaufen“ sind (Joh 1,37-40). Das offensichtlich gewachsene Vertrauen der ersten berufenen Jünger zeigt ihre Messiaserwartung und ihre Schlichtheit im Glauben. Dennoch stand dieser Glaube in einem auffälligen Gegensatz zur Kultur und Denkweise der Zeitgenossen, die immer betonten, dass das Gebot Vater und Mutter zu ehren, einen so drastischen plötzlichen Wechsel verbieten würde. Doch auch Gideon, Elisa und Jeremia wurden in einer beschäftigten Phase ihres Lebens von Gott in den Dienst gerufen – Gott hat ein besonderes Augenmerk für fleißige und eigentlich ausgelastete Menschen!
Der Evangelist Lukas unterstreicht, dass sich viele Menschen zu Jesus am Seeufer versammeln und er in Simons Boot steigt und ihn auf seine Bitte hin ein wenig vom Lande wegrudert (Lk 5,3-4). Jesus lehrt sitzend im Boot, die Menschen stehen am Ufer aneinander gedrängt. Die Lehre des Rabbi Jesus ist vollmächtig und alle können ihn gut hören, denn die Akustik ist im ansteigenden Gelände des Uferbereichs besonders gut. Nach der Botschaft von Jesus kommt die Tat, oder der Beweis des vollmächtigen Redens. Gott hat seine Pläne und dazu nutzt er die Verlegenheit der Fischer und ihren Misserfolg. Unsere menschlichen Grenzen sind sehr oft der Beginn des Handelns Gottes.
Jesus sagt zu Petrus: „Fahre hinaus auf die Tiefe des Sees und lasst eure Netze hinunter, oder: werft eure Netze aus“. In der Reaktion des Petrus schwingen Töne des Unverständnisses, der Besserwisserei, aber auch des Vertrauens mit: „Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt (gearbeitet) und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen.“ (Lk 5,5). Einige Wunder wirkt Gott, ohne dass ihn jemand darum bittet, da sie ein unbedingter Teil seines souveränen Planes sind. Diese Wunder sind notwendig für das Reich Gottes.
- Gott zeigt durch sie seine Überlegenheit im Vergleich zur menschlichen Begrenztheit
- Durch diese Wunder wird die Messianität von Jesus bekr#ftigt
- Gott zeigt dadurch seine Güte und Fürsorge, Jesus übernimmt die Verantwortung für seine Diener – sie müssen mit ihren Familien nicht ohne Brot und Fisch bleiben.
Der Evangelist berichtet weiter, dass durch den reichen Fang beide Boote mit Fischen gefüllt wurden (Lk 5,7b). Wer Jesus nachfolgt, kann die Sorge um die tägliche Nahrung ihm überlassen. Jesus braucht Menschen, die bereit sind ihre Routine für ihn zu verlassen und das Evangelium zu allen Menschengruppen zu bringen. Der Glaubensgehorsam von Simon Petrus ist geradezu beispielhaft. Gilt dies nicht auch für Jünger heute!
„Ein Fischer vertraut einem Rabbi zwar in religiösen Dingen, aber sicher nicht in seinem eigenen Erfahrungsbereich, der Fischerei“ (Keener 1998, 324).
„Doch mit Jesus im Boot und auf seinen Befehl hin, müssen viele Fische gefangen werden“ (Edersheim 1979, 476).
Am Ende der Begebenheit sind nicht nur die Junger, sondern auch die ganze Volksmenge Zeugen der göttlichen Vollmacht von Jesus. Petrus ist überwältigt – seine Aussage: „Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch (Mann)“, macht deutlich, dass er erst hier seinen menschlichen Zerbruch und geistlichen Aufbruch erlebt. Der Ruf zur Nachfolge wird erst hier von Jesus ausdrücklich ausgesprochen. Menschen mit dieser Selbsterkenntnis und Selbsteinschätzung sind brauchbar für Jesus – andere mögen begabter und hoffnungsvoller sein – doch Menschen nach einem Bruch, einer Krise, einem ehrlichen und offenem Bekenntnis sind die „ersten“ im Mitarbeiterteam.
Im Text heißt es: „Und als sie die Boote an Land zogen, verließen sie alles und folgten ihm nach“. Diese Lebensentscheidung ist so wichtig und herausragend, dass die Evangelisten mühelos den weiteren Verbleib der vielen gefangenen Fische übergehen. Ihre Absicht war nicht der jeweils lückenlose und detaillierte Bericht der Wunder und Heilungen von Jesus, sondern die Darstellung der Wirkung die jeweils davon ausgingen. Nicht das Wunder steht im Vordergrund, sondern die Auswirkung: was Gott damit erreicht hat. So offenbarte sich das Reich, die Herrschaft Gottes in und durch die Person von Jesus.
„Die Vermehrung von Nahrung und Tieren, die Jesus hier vollbringt, hat alttestamentliche Vorbilder“ (Nahrung: 2Mose 16,13; 2Kön 4,1-7.42-44; Tiere 2Mose 8,3.13.20; 10,13; Keener 1998, 324).
Die Wendung „von nun an wirst du Menschen fangen“ ist eine prophetische Voraussage auf den bevorstehenden Dienst als Apostel und Evangelist, beginnend noch unter der Leitung und Begleitung von Jesus (Mt 10; Joh 21,1-15) und später am Pfingsttag in Jerusalem (Apg 2-6), der sich fortgesetzt hatte in Judäa (Apg 10-11), Samarien (Apg 8) und über die Landesgrenzen hinweg (Gal 2,11).
Fragen / Aufgaben:
- Warum verbindet Jesus die Berufung der ersten Jünger mit einem Fischfangwunder?
- Wie erklärst du die sofortige Bereitschaft der ersten vier Jünger, Jesus nachzufolgen?
- Was erlebt Petrus bei dieser Begegnung?
- Wie reagierst du, wenn du in deinem Beruf Misserfolge hast?
- Wie und wann bist du Jesus nachgefolgt?
Jesus vollbringt Wunder und Heilungen in Kapernaum
(Bibeltexte: Mk 1,21-28; Lk 4,31-37)
Jesus befreit einen Besessenen in der Synagoge
Sowohl der Evangelist Markus als auch Lukas haben die Befreiung des Besessenen und die folgende Heilung der Schwiegermutter Simons in übereinstimmender Reihenfolge überliefert. Der Evangelist Matthäus überliefert die Befreiung nicht und Lukas schildert beide nach dem Besuch in Nazaret. Hier folgen wir dem Bericht des Evangelisten Markus:
Und sie gingen hinein nach Kapernaum; und alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre; denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten.
Abbildung 34 Überreste der Synagoge in Kapernaum die vermutlich aus dem 2. Jh. n. Chr. stammt (Foto: April 1986).
Und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch, besessen von einem unreinen Geist; der schrie: Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes! Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm! Und der unreine Geist riss ihn hin und her und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sprachen: Was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht! Er gebietet auch den unreinen Geistern, und sie gehorchen ihm! Und die Kunde von ihm erscholl alsbald überall in das ganze Land um Galiläa. (Mk 1,21-28).
Wie wir gesehen haben, fand die Berufung der ersten Jünger an einem Werktag statt und zwar am Ufer des Sees. Die Geschichte von der Befreiung eines von einem Dämon besessenen Menschen jedoch ereignete sich an einem Sabbat im Rahmen eines Synagogengottesdienstes in Kapernaum. Das häufig gebrauchte Wort „sofort/sogleich“ bei Markus bezieht sich auf den Sabbat, nicht auf das Geschehen am See. In den Evangelien finden wir Berichte über Austreibungen von Dämonen oder unreinen Geistern zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten. Geistlich bewertet ist dies ein trauriges Zeugnis für das Volk Israel zur Zeit von Jesus. Denn besessen werden Menschen nicht, durch falsche Ernährung und schon gar nicht durch das Einhalten der Gebote Gottes (lies 5Mose 18,9-15). Es gibt auch unter den Zeitgenossen von Jesus die Praxis der Dämonenaustreibung – Exorzismus genannt (Mt 12,24-28) wobei gar nicht sicher ist, ob sie erfolgreich waren. Es gibt verschiedene Stufen des Besessenseins. Ab dem Sündenfall von Adam und Eva befinden sich alle Menschen unter dem Einfluss böser Mächte. Dabei sind sie je nach Umfeld, unterschiedlicher Umstände und Lebensführung geschützter oder auch ungeschützter diesem Einfluss ausgesetzt.
- Wer zu Wahrsager/innen oder Besprecher/innen geht, um sich die Zukunft voraussagen zu lassen, steht unter einem bestimmten Maß von Einfluss böser Mächte.
- Wer selber besprochen, gewahrsagt oder andere okkulte Praktiken aktiv ausgeübt hat, steht direkt unter der Macht von Dämonen.
- Der Einzug eines Dämons in das Herz (den Geist) eines Menschen vollzieht sich oft langsam, wie bei Judas Iskariot: „Aber der Satan fuhr in Judas, der Iskariot genannt wurde und aus der Zahl der Zwölf war. Und er ging hin und besprach sich mit den Hohenpriestern und Hauptleuten, wie er ihn an sie überliefere.“ (Lk 22,3-4).
Es ist für Jesus selbstverständlich am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Synagogen waren Gemeinschaftszentren, Orte des Gebets und des Schriftstudiums. Wenn sich durchreisende Lehrer in der Stadt aufhielten, luden die Synagogenvorsteher sie gewöhnlich zur Lesung ein, vor allem am Sabbat. Dort wurde erst stehend der hebräische (Gesetzes)-Text gelesen, dann ins Aramäische übersetzt, anschließend wurde der Text sitzend besprochen. Natürlich nutzt Jesus die Gelegenheit zur Lehre – ja bald wurde dies ihm zur Gewohnheit (Lk 4,16; Joh 18,20). Seine Lehre unterscheidet sich von anderen Lehrern durch Vollmacht und Kraft. Seine Lehre ruft bei den Zuhörern, die sich damals an der Schriftauslegung aktiv beteiligen durften, Verwunderung und Staunen hervor.
- Jesus war die Wahrheit in Person und sprach die Wahrheit (Joh 14,6; 18,37).
- Jesus sprach über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens und Sterbens; über die Ewigkeit. Er verlor sich nicht in Nebensachen
- Jesus lehrte klar und mit System
- Jesus nutzte viele lebendige Vergleiche und Illustrationen
- Jesus liebte die Zuhörer und leitete sie zum Vater
- Jesus sprach mit Autorität/Vollmacht direkt im Namen des Vaters – er brauchte keinen anderen Rabbiner als Autorität zu zitieren (Hendriksen 1975, 63).
Ein Besessener im Raum wird bis dahin wahrscheinlich nicht als solcher wahrgenommen worden sein. Oft verhalten sich diese Menschen ruhig und werden erst bei der Begegnung mit Jesus oder seinen Aposteln – oft auch im Zusammenhang mit der Verkündigung des Evangeliums – aggressiv. Hier einige Hinweise zu Dämonen im NT:
- Im NT finden wir fast keine Details zur Herkunft, Natur, Eigenschaft oder Gewohnheit der Dämonen. Es gibt keine theoretische Abhandlung oder Lehre über Dämonen im NT. In einem sehr bildlichen Abschnitt (Mt 12,43) spricht Jesus von Dämonen „die dürre Stätten durchwandern.“ In der Begebenheit von Gadara Lk 8,31 erbitten die Dämonen, nicht in den `άβυσςον – abysson – Abgrund` als letzten Aufenthaltsort fahren zu müssen. Die Kontrolle über Menschen offenbart sich z.B. durch: Schreien oder zu Boden/ins Feuer zerren. Allerdings lesen wir nichts von gleich bleibenden eindeutigen Kennzeichen. Bei allen Erzählungen bildet Jesus – der sich erbarmt und heilt – und nicht der Dämon das Zentrum. Deutlich wird, dass Dämonen zur unsichtbaren Welt gehören, dass sie sich selbst nicht sichtbar machen (außer durch Störungen bei Menschen). Damit sind viele Schauermärchen hinfällig. Damit gibt es „einen kaum drastischeren Kontrast der Berichte des NT zu den Ansichten und Praktiken beschrieben in den rabbinischen Schriften“ (Edersheim 1979, II 776).
- Im Neuen Testament ist der Dämon ein böses Wesen, das zum Reich des Satans gehört. Die Zerstörung des Werkes Christi ist sein Ziel. Doch Christus herrscht auch über diesen Bereich, sodass der lebendige Glaube an Jesus ein hinreichender Schutz ist.
- Das NT berichtet nirgends, dass magische Riten von Dämonen befreien. Die Befreiung wird als geistlicher und ethischer Prozess beschrieben.
- Nach dem Neuen Testament ist die Tätigkeit der Dämonen stark begrenzt – im Gegensatz zur babylonischen Ansicht, die davon ausgingen, dass überall und ständig Dämonen an jeder Ecke, an jedem Fluss, auf Berggipfeln – mal als Schlangen – mal als Vögel auf Opfer lauerten. Vom Zahnschmerz bis zur Eifersucht … alles wurde den Dämonen zugeschrieben. Wir finden ca. 80 Hinweise auf Dämonen im Neuen Testament. In 11 Fällen wird der Unterschied zu einer Krankheit deutlich gemacht (Mt 4,24; 8,16; 10,8; Mk 1,32.34; 6,13; 16,17.18; Lk 4,40.41; 9,1; 13,32; Apg 19,12). Die Besessenheit war deutlich nicht nur ein mentales Phänomen (Mt 9,32.33; 12,22). In zwei Fällen wird sie von einem stark verworrenem Zustand begleitet (Mt 8,28 und Apg 19,13f). In nur einem Fall erinnert das Geschehen an Epilepsie (Mt 17,15) oder wird ausdrücklich von der so genannten Mondsucht unterschieden (Mt 4,24). Die Unterscheidung zwischen dämonischer Ursache oder allgemeiner Ursache für eine Krankheit wird gemacht (Mt 12,22; 15,30). Der Schwerpunkt der Erwähnung im Neuen Testament liegt auf der erfolgreichen Heilung – sodass dieses Thema weniger ein Thema ist, dass Angst und Schrecken verbreitet.
Besessenheit von Gläubigen können wir ausschließen – auch sonst ist Zurückhaltung geboten. Erfahrene Seelsorger berichten von vielen seelischen Krankheiten und wenigen Besessenen im Rahmen ihres Gemeindedienstes. Nach der Beichte von okkulten Praktiken – darf es ein Lösen im Namen von Jesus geben.
Beachten wir die Aussage des unreinen Geistes, der bei Lukas auch Dämon genannt wird: „Ha, was uns und dir, Jesus, Nazarener“? Bist du gekommen uns zu vernichten? Ich weiß wer du bist, der Heilige Gottes!“ Griechisch: `πνεύμα δαιμονίου ακαθάρτου – pneuma daimoniou akathartou` wörtlich: Geist des unreinen Dämons. Die Dämonen haben ein bestimmtes Maß an Kenntnissen
- über Gott,
- über den Menschen,
- über sich selbst,
- über andere Dämonen
- und über ihre Zukunft.
Jesus ist gekommen, damit er die Werke des Teufels nicht nur bekämpfe, sondern damit er sie zerstöre (1Joh 3,8). So lesen wir weiter: Jesus fuhr ihn an/bedrohte ihn/gebot ihm mit den Worten: „Verstumme und fahre aus von ihm“. Worte eines unreinen Menschen können viel Schaden anrichten, darum unterbricht Jesus das Reden des Dämons. Er verbietet ihm zu sprechen. Er macht ihn stumm. Pure Lüge geht von Dämonen aus, auch wenn sie Richtiges sagen. „Der (Teufel) ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem Eigenen; denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge.“ (Joh 8,44).
- Mit ihren Aussagen lenken die Dämonen die Aufmerksamkeit der Menschen von Jesus weg und ziehen diese auf sich;
- In keinem Fall ist es ihre Absicht, für Jesus Werbung zu machen oder ihm gar zu Huldigen.
Das Ergebnis dieser Heilung war: „Und die Kunde von ihm ging sogleich aus überall in der ganzen Umgebung Galiläas.“ (Mk 1,28; Lk 4,37). Obwohl er nur eine Person von einem unreinen Geist befreit, ist allen klar: ab jetzt müssen auch andere unreine Geister weichen! Die Herrschaft Gottes ist in der Person von Jesus angebrochen.
Fragen / Aufgaben:
- Wie kommen Menschen in dämonische Besessenheit?
- Wann und wie äußern sich von Dämonen besessene Menschen? Beschreibe ihren Zustand und ihre Äußerungen.
- David ist der einzige im AT, durch dessen Dienst Menschen von Dämonen (wenn auch nur zeitweise 1Sam16,23) befreit wurden. Wie beurteilst du die Austreibungen von Mt 12,24-28; Apg 19,13-17?
- Hattest du schon mal Kontakt mit von Dämonen belasteten Menschen? Wie müssen wir heute mit solchen Fällen umgehen?
Jesus heilt die Schwiegermutter des Petrus vom Fieber
(Bibeltexte: Mt 8,14-15; Mk 1,29-31; Lk 4,38-39)
Im Markus- und Lukasevangelium lesen wir, dass Jesus zuerst die Synagoge besucht und dann das Haus von Simon betritt. Im Matthäusevangelium wird die Reihenfolge andersherum dargestellt.
Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Die Schwiegermutter Simons lag fieberkrank danieder und sofort sagen sie ihm von ihr. Und er trat zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf; und das Fieber verließ sie, und sie diente ihnen. (Mk 1,29-31).
Der Evangelist Markus nutzt wieder sein Lieblingswort `ευθύς – eythys – sofort/sobald`, um den schnellen Handlungsfortschritt zu betonen. Dieses Wort wird auch für `gerade` gebraucht (Apg 9,11).
Sofort, nachdem sie aus der Synagoge heraus gehen, eilen sie geradwegs zum Haus Simons. Hier wird deutlich: Simon Petrus besitzt in Kapernaum ein Haus und sein Bruder Andreas wohnt bei ihm oder ist gar Miteigentümer. Wir wissen jedoch auch, dass Petrus mit seinem Bruder Andreas aus Betsaida stammt (Joh 1,44). Vielleicht siedelten beide im Zuge der Heirat mit einem Mädchen aus Kapernaum dorthin um. Andere Ausleger gehen, davon aus, dass die Familie dort ein Haus hatte und Simon seine verwitwete Schwiegermutter in der Familie aufgenommen hatte (Keener 1998, 214).
Dafür können allerdings auch wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend gewesen sein. Auf jeden Fall bilden die beiden Brüder Jakobus und Johannes (Söhne des Zebedäus) mit Simon und Andreas eine Art Fischereikooperative (Lk 5,10). Jesus kommt ins Haus seiner Nachfolger und findet eine gute Aufnahme – mit allen orientalischen Implikationen, d.h. man lässt es an nichts fehlen, so dass er sich in jeder Weise willkommen fühlt. Jesus macht sich bewusst abhängig von der Gastfreundschaft der Menschen. So sorgt der Vater im Himmel für seinen Sohn auf Erden! Von den Jüngern begleiten ihn nur Jakobus und Johannes – andere Jünger werden noch nicht erwähnt. Dies kann zusätzlich als Begründung gesehen werden, dass diese Begebenheit sich am Anfang der Wirksamkeit von Jesus zugetragen hat – wahrscheinlich vor der offiziellen Berufung der weiteren Jünger.
Abbildung 35 Fundamentreste des sogenannten Hauses des Petrus auf dem Ausgrabungsgelände von Kapernaum (Kafr Nahum) in der Nähe des Seeufers (Foto: April 1986). Man vermutet hier eine frühchristliche Versammlungsstätte. Seit 2008 ist darüber eine Kirche errichtet worden. Die Franziskanermönche, die das Gelände von Kapernaum 1894 erwarben, verwalten seitdem diese biblisch-historische Stätte, die so gut wie von allen christlichen Pilgern aufgesucht wird.
Nun ist Jesus im Haus und wird über die Krankheit, bzw. das hohe Fieber der Schwiegermutter informiert. Im Gebiet des Sees Genesaret gab es im Bereich der Jordanmündung bis ca. 1930 Malaria. (Wilken, Erich. 1953). Übrigens wird uns im NT der Name und Details von Simons Frau nicht mitgeteilt (siehe auch 1Kor 9.5). Der Evangelist Lukas ergänzt, dass die Hausbewohner Jesus angesichts des hohen Fiebers um Hilfe bitten. Bei der Heilung der Schwiegermutter, geht Jesus ähnlich vor, wie bei dem Besessenen vorher. Dort fährt er den Geist an, hier bedroht er das Fieber, bzw. gebietet dem Fieber zu weichen. Das Wort `επετίμησεν – epetim¢sen – anfahren, bedrohen oder gebieten`, setzt konkrete Worte der Bedrohung voraus, die uns nur bei der Heilung des Besessenen überliefert werden: „verstumme und fahre aus von ihm“- hier wird jedoch keine Aussage von Jesus überliefert.
Die Evangelisten Markus und Matthäus vermerken, dass Jesus die Patientin an der Hand nimmt. Markus fügt hinzu, dass er sie aufrichtet. Dies geschieht im Gegensatz zu manchen frommen Zeitgenossen, die es – so weit möglich – vermieden eine Frau (noch dazu eine remde) zu berühren, um sich nicht zu verunreinigen (Keener 1998, 90).
Lukas nennt ein typisches ärztliches Detail (Hendriksen 1978, 268): das „sich über den Patienten beugen.“
Weiter bedroht Jesus das Fieber und dies weicht dann tatsächlich spontan und vollständig. Matthäus ergänzt: „Er berührte ihre Hand und das Fieber verließ sie.“ So wird deutlich: Jesus richtet die Schwiegermutter in übernatürlicher Weise auf. Die griechische Verbformen in diesem Satz unterstreichen die punktuelle Heilung (Aorist) und das andauernde Dienen (Imperfekt). Sobald diese auf den Beinen steht, beginnt sie den selbstverständlichen Gastgeberpflichten nachzukommen. Als älteste Frau im Haus geht sie mit bestem Beispiel voran, um so zu zeigen, dass sie sehr wohl weiß, was alles zu tun ist, damit der Gast sich willkommen fühlt. So wird sie im weiteren Sinne die erste weibliche christliche Diakonin (Tischdienerin) von Jesus Christus (Edersheim 1979, 486).
Was für ein köstliches Mahl wird sie wohl bereiten nach dem Ende des Sabbats am Samstag Abend – selbst wenn die Speisen karg gewesen wären – die Freude der Anwesenden über die beiden Heilungen, über die „Vollmacht“, über die Beweise des anbrechenden Gottes Reiches war groß. Weiter ist zu bedenken, dass das Dienen der Frau bei Tisch vor Männern, die nicht zur Familie gehörten, „verpönt war“ (Strack Billerbeck 1982, 480), um sie nicht an den Aufenthalt unter Männern zu gewöhnen. Doch Jesus setzt solchen frauenfeindlichen Regeln eine offene Freiheit entgegen.
Mit diesen beiden Heilungen beginnt Jesus sowohl im öffentlichen Bereich (Synagoge) als auch im privaten Bereich (Simons Haus) seinen Dienst und richtete mit diesen sozialdiakonischen Handlungen Gottes Herrschaft auf.
Fragen / Aufgaben:
- Beschreibe die Umstände und familiären Verhältnisse des Petrus.
- In welcher Weise bringst du Jesus mit „nach Hause“?
- Nenne biblische Personen die als „krank“ geschildert werden.
- Wie geht Jesus mit Krankheit um?
- Welche Erfahrungen mit Gott hast du in Krankheitsfällen gemacht?
Jesus predigt und heilt am Abend in Kapernaum
(Bibeltexte: Mt 8,16.17; Mk 1,32-34; Lk 4,40-41; Jes 53,4)
Der Evangelist Lukas schreibt:
Und als die Sonne untergegangen war, brachten alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu ihm. Und er legte die Hände auf einen jeden und machte sie gesund. Von vielen fuhren auch die bösen Geister aus und schrien: Du bist der Sohn Gottes! Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden; denn sie wussten, dass er der Christus war. (Lk 4,40-41). Und der Evangelist Markus ergänzt: „Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür.“ (Mk 1,33b).
Nach dem Ende des Sabbats wurde Simons Haus und Hof zu einer überfüllten Heilungsstation für Kranke in Kapernaum, da die Notleidenden kaum mit ihrer Not warten konnten bis es endlich Abend geworden war.
| HINWEISS: Das Ende des Sabbats festzulegen war und ist für die Juden nicht einfach. Abgesehen davon, dass die Dämmerung sich nach Jahreszeit und Standort verändert, gibt es verschiedene Weisungen der Halacha, des Religionsgesetzes. Sie besagt, dass der Sabbat am Freitagabend vor Sonnenuntergang beginnt und am Samstagabend mit dem Nachtbeginn endet. Um ganz sicher zu gehen, verlangt die Halacha, den Sabbat am Freitag etwas früher zu beginnen und am Samstag etwas später als beim Anbruch der Nacht zu beenden. Das Sabbat-Ende wurde definiert: Die Sonne steht mit sieben Grad und fünf Bogenminuten unter dem Horizont. Dazu addiere man sicherheitshalber drei Minuten, und sämtliche Ungenauigkeiten sind ausgeglichen. So verläuft die Grenze der Nacht in der jüdischen Welt je nach Standort verschieden. Einigkeit herrscht nur in der Frage des Bezugsortes der Tabelle für die verschiedenen Orte und Daten: Jerusalem. Während des Sabbats ist es den Gläubigen nicht erlaubt, ein Feuer zu entfachen. Da es aber der Freude und dem Frieden des Sabbats abträglich sein könnte, wenn die Menschen lichtlos durch Dämmerung und Nacht gingen, wurde schon vor langer Zeit eine einfache Lösung gefunden und zur religiösen Pflicht erhoben: das Ritual des Kerzenanzündens vor der Dämmerung. Über den korrekten Zeitpunkt für das Anzünden der Kerzen ist man sich in der jüdischen Welt einig: 18 Minuten vor dem vorausberechneten Sonnenuntergang. Eine klare Sache, wenn man die Korrekturen für arithmetische Rundungsfehler, atmosphärische Brechungseffekte, lokale meteorologische Bedingungen und eventuelle Gangfehler der Hausuhr vernachlässigt. Doch in der Regel brennen die Kerzen rechtzeitig und tragen ihr warmes Licht über die Grenze der Nacht. Eine praktikable einfache Regel für den Beginn lautete: Der Sabbat geht zur Neige, wenn am Samstagabend die ersten drei Sterne am Himmel zu sehen sind. |
Jesus heilte „viele“ (Mk 1,34) oder gar „alle“ (Mt 8,16). Es gab keine unheilbaren Fälle – auch war es für niemand zu spät – niemand war unveränderlich dem Tod geweiht. Der Evagelist Markus betont, dass Jesus viele und verschiedene Kranke heilte. Dabei wird deutlich der Unterschied zwischen Besessenen und anderen Leidenden gemacht. Der Evangelist Lukas schildert wie von einem Arzt zu erwarten ist: die Kranken werden von Nahestehenden gebracht, liebevoll wird jeder einzelne von Jesus empfangen, den Patienten werden die Hände aufgelegt und sie werden geheilt. Weder hier noch an anderen Stellen wird von Massenheilungen gleichzeitig berichtet, immer legt Jesus einzelnen Kranken die Hände auf, oft mit einer konkreten Frage verbunden: „was willst du, dass ich dir tun soll“ oder; „glaubt ihr, dass ich das tun kann?“ (Mk 10,51; Mt 9,28). Auch Lukas unterscheidet deutlich die Besessenen von anderen Kranken. Die Dämonen lies er dabei nicht reden, da er keine Worte (auch keine Werbung) von Seiten seines Erzfeindes: Satan hören wollte. Auf die Frage warum, die unreinen Geister Jesus als Gottes Sohn und Christus erkennen und ihn offenbaren, oder offenbaren wollen, könnte man antworten:
- Sie bangten sich besonders um ihr aktives Fortbestehen („Bist du gekommen uns zu quälen ehe es Zeit ist“ – Mt 8,29). Denn dieser Befreiungsdienst von Jesus kündigte das Ende der Herrschaft des Bösen an.
- Sie wollten Jesus sadistische Handlungen unterstellen (uns zu quälen) um ihn in Schwierigkeiten zu bringen – möglichst in einer Art, die seine Mission zum Scheitern bringen würde.
- Jesus wusste um die zwei Stufen seines Dienstes: vor der Auferstehung in Niedrigkeit und nach der Auferstehung in Herrlichkeit – er wollte hier keine voreilige Vermischung der beiden Abschnitte. Wenn er sogar seinen Jüngern angeordnet hatte, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei, um wie viel weniger wollte er sich durch die Dämonen publizieren lassen (Mt 16,20).
- auch wenn die Dämonen Richtiges sagen, verherrlichen sie nur sich selbst („wir wissen“) und schaden Jesus, darum müssen sie (außer in einem Fall – Mt 8,28-32; Lk 8,30) in der Gegenwart von Jesus schweigen.
Eine wichtige Regel im Befreiungsdienst heute sollte beachtet werden: Keine Diskussionen mit den unreinen Geistern, denn alles, was sie sagen, sagen sie zu ihrem eigenen Vorteil. Sie vertuschen die Wahrheit, oft mit sogar richtigem und frommem Gerede.
In diesen Heilungen sieht der Evangelist Matthäus, inspiriert vom Heiligen Geist, die Erfüllung einer alttestamentlichen Prophezeiung: „Jedoch unsere Leiden – er hat sie getragen, und unsere Schmerzen – er hat sie auf sich geladen“. (Jes 53,4). Diese Worte hatte Jesaja vor 722 v. Chr. gesprochen – doch sie gingen weit über seinen damaligen Horizont hinaus.
„In der erhaltenen rabbinischen Literatur tritt die Auslegung von Jes 53 auf den Messias erst seit dem 3. nachchristlichen Jahrhundert hervor; ihr bedeutendster Repräsentant ist hier der Prophetentargum. Neben der messianischen Auslegung geht die Deutung auf die Gerechten einher. Verhältnismäßig spät macht sich eine dritte Auffassung geltend. Diese jetzt im Judentum herrschende Auslegung hat zwar bereits in der Zeit des Origenes Vertreter gehabt, lässt sich aber für uns quellenmäßig erst seit Rabbi Schlomo ben Jizchak genannt: Raschi (gest. 1105 in Troyes) belegen … Rabbi Raschi legt die Frage von Jes 53,1 den Völkern der Welt in den Mund, die erst Israel für ein von Gott verworfenes Volk angesehen haben und nun erkennen, dass das Volk alle Leiden erduldet hat, nur um die Sünden der Weltvölker zu sühnen“ (Strack-Billerbeck1982, 481-485).
Ein weiterer Grund einmal den Studienort Raschi’s: Worms zu besuchen. Dort gibt es ein Raschi-Haus (Museum für jüdisches Leben in der Stadt).
Die Worte Jesajas klingen für uns so, als wären sie auf dem Hügel Golgatha angesichts der Schmerzen von Jesus gesprochen. Auf dem ersten Blick kann man den Eindruck gewinnen, als würde Matthäus über die Patienten von Jesus und Jesaja über das Leiden von Jesus sprechen. Doch dies ist kein Gegensatz, denn genau durch das Leiden von Jesus werden die Leidenden dieser Welt auf ewig geheilt.
Doch soll hier die Frage sehr deutlich gestellt werden: In welcher Weise trug Jesus unsere Leiden und Schmerzen:
- Wir lesen von seinem tiefen Mitgefühl und von seinem Erbarmen (Mt 9,36; 14,14; 20,34; Mk 1,41; 5,19; 6,34; Lk 7,13). Auch in manchen Gleichnissen teilt, öffnet uns Jesus sein Herz. Hier spricht kein „Externer“ kein ferner Gott, sondern Gott mit uns!
- Wir hören von seinem siegreichen Leiden für die Sünden aller Menschen, die den himmlischen Vater so sehr entehren. So war im übertragenen Sinne jeder Leidende für Jesus ein vorweggenommenes „Golgatha-Erleben.“
- Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Heilungen für Jesus nicht „leicht“ waren – genauso wenig wie der Zuspruch der Vergebung! Damit lud er de facto sowohl die Sünden, als auch das Leiden vorweg auf sich (1Petr 2,24).
In Jesaja 53,5 lesen wir: „(…) um unserer Vergehen willen (…)“. Letztlich ist jedes Leid auf die Ursünde der Menschheit: „Wir können ohne Gott leben!“ zurückzuführen. Die konkrete und direkte Verbindung zwischen Sünde und Leid/Krankheit wird uns allerdings nur selten offenbart – so sollten wir hier sehr zurückhaltend bleiben.
„Dass Jesaja den Schwerpunkt jedoch auf die körperliche Wiederherstellung in der messianischen Zeit und den Zusammenhang zwischen körperlicher und geistlicher Heilung in der jüdischen Überlieferung legt (Jes 33,24), lässt den Schluss zu, dass Matthäus hier ebenfalls an den Aspekt körperlicher Heilung denkt. Das Kommen von Jesus markiert den Beginn der messianischen Ära, da Jesus den Menschen bestimmte Wohltaten dieser Ära schon vor dem Kreuz zugänglich macht“ (Keener 1998, 91).
Dieser enge Zusammenhang zwischen geistlichem und körperlichem Heil lässt uns in tieferen Schichten der Details des Reiches Gottes blicken. Das geistliche und körperliche Heil stehen hier in einem inneren Zusammenhang. Jesus trennt geistliche und sozialdiakonische Arbeit nicht künstlich – es ist eins! Jesus kommt und bringt Hoffnung, Heilung, Leben…! Was für ein Abend! Doch denken wir daran, dass solche offensichtlichen Zuwendungen Gottes als Gnadengaben, beinhalten auch eine große Verantwortung (Lk 10,15).
Die Nachricht von den Wunderwerken in Kapernaum, erreicht auch Nazaret (Lk 4,23). Dieser Heilungsabend in Kapernaum unterstreicht die Aussage des Evangelisten Johannes, dass Jesus noch viele andere Zeichen tat, die nicht im Einzelnen aufgeschrieben wurden (Joh 20,30).
Fragen / Aufgaben:
- Heilt Jesus damals wie heute alle? – Ist dann Krankheit ein Zeichen der Herrschaft der Sünde?
- Warum ließ Jesus die Dämonen nicht reden?
- Was ist besonders beim Befreiungsdienst zu beachten?
- Warum gehören geistliches Heil und ein sich Kümmern um das Leid der Mitmenschen immer zusammen?
- Ist es wichtig eine Reihenfolgen festzulegen: zuerst geistliche Hilfe und sekundär auch sozialdiakonische Hilfe?
Das Missionskonzept von Jesus
Jesus betet am frühen Morgen außerhalb von Kapernaum
(Bibeltexte: Mk 1,35-37; Lk 4,42)
Die Evangelisten Markus und Lukas schreiben:
Und früh morgens, als es noch dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. (Mk 1,35-37). Als es aber Tag geworden war, ging er aus und begab sich an einen einsamen Ort und die Volksmengen suchten ihn. (Lk 4,42).
Jesus ist nicht nur ein Wundertäter, nicht nur einer der den Rabbinern seiner Zeit widerspricht. Er ist immer auch der geheimnisvolle Gottessohn, der die Einsamkeit sucht, um mit seinem Vater zu reden. Sein Herz ist bewegt von der Not der Menschen. Der Weg der Niedrigkeit (Fleischwerdung) bedarf des engen Kontaktes zum Vater – diese uns verborgene (mystische) Einheit innerhalb der dreieinigen Gottheit muss gepflegt werden. Diese Einheit ist aber auch der Ursprung für die inwendige Kraft, das Heil in Jesus und das anbrechende Gottesreich. Es ist nicht das einzige Mal, dass Jesus sich frühmorgens (wir können annehmen zwischen 3 und 6 Uhr morgens) zum Gebet zurückzieht. Der Ort des Gebets außerhalb der Ortschaft ist bewusst gewählt. Auch die Zeit, das frühe, einsame Gebet kann für manchen ein Vorbild sein.
„Bedenkt man unter welch engen Umständen Jesus wahrscheinlich mit vielen anderen Menschen in einem Haus wohnte, dann ist das freie Feld wohl der optimale Ort zum Gebet. Aus den jüdischen Schriften des 1. Jahrhunderts können wir schließen, dass in den einfachen Einraum-Häusern Galiläas 10-20 Personen lebten“ (Keener 1998, 214).
Da die Bewohner jedoch sehr früh morgens ihre Feldarbeit beginnen, musste Jesus sehr früh aufstehen um ungestört beten zu können. Doch auch diese Gebetszeit wird von Simon und anderen die nach ihm suchen gestört. Dies ist verständlich, nachdem sie die Wunder am Vorabend gesehen und erlebt haben. Für das einsame Gebet in der Abgeschiedenheit haben sie noch kein Verständnis. Von den Rabbinern aus der Pharisäerpartei sind sie öffentliches Gebet gewohnt (Mt 6,5).
Nun wäre es ja menschlich gesehen passend, hier in Kapernaum zu bleiben, doch Jesus hat noch viel vor. Andere Städte und Dörfer sollen ebenso das große Licht sehen und die wunderbare Botschaft vom angebrochenen Reich Gottes hören. Später wird er nach Kapernaum zurückkehren. Auch der Evangelist Johannes unterstreicht, dass Jesus nicht lange in Kapernaum geblieben war (Joh 2,12b – „dort blieben sie nicht viele Tage“). Mit Bezug auf Apg 1,5 können wir annehmen, dass der erste Aufenthalt in der Stadt etwa zehn Tage dauerte. Doch macht er Kapernaum zu seiner Stadt und zur Ausgangsbasis seiner Missionsreisen (Mt 9,1). Alle synoptischen Evangelisten machen deutlich, dass Jesus von hier zu seiner zweiten Galiläareise aufbricht.
Fragen / Aufgaben:
- Warum suchte Jesus die Stille der frühen Morgenstunden?
- Was für eine Entscheidung traf er?
- Warum lässt er sich nicht von seinen Freunden überreden in Kapernaum zu bleiben?
- Wie hältst du es mit dem Gebet? Erzähle mal von deinem Gebetsleben!
Das planmäßiges Vorgehen von Jesus
(Bibeltexte: Mt 4,23-25; Mk 1,38-39; Lk 4,43-44)
Folgende Aussagen von Jesus machen deutlich, dass er nach einem bestimmten Plan oder Konzept vorgeht.
„Ich muss auch anderen Städten (größere Orte) das Evangelium verkündigen, denn dazu bin ich gesandt.“ (Lk 4,43). „Lasst uns anderswohin in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus.“ (Mk 1,38-39).
Zunächst sucht Jesus die benachbarten Städte auf, zum Beispiel Betsaida und Chorazin. Dies ist im Einklang mit der Missionsstrategie, die er später seinen Jüngern verordnet (Apg 1,8): Jerusalem = E0, Judäa = E1, Samarien = E2 und das Ende der Erde = E3. E= Evangeliumskreis – dies ist eine eindrückliche Abkürzung aus der Missiologie. Jesus geht planmäßig vor, denn in seinem Dienst ist alles übersichtlich. Dieses: „Ich muss auch anderen Städten das Evangelium verkündigen“, spricht von einer klaren planmäßigen Absprache mit seinem Vater. Er ist nicht gezwungen dies zu tun, sondern er tut es freiwillig, er hat sich festgelegt, er kann nicht anders und darum: „Ich muss“.
„Er predigte in den Synagogen Galiläas“, macht erstens deutlich, dass Jesus sich der vorhandenen Einrichtungen bedient und zweitens, dass er nichts Geheimes oder Unerlaubtes tut, sondern öffentlich predigt. Dies steht im deutlichen Kontrast zum Reich-Israel Konzept der Zeloten, die heimlich eine Verschwörung gegen die Römer bilden und gegen sie gewaltsam operieren. Und so kann Jesus später bei seiner Verteidigung mit gutem Gewissen sagen: „Ich habe nicht im Verborgenen geredet.“ (Joh 18,20).
Der Hinweis: „Er trieb die Dämonen aus“, unterstreicht dass sich das Reich Gottes und damit die Herrschaft Gottes nun ausbreiten. Dieser Hinweis macht aber besonders in der Person des Gottes Sohnes deutlich, dass sich der eigentliche Kampf nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte der Finsternis richtet (Eph 6,12ff). Jesus ist der, der die Vollmacht besitzt und auch ausübt.
Während der nun folgenden Rundreise kehrt Jesus immer wieder nach Kapernaum zurück.
Fragen / Aufgaben:
- Woran kann man das planmäßige Vorgehen von Jesus in seinem Dienst erkennen?
- Warum betont Jesus immer wieder: „Ich muss“? Musste er wirklich, oder konnte er auch anders? Wo und wann betont Jesus dieses „Ich muss“?
- Wie bereitest du dich auf neue menschliche oder geistliche Herausforderungen vor?
- Warum nutzt Jesus die vorhandenen Versammlungseinrichtungen? Was könnten wir davon ableiten?
- Wie breitet sich das Reich Gottes aus und woran erkennen wir es?
- Hat Gott auch für dein Leben einen Plan? Siehst du vielleicht, wenn auch mit Einschränkungen, Gottes Konzept in deinem Leben?
Jesus besucht Betsaida
Betsaida ist die Nachbarstadt zu Kapernaum. In biblischer Zeit lag die Stadt am Westufer der Jordanmündung, denn nach Johannes 12,21 lag Betsaida in Galiläa. Die späteren Weherufe von Jesus über Betsaida machen deutlich, dass Jesus diesen Ort öfters besuchte und dort viele Wunder vollbrachte (Mt 11,21; Lk 10,13). Nach den uns überlieferten Berichten der Evangelisten hielt sich Jesus mindestens dreimal in Betsaida auf (Mk 6,45; 8,22; Lk 9,10). Doch wahrscheinlich sind nicht alle Besuche dort aufgezählt, so auch der erste, von dem es lediglich heißt, dass Jesus in die benachbarten Städte ging, darunter war sicher auch das 4 km östlich liegende Betsaida. Wie der Name des Ortes schon deutlich macht (Fischhausen), beschäftigten sich die Leute mit dem Fischfang. Da drei Jünger von Jesus aus dieser Stadt kamen, war es ein zusätzlicher Grund öfters dorthin zu gehen.
Fragen / Aufgaben
- Was bedeutet der Name Betsaida und wo lag diese Stadt?
- Suche die Stellen auf, die von einem Besuch von Jesus in Betsaida erzählen und nenne sie kurz?
- Kennst du die Nachbarortschaften deiner Stadt? Gibt es auch dort Gläubige an Jesus Christus?
Jesus besucht Chorazin
Anders steht es mit der wenige Kilometer nordwestlich von Kapernaum und auf einer Anhöhe gelegenen Stadt Chorazin. Nur einmal wird sie in den Evangelien von Jesus selbst erwähnt und zwar im Zusammenhang mit den Weherufen (Mt 11,21; Lk 10,13).
Abbildung 36 Chorazin – jetzt zwar ein Trümmerfeld, aber auch ein Zeugnis für die Wahrheit der Worte Jesu (Foto: April 1986).
Dadurch wird deutlich, dass Jesus dort viele Wunder vollbrachte und nur wenige an ihn als dem Messias glaubten. In den Jahren 1962-64 (sowie 1980-87) wurden von den Archäologen während der Grabungen Grundmauern einer Synagoge aus schwarzem Basalt freigelegt, die in das späte 3. Jahrhundert dadiert wird. Ebenso wurden verschiedene Mauerreste auf einem größeren Gelände verstreut freigelegt. Alles Hinweise, dass es sich um den Ort Chorazin handeln könnte und Jesus auch diesen Ort vielleicht sogar mehrmals besuchte und dort predigte (Mt 4,23).
Fragen / Aufgaben:
- Wo lag Chorazin und was zeichnete die Stadt aus?
- Wo wird diese Stadt in den Evangelien genannt und in welchem Zusammenhang?
Weitere Besuche in Galiläa
Auch der Evangelist Matthäus bestätigt die Tätigkeit von Jesus in ganz Galiläa. Jesus suchte den Schlüssel zu den Herzen der Menschen und ging deshalb zu den üblichen Versammlungsorten einer Kommune. Dies sind meist die Synagogen – aber auch damals schon an Marktagen die Marktplätze. Synagogen sind für alle Juden zugänglich. Niemand konnte ihm später nachsagen, dass er etwas im Geheimen getan hätte (Joh 18,20).
Hier treffen wir auf Sammelberichte von Verkündigung und Heilungen. Es ist sicher, dass die meisten Wunder, die Jesus getan hatte uns nicht berichtet werden. Die meisten die überliefert wurden, sind lokalisierbar – nur bei einigen ist der Ort des Geschehens nicht genau festzustellen. Vordergründig ging es Jesus um das Aufrichten des Reiches Gottes. Dies geschah:
- durch Wunderzeichen, griechisch: `shmei/on s¢meion` (Joh 2,11 auch bes. Joh 2,23),
- durch Lehren – die Lehre, griechisch: `dida,skwn didaskön`, war das wesentliche Mittel von Jesus bei der Aufrichtung des Reiches Gottes. Daher wird er auch immer wieder Rabbi (Lehrer) genannt. Bis heute hat die Berufsbezeichnung Lehrer im Orient hohes Ansehen.
- Durch die Verkündigung des Evangeliums. Der Begriff: `khru,sswn k¢russœn` (auch: Kerygma) bedeutet: bekanntmachen, kundmachen, ausrufen, eine wichtige Botschaft verkündigen.
Wobei bei diesen Elementen keine Rangfolge sichtbar wird, denn Jesus kümmert sich um den ganzen Menschen, da das Reich Gottes sowohl eine geistliche wie auch ein menschlich (=körperliche) Realität ist.
Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk (…) und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem Zehnstädtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordans. (Mt 4,23-25).
Hier finden wir zum ersten Mal den Begriff: `euvagge,lion euangelion` Evangelium im Matthäusevangelium. Es ist das Evangelium des Königreiches (Gottes): `th/j basilei,aj t¢s basileias` (siehe auch Mt 24,14). Dieser Sammelbericht über Reisen und Dienste in Galiläa – ohne nähere Details – betont, dass Jesus große Volksmengen nachgefolgt sind:
- Von Galiläa, dem nördlichen Teil von Palästina. Josephus weist daraufhin, das Galiläa ein dicht besiedeltes Gebiet war (Jüdische Kriege III.1). Die mit Abstand größte Stadt war Sepphoris (Jüdische Kriege II,11).
- Dem Zehnstädtegebiet, griechisch: Dekapolis, dehnte sich vom Ostufer des Sees Gennesaret in Richtung Osten und teilweise Süden aus. Die Zehn Städte: Raphana, Scytopolis (westl. des Jordans), Gadara, Hippus, Dium, Pella, Gerasa/Galasa, Kanatha, (unklar: Abila, Kanata).
- Jerusalem, Judäa
- und von jenseits des Jordans (Mt 4,25). Der Begriff „jenseits des Jordan“ weist auf das Gebiet östlich des Jordans – auch auf Peräa, (Herrscher: Herodes Antipas) und die Trachonitis – Herrschaftsgebiet des Herodes Philippus.
Auch der Evangelist Lukas vermerkt, dass die Kunde von der Tätigkeit von Jesus sich überall verbreitete und Jesus gepriesen wurde (Lk 4,14-15). Folgende galiläische Städte, die Jesus besuchte, sind in den Evangelien namentlich genannt: Bethsaida, Chorazin, Kana, Nain und Nazaret.
Jesus wird mehrere Monate lang unterwegs gewesen sein, wenn es heißt: „Er predigte in den Synagogen Galiläas“, dann könnte er wochenweise von Ort zu Ort gezogen sein. Natürlich ist er und seine Jünger auf die Gastfreundschaft der Menschen angewiesen. Diese Gastfreundschaft ist jedoch eines der wesentlichen ungeschriebenen Gesetze des Orients (leider heute nicht immer aus lauterem Motiv).
Fragen / Aufgaben:
- Wo predigte Jesus das angebrochen Reich Gottes vorrangig und warum?
- Welche Formen der Verkündigung praktizierte Jesus?
- Warum waren Heilungen, Wunderzeichen und Predigten für Jesus ein wesentliches Mittel um das Reich Gottes aufzurichten? Warum waren die Zeichen/Heilungen oder die Predigten jeweils nicht nur ein untergeordnetes Mittel zum Zweck – sondern hatten jeweils in sich eine wichtige Bedeutung?
- Auf was war Jesus während seiner Wanderschaft in Galiläa angewiesen?
Jesus beruft Levi/Matthäus in Kapernaum
(Bibeltexte: Mt 9,9-13; Mk 2,13-17; Lk 5,27-32)
Folge mir nach
Der Evangelist Matthäus verbindet in seinem Evangelium die Heilung des Gelähmten (Mt 9,1-8) direkt mit der Berufung des Matthäus. Der Evangelist schreibt: „Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus; und er sprach zu ihm: Folge mir! Und er stand auf und folgte ihm.“ (Mt 9,9). Der Evangelist Markus ergänzt, dass der Zollbeamte den Namen Levi zrug und Sohn des Alphäus war (Mk 2,14; ebenso Lk 5,27). Matthäus/Levi, Sohn des Alphäus, ist als Steuereinnehmer (τελώνην – telönèn) im Dienst des römischen Staates in der Stadt Kapernaum tätig.
„Manche Steuern wurden direkt an die römische Regierung abgeführt, Weg- und Importzoll hingegen (der normalerweise 2-3% betrug, konnte sich für Händler, die durch viele Gebiete zogen, jedoch rasch zu einem beachtlichen Betrag summieren) kam den Städten zugute, die ihn erhoben“ (Keener 1998, 217-218).
Hier in Kapernaum verliefen internationale Handelsrouten, die vielen Menschen ein gutes Einkommen sicherten.
Wir fragen uns zuerst: Wer war dieser Matthäus? Verfasste er das Matthäusevangelium? Hier begegnet uns wieder ein Argument des Schweigens. Nirgends wird Matthäus im Evangelium als Verfasser ausdrücklich genannt. Doch folgende Hinweise werfen Licht auf diese Person:
- Wir finden den Namen Matthäus in Mt 9,9; 10,3; Mk 3,18; Lk 6,15; Apg 1,13. Der Name Levi wird in Mk 2,14 und in Lk 5,27.29 erwähnt.
- Matthäus erhielt den Ruf als emsiger Steuereinnehmer im „Galiläa der Heiden“ (Herrschaftsgebiet von Herodes Antipas) und kannte von dorther mindestens Griechisch, Lateinisch und Aramäisch. Dies wird im Evangelium deutlich. Dort finden sich auch Spuren der griechischen Übersetzung des Alten Testaments (Septuaginta). Er kannte wohl auch weite Teile des hebräischen Textes gut. Matthäus scheint auch Zugang zu den hebräischen Schriftrollen gehabt zu haben.
- Steuereinnehmer verfassten schriftliche Berichte und kannten auch ein Kurzschriftsystem. Er könnte es also gewesen sein, der die Wunder und Predigten von Jesus notierte, wird doch dieser Name im Neuen Testament nur einer Person zugeordnet.
- In der frühen Kirchengeschichte findet sich sehr bald die Verknüpfung von Autor, Matthäus und Levi: Papias (zw. 125 und 140); .Irenäus (182-188); Origenes (210-250); Eusebius (4. Jh.) – auch in vielen Zitaten der frühen Kirchenväter. Hier kann man sich kaum vorstellen, wie der Name des ursprünglichen Autors verloren gegangen und durch einen anderen ersetzt worden sein könnte.
- Da über Matthäus/Levi kaum sonst etwas bekannt ist – ist es eher unwahrscheinlich, dass ihm solch ein in Stil und Inhalt einheitliches Werk fälschlich zugeschrieben worden wäre.
Levi scheint ein Steuereinnehmer gewesen zu sein, der Einfluss im Kreise seiner Kollegen und Freunde hatte. Hier fällt geradezu auf, dass Jesus seine Jünger bewusst aus sehr verschiedenen Berufen und Schichten herasruft. Die sofortige Bereitschaft zur Nachfolge könnte damit zu erklären sein, dass auch Levi schon die Taufe von Jesus durch Johannes am Jordan miterlebte. Zwar wissen wir nicht den genauen Zeitpunkt, wann Levi Jesus kennen lernte, doch nach Apostelgeschichte 1,22 und Lk 3,12 ist anzunehmen, dass alle späteren zwölf Jünger bei der Taufe des Johannes dabei waren, Jesus kannten und mit dem Zeugnis des Johannes über Jesus vertraut waren. Viele Tausende Menschen waren bei Johannes am Jordan, auch Zöllner, warum sollten nicht auch die späteren Jünger von Jesus dabei gewesen sein? Dies könnte eine Erklärung dafür se in, warum Levi sofort aufsteht und Jesus nachfolgt. Weiter kann man davon ausgehen, dass Levi Jesus öfter sieht und hört, als dieser in der Stadt weilt, redet und heilt und auch von der Stadt aus in der Gegend herum reist. Jesus wird öfter an seiner „Zollbude“ vorbeigelaufen sein. Dennoch ist dieser Wendepunkt, den Matthäus in sehr knappe Worte fasst tief in sein Gedächtnis eingeprägt!
So haben wir in diesem Bibelstudienkurs bis jetzt sieben namentlich genannte Nachfolger von Jesus: Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes, Philippus und Nathanael und nun auch Levi/Matthäus. Von den übrigen Jüngern sind keine individuellen Berufungsberichte überliefert. Erst später wird berichtet, dass Jesus von der Vielzahl seiner Jünger sich auf zwölf beschränkte und sie zu Aposteln machte.
Als Steuereinnehmer gehört Levi zu den geschulten Menschen. Lesen, Schreiben und Rechnen – natürlich auch die Gesetze der römischen Verwaltung sind die selbstverständliche Grundlage seines Berufes. Damit gehört er zum Mittelstand.
Jesus im Hause von Levi
Die Liebe von Jesus und seine Kraft verändern diesen Menschen augenblicklich und vollständig. Er, der „Sünder“ wird geliebt, von einem Rabbi wertgeschätzt und kaum auszudenken auch noch in die Nachfolge und Mitarbeit berufen. Jeder andere Rabbi hätte sich geschämt mit ihm auf der Straße gesehen zu werden. Er gehört zu dem Personenkreis, der normalerweise aus den religiösen Kreisen ausgeschlossen wird (Keener 1998, 326). Doch Jesus erklärt öffentlich, dass er 1. Wahl ist! Jesus glaubt, er könne ein guter Mitarbeiter sein – dieses Vertrauen macht ihn dann tatsächlich auch fähig dazu! Jemand „glaubt“ an ihn, darum glaubt auch er. Dies versetzt ihn in die erstaunliche Lage einen glatten Bruch mit der Vergangenheit zu wagen und sein ganzes Leben auf Jesus zu setzen. Der Evangelist Matthäus selbst macht keine Angaben zu den Kosten, die ihm dadurch entstanden. Wir finden keine Spur von Eigenlob im Bekehrungszeugnis! Der Evangelist Lukas fügt an, dass Levi „alles verließ.“ Er bezahlte wahrscheinlich einen höheren Preis als seine Jüngerkollegen aus dem Fischereigewerbe, die ja bei Bedarf in den familiären Betrieb zurückkehren (Joh 21,1ff). Levi verlässt alles, wahrscheinlich ohne die Chance dies einfach rückgängig machen zu können. Manche Ausleger vermuten hier, dass Levi nach diesem radikalen Bruch den Namen Matthäus (Gabe Gottes) annimmt oder sogar von Jesus bekommt (Hendriksen 1973, 422). Er kann aber auch schon immer einen Doppelnamen gehabt haben.
Übrigens: Leider werden andere Steuereinnehmer die entstandene Lücke sofort wieder geschlossen haben.
Nach seiner Berufung veranstaltet Levi ein Festessen zu Ehren des Rabbi Jesus in seinem Haus. Natürlich ist dies die „orientalische Revanche“ für den öffentlichen Erweis einer Ehrenbezeugung (Keener 1998, 327).. Er wird alles los und feiert als der Glücklichste dieser Welt (Hendriksen 1978, 303. Nicht ein Wort von Levi/Matthäus wird in den vier Evangelien überliefert. Umso deutlicher tritt seine Leistung in der Verfassung des Matthäusevangeliums hervor. Doch selbst wenn er kein Mann der Worte war, er macht damit deutlich, dass er ihm nachfolgen wird und er sich über die Berufung von Jesus freut. Die Tischgemeinschaft war ein Zeichen für eine enge, vertraute Beziehung. Orientalische Mahlzeiten sind echte Gelegenheiten, um einander besser kennen zu lernen. Wahrscheinlich sitzen/liegen die Männer in der Runde auf Teppichen mit den Füßen nach außen und mit dem Angesicht einander zugewandt. Der Ehrengast wird vom Gastgeber gebeten sich ganz oben mit Blick auf den Eingang zu legen (Lk 14,10).
Natürlich lädt Matthäus seine Arbeitskollegen ein: all die Gierigen, die Unpatriotischen, die Verräter, die Unehrlichen, die Gehassten – ja das waren sie wirklich… nicht nur in den Augen der Pharisäer. Wen sonst soll er auch einladen? Doch so wird er zur Schlüsselperson für diese „Randexistenzen“. Sie alle sollen es mitbekommen, dass er jetzt diesem neuen Lehrer nachfolgt. Sie kommen alle und sehen in Jesus wohl einen Freund. Aber für Matthäus ist klar, er muss seinen sicheren und auch einträglichen Beruf aufgeben. Die Nachfolge von Jesus fordert ihn und alle Nachfolger nach ihm immer zu einem Wagnis heraus. Natürlich verspricht Jesus für seine Diener zu sorgen, doch zunächst ist da keine Garantie, dass alles besser wird. Hier Abenteuerlust zu vermuten, ist daher eher abwegig. Levi war verheiratet (1Kor 9,5) und behält sein Haus in Kapernaum, in dem seine Familie weiterlebte. Und ebenso ist anzunehmen, dass Jesus sich in seinem Haus nicht zum ersten und letzten Mal aufgehalten hat.
Nicht Heilige – sondern Sünder
Wahrscheinlich am Ende des Festes gerade als die Gäste Haus und Hof verlassen, werden sie von Pharisäern und ihren Schriftgelehrten empfangen. Es gab an diesem Fest nichts zu bemängeln außer der Zusammensetzung der Gäste. Doch die anschließende Streitfrage offenbart die Tiefe des Konfliktes. Jesus soll Stellung nehmen zu dem Heilsweg des gesetzlichen Judentums mit den vielen meist sehr äußerlichen Forderungen. Hier sind es die Speisegesetze die eine Tischgemeinschaft mit Unreinen ausschließen. Denn als Kollaborateure verunreinigen sich Zöllner sicherlich bei ihren heidnischen Auftraggebern, allein schon wenn sie deren Häuser betreten. Die Rabbis kennen keine Vergebung der Sünden frei und ohne Vorbedingungen. Die Jünger von Jesus werden unzufrieden gefragt: „Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern“? Sie wollen Jesus attackieren, auch wenn sie sich etwas feige nur an die Jünger wenden. Sie wollen Jesus zurechtweisen, denn er verhält sich entgegen ihren Verhaltensmustern. Auch wollen sie Spott über die Jünger ausgießen: „So einer soll euer Rabbi sein?“ Das Muster ist immer aktuell: durch Ironie und Spott verunsichern! Doch für Jesus ist diese Frage ein Anlass, um sowohl den Pharisäern als auch den Steuereinnehmern seinen Auftrag bekannt zu machen. Er antwortet mit einem sehr passenden Bibelzitat, dessen Zusammenhang zu Untreue, Ehebruch und Gottlosigkeit alle Leser der Schriften kannten: „Geht aber hin und lernt, was das ist: «Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer“ (Hos 6,6) und mit einem Sprichwort: „Ich bin nicht gekommen Gerechte zur Buße (zum Umdenken) zu rufen, sondern Sünder“. Der griechische Begriff `μετανοία metanoia` bedeutet Gesinnungsänderung. Konventionen und Sitten sind Jesus nicht wichtiger, als die gute Botschaft zu Menschen zu bringen. Er ist der Arzt, der sich den „Infizierten“ nähert, hilft und heilt – doch ohne selbst von der gleichen „Seuche“ befallen zu werden. Echte Jesusjünger werden auffallen und aus dem normalen Rahmen fallen. Doch Mitmenschen werden kritisch bei ihnen nachfragen. Mit den „Gerechten“ meint Jesus die Pharisäer. Doch spielt er hier auf die reine Werkgerechtigkeit an, eine verdiente Gerechtigkeit und keineswegs die Gerechtigkeit, die von Gott ausgeht. Steuereinnehmer machen jedoch im Gegensatz zu den gerechten Pharisäern keinen Hehl aus ihrem „sündigen“ Leben. Doch Steuereinnehmer gehören zu denen, die zum Teil schon am Jordan Buße taten und sich von Johannes dem Täufer taufen ließen. So bezeugte Jesus etliche Zeit später im Rückblick: „Und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Aber die Pharisäer und die Lehrer des Gesetzes verwarfen für sich Gottes Ratschluss und ließen sich nicht von ihm taufen.“ (Lk 7,29-30). Die Zöllner suchen jetzt die Nähe von Jesus und hören ihm gerne zu. Damit teilen sich auch hier die Bewohner Kapernaums in zwei Lager, die einen halten sich zu Jesus und die anderen stellen sich gegen ihn. Doch der universale Heils-Ruf geht ausdrücklich an alle – nur für alle gilt das Gleiche: als Sünder = Gottferne müssen sie sich einstufen lassen. Wie aktuell!
- Äußere dich zu den wenigen Details aus dem Leben des Levi/Matthäus! Was fällt dir auf?
- Warum folgt Levi Jesus sofort nach?
- Was hast du in der Jesus-Nachfolge aufgegeben, was erhalten?
- Warum lädt Levi Jesus zu sich nach Hause ein?
- Wieso ärgern sich die Pharisäer an Jesus und seinen Jüngern? Was ist an ihrem Verhalten so anstößig?
- Sind wir bei den Meckernden oder Feiernden?
- Hast du auch schon kritische oder negative Anfragen zu deinem christlichen Lebensstil erhalten?
Jesus beruft zwölf Jünger
(Bibeltexte: Mt 10,1-4; Mk 3,13-19; Lk 6,12-16)
Eine wichtige Entscheidung
Die Berufung der zwölf Jünger erfolgte höchstwahrscheinlich noch vor der Berglehre in der Nähe von Kapernaum (Lk 6,12-14; Mk 3,13-19). Der Evangelist Matthäus berichtet nicht von der Berufung, sondern setzt sie in Mt 10,1f voraus. Inzwischen hat Jesus eine beachtliche Zahl von Jüngern, die ihm nachfolgen. Die Zwölf sollen von Jesus als feste und beständige ´μαθητές – math¢tes´ Jünger/Schüler in die Nachfolge berufen werden. Sie sind mit der Berufung Jünger/Schüler, wie die Evangelisten sie meistens auch bezeichnen. Jesus gibt ihnen zwar gleich bei der Berufung den Status der Gesandten,´απόστολος – apostolos´ Apostel, doch werden sie in der Vorbereitungszeit nur gelegentlich so bezeichnet (Mk 3,15; 6.30; Lk 6,13; 24,10; Apg 1,2.26). Nach Pfingsten bezeichnet man alle Gläubigen als Jünger. Die Zwölf werden ab dann regulär mit dem Titel Apostel bezeichnet.
Doch immer ist eine Berufung zum Dienst ein großes Wagnis. Jesus legt erst für sich allein eine Gebetsnacht auf einem Berg ein und beruft dann seine zwölf engsten Vertrauten. In dieser Nacht ringt er im Gebet und Gespräch mit dem Vater. Jesus muss auswählen – doch diese Wahl ist nicht einfach. Welche Kriterien sollen den Ausschlag geben? Er, der alles klar sah – hätte er nicht bessere aussuchen können? Hätte er nicht Judas aus Iskariot ganz außen vor lassen müssen? Wir merken sehr bald: er hat sich nicht die Besten, die Begabtesten und Angesehensten ausgesucht. Excellenz ist nicht das Kriterium von Jesus. Es ist aber auch nicht:
- Charakter
- Herkunft
- sozialer Status
- Bildung
- Motive und Erwartungshaltung.
Im Weiteren bemerken wir immer wieder, das die Jünger noch lange nicht mit dem Heils- und Reichs-Gotteskonzept, dem Lebensstil und der Lehre von Jesus konform waren.
Wie auch die zwölf Stammesväter Israels (die Söhne/Enkel Jakobs) sehr unterschiedlich, ja zum Teil gegensätzlich waren und doch das gesamte Israel repräsentieren, so wählt auch Jesus zwölf ganz unterschiedliche Männer aus. Allerdings nicht aus jedem Stamm einen Repräsentanten, denn der größte Teil der jüdischen Zeitgenossen versteht sich als Nachfahren aus dem Stamm Juda, Levi und Benjamin – die Stämme des früheren Nordreiches und des Ostjordanlandes blieben verstreut und vielfach vermischt mit anderen Völkern. Kein Wunder, dass von keinem der zwölf Jünger von Jesus die Stammeszugehörigkeit bekannt ist. Natürlich hätte Jesus die Stammeszugehörigkeit bei jedem der zwölf Jünger wissen oder erfahren können. Doch anscheinend spielte für ihn diese verwandtschaftliche Abstammung aus einem bestimmten Stamm keine Rolle. Alle Jünger waren nach Ansicht der Schriftgelehrten: theologisch ungelehrte Laien (Apg 1,11; 4,11). Keiner von ihnen hatte also vorher schon die Chance gehabt einem offiziell anerkanntem Rabbi und seiner Lehre nachzufolgen. Wir können also schon sagen, dass sie religiös gesehen alle zum „B-Team“ gehören, die es einfach nicht ins „A-Team“ geschafft haben. Auffällig ist auch, dass sie alle aus der nördlichen Region Israels stammen. Galiläa, bekannt als galil ha-gojim Galiläa der Heiden. Die Galiläer stehen damals bedingt durch das enge Zusammenleben mit der zahlreichen nichtjüdischen Bevölkerung bei der geistlichen Elite in Jerusalem nicht gerade hoch im Kurs (Joh 7,52; Apg 2,7). Jesus wählt die zwölf Repräsentanten seines neuen geistlichen Volkes wohl bewusst konträr zu menschlich gesehen nahe liegenden Wahlmethoden. Jesus ist so vollständig unabhängig von den gängigen Meinungen und investiert in diese zwölf Jünger. Elf von Ihnen werden dieses „Vertrauen“ rechtfertigen. Sie repräsentieren das Volk Gottes genau in der Brückenzeit zwischen Altem und Neuem Testament. Sie sind der innere Kern und später die Leiter des neuen Gottes Volkes: der ersten Gesamtgemeinde – Berufene aus Israel und den Nationen (Mt 10,5-6; vgl. auch Am 9,11 mit Apg 15,16 und Mt 28,19-20).
Jüngerlisten
(Bibeltexte: Mt 10,1- 4; Mk 3,16-19; Lk 6,13-16; Joh 21,1-3; Apg 1,13)
Die folgende Liste ist ein Versuch die verschiedenen Informationen über die Jüngerlisten zu ordnen:
| Matthäus | Markus | Lukas | (Johannes) | Apostelgeschichte |
| Simon Petrus | Simon Petrus | Simon Petrus | Simon Petrus | Petrus |
| Andreas | Jakobus (Boanerges) | Andreas | Johannes des Zebedäus | Johannes |
| Jakobus | Johannes (Boanerges) | Jakobus | Andreas aus Betsaida | Jakobus |
| Johannes | Andreas | Johannes | Jakobus des Zebedäus | Andreas |
| Philippus | Philippus | Philippus | Philippus | Philippus |
| Bartholomäus | Bartholomäus | Bartholomäus | Natanael von Kana | Thomas |
| Thomas | Matthäus desAlphäus | Matthäus | Thomas der Zwilling | Bartholomäus |
| Matthäus, Steuereinnehmer | Thomas | Thomas | Matthäus | |
| Jakobus des Alphäus | Jakobus des Alphäus | Jakobus des Alphäus | Jakobus des Alphäus | |
| Thaddäus | Thaddäus | Simon genannt der Zelot | Simon der Zelot | |
| Simon Kananäus | Simon Kananäus | Judas Bruder des Jakobus | Judas des Jakobus | |
| Judas Iskariot | Judas Iskariot | Judas Iskariot | Judas, Sohn des Simon Iskariot |
Es fällt auf das die Liste in drei Gruppen von je vier Personen einteilbar ist. Dann sind die Namen der jeweils ersten in der Gruppe in allen Listen identisch. Manche Handschriften nennen hier auch: Lebbäus (Herz) genannt Thaddäus (Lobpreis).
ANMERKUNG: Manche Ausleger halten deshalb Thaddäus mit Judas des Jakobus für identisch und Simon Kananäus mit Simon den Zeloten. Kananäus kann die Region beschreiben, aber auch die Umschreibung für die Bewegung der Zeloten.
- Simon Petrus, Geburtsname Simon (Simeon), Sohn des Johannes (Jonas), stammt aus Betsaida, wohnt und arbeitet in Kapernaum, ist verheiratet und wird in den Jüngerlisten immer an erster Stelle genannt. Der Name Simon/Simeon erinnert an den Stammvater gleichen Namens und stammt von dem hebräischen Wort Shim’on, was „erhören“, „hörend“, „verstehend“ bedeutet. Den hebräischen Beinamen Fels = Kephas (griechisch: ´pe,troj petros) bekam er von Jesus zugesprochen und so wurde er in der Westkirche – lateinisch geschrieben – zum Petrus. Er wird insgesamt 198-mal im NT erwähnt, davon 29-mal mit dem Doppelnamen und 18-mal einfach als Simon.
- Johannes, der Sohn des Zebedäus und der Salome; Bruder des Jakobus wird am weithäufigsten im NT erwähnt. Die Familie des Zebedäus hat verwandtschaftliche Beziehung zur Familie von Jesus. Johannes ist die griechische Form des hebräischen Yochanan (יוחנן) und bedeutet „der Herr (JHWH) ist gnädig“ bzw. „der Herr sei mir gnädig“. Etwa 34-mal wird Johannes im NT erwähnt und nimmt neben Petrus in der ersten Gemeinde eine besondere Stellung ein. Johannes und Jakobus erhalten von Jesus den Beinamen: ´βοανεργές – boanerges – Donnersöhne´. Dies mag vielleicht auf ihr feuriges oder hitziges Temperament zurückzuführen sein (Lk 9,54) oder gibt Jesus ihnen damit etwas auf ihren Lweiteren Lebens- und Dienstweg. Während Jakobus als erster sein Leben vollendet – wird wohl Johannes der Jünger gewesen sein, der am längsten lebte.
- Jakobus, Sohn des Zebedäus finden wir an dritter Stelle in den meisten Listen. Dieser Name erinnert an den Stammvater Jakob (Fersenhalter-Lügner). Dies entspricht auch der Häufigkeit seiner Erwähnung im Neuen Testament. Wir finden seinen Namen 20-mal. Er gehört zum Dreierkreis, den Jesus immer wieder zu besonderen Anlässen mitnimmt. Von den Aposteln erlitt er als erster den Märtyrertod (Apg 12,2). Seine Familienangehörigen leben in Kapernaum und er arbeitet mit ihnen bis zu sejner Berufung im väterlichen Fischereiunternehmen.
- Andreas, sein Name bedeutet männlich oder mannhaft, er ist der vierte in zwei Listen, gehört chronologisch gesehen eigentlich zu den ersten zwei Jüngern, die Jesus schon seit der Begegnung am Jordan nachfolgen. Er scheint im Schatten seines viel bekannteren Bruders Simon Petrus zu bleiben. Er wird nur zwölf Mal erwähnt. Wie sein griechischer Name und auch die Episode mit den Griechen auf dem Passa-Fest in Jerusalem verraten, ist er wohl stark in der griechischen Kultur verwurzelt.
- Philippus, sein Name bedeutet Pferdefreund, er ist immer der erste im zweiten Drittel der Jüngerlisten. 15-mal wird er erwähnt und scheint eine recht aufgeschlossene Person zu sein. Er lässt sich zuerst auf Jesus näher ein und bringt auch Nathanael zu ihm. Später wird er gerne von Interessenten angesprochen. Er kommt wie Petrus und Andreas ursprünglich aus Betsaida.
- Nathanael, sein Name bedeutet: Gott hat gegeben. Er kommt aus Kana in Galiläa und ist nur im Johannesevangelium mit diesem Namen genannt (Joh.1,45.46.47.48; 21,2). Obwohl er mit diesem Namen in den übrigen Apostellisten nicht vorkommt, ist es unwahrscheinlich, dass er nicht zum Zwölferkreis gehört. In Joh 1,51 sagt Jesus zu Nathanael und den anderen gewandt (wörtlich übersetzt): „Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes hinaufsteigend und herabsteigend auf den Sohn des Menschen.“ Und in Joh. 21,2 wird er als Jünger bezeichnet. Dies können Hinweise sein, die dafür sprechen, dass Bartholomäus und Nathanael ein und dieselbe Person sind: Bartholomäus ist auch kein aramäischer Eigenname, sondern bedeutet „Sohn des Tholmai.“ Weiter spricht für diese Verbindung, dass in den Apostellisten Bartholomäus immer gleich nach Philippus genannt wird, welcher ihn zu Jesus geführt hatte.
- Thomas, sein Name stammt aus dem aramäischen te’oma (תאומא) und bedeutet „Zwilling“. Mit seinem Namen verbindet sich bis heute sein anfänglicher Zweifel oder Unglaube bzgl. der Auferstehung von Jesus.
- Levi / Matthäus der Zöllner, den Lukas in der Berufungsgeschichte Levi nennt, bekommt bei Markus die verwandtschaftliche Zuordnung „(Sohn) des Alphäus.“ Levi erinnert an den Stammvater, die Bedeutung des Namens ist unsicher, evtl.: „verbunden mit“. Matthäus ist eine aramäische Zusammensetzung aus mattath = das Geschenk, die Gabe und Jahwe.
- Jakobus des Alphäus (Sohn) zur Unterscheidung von Jakobus des Zebedäus’ Sohn. In Mk 15,40 wird er wahrscheinlich auch `του μικρού, tou mikrou` der Geringere (manche übersetzen auch: der Jüngere) genannt.
- Simon aus Kana gehörte wohl zur Gruppe der Zeloten (Euferern), den jüdischen Nationalisten. Die Zeloten (…) obwohl es sich streng genommen um keine religiöse Partei im Sinne der bisher beschriebenen Gruppen handelt. Wollte man sie mit modernen politischen Bewegungen vergleichen, könnte man die Zeloten am ehesten als Guerillero-Bewegung bezeichnen. Die Römer und unsere Hauptquelle Flavius Josephus diffamieren sie als „Räuber“.
- Thaddäus, sein Name bedeutet: Lobpreis oder großherzig, mutig, der auch ‚Judas des Jakobus’ heißen könnte und wohl wie oft üblich einen Doppelnamen führte.
- Judas Iskariot „Mann aus Kiriot?“, der Jesus hernach verriet, übergab, auslieferte, verkaufte, bildet in allen Listen den Abschluss. Der Name ist abgeleitet von jadah = loben, preisen. Judas folgt Jesus ohne Unterbrechung, auch als viele andere gehen, bleibt er dabei. Es ist wohl zwecklos zu spekulieren, warum Jesus Judas auswählte. Jesus teilt es uns nicht mit. Er wird im Rückblick vom Evangelisten Johannes als Dieb bezeichnet (Joh 12, 6), er verwaltete die gemeinsame Kasse. Judas ist der Jünger, der Reue zeigte, jedoch nicht umkehrte, obwohl die Gnade des Vaters auch ihm galt.
Diese zwölf wählte Jesus als aktiven und ständigen Schülerkreis, um sie dann später zum Predigt- und Heilungsdienst auszusenden. Er schweißt sie in ca. dreieinhalb Jahren zu einem handlungsfähigen Team zusammen, das die Basis für die Gemeinde und das Reich Gottes bilden wird. Die Kraft, Weisheit und Liebe von Jesus verwandelt ein „B-Team“ in das „A-Team“ von dem alle Teams der Kirchengeschichte sich ableiten werden.
Fragen / Aufgaben:
- Welcher aus dem Jüngerkreis fällt dir besonders auf?
- Wie beurteilst du die Auswahl von Jesus?
- Warum sind erhebliche Unterschiede in einem Team von Vorteil?
- Nenne praktische Details, was dieses Team zusammenhielt und zu einer Einheit machte!
Die acht Seligpreisungen
(Bibeltexte: Mt 5,1-12; Lk 6,20-25)
Zeit und Ort der Berglehre (Seligpreisungen)
Der Evangelist Matthäus berichtet über die Berglehre von Jesus ziemlich am Anfang seines Evangelienberichtes. Er beschreibt die Berufung der Jünger nicht wie die Evangelisten Markus und Lukas gesondert, sondern setzt sie einfach voraus. Es wäre schon ungewöhnlich, wenn Jesus seine Grundsatzrede über das Reich Gottes nicht in der Gegenwart seines kompletten Jüngerteams gehalten hätte. So lesen wir in Matthäus 5,1-2: „Und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie (…).“
Der Evangelist Lukas nennt erst die Details der Berufung der Zwölf und berichtet gleich danach auszugsweise aus der Berglehre. So kann die Berglehre von Jesus zeitlich ungefähr in die erste Hälfte der ersten Dienstperiode in Galiläa eingeordnet werden – das wäre ca. Herbst 29 n. Chr. Die lange kirchliche Tradition im Heiligen Land sieht den Ort der Berglehre im Nordwesten von Kapernaum, an der Stelle, wo heute die Kirche der Seligpreisungen steht. Dort finden wir weniger einen Berg, sondern eher eine flach abfallende Anhöhe, von der man über Kapernaum und dann weit über den See Gennezaret schauen kann.

Abbildung 39 Die Kirche der Seligpreisungen auf einer Anhöhe im Nordwesten von Kapernaum (Foto: April 1986).
Er merkt weiter an, dass Jesus vorher die ganze Nacht betete und am frühen Morgen aus der Vielzahl seiner Jünger, zwölf ausrählte und zu Aposteln berief. Es gibt einige Hinweise, dass Jesus viel mehr Jünger hatte, als uns bekannt sind (Joh 4,1; Lk 6,17; 19,37). Es ist möglich, dass aus dieser Vielzahl später einige zu den siebzig gehörten.
Auf dem vom Evangelisten Lukas beschriebenen ebenem Platz, setzt sich Jesus in die Mitte seines Jüngerkreises und spricht zu ihnen. Doch offensichtlich konnte auch das ganze Volk mithören. Der Evangelist vermerkt auch, dass von verschiedenen Gegenden Menschen gekommen waren, um ihn zu hören und um von ihren Krankheiten geheilt zu werden.
Der Evangelist Matthäus unterbricht die anfängliche Reihenfolge der Taten von Jesus mit den Details aus der Berglehre. In ihr fasst er das geistliche Programm des anbrechenden Reiches Gottes zusammen.
Die Berglehre von Jesus bildet eine Schatzkammer von lauter kostbarer Perlen. Acht davon sind in den sogenannten Seligpreisungen eingefasst. Wir machen uns nun auf die Suche und Entdeckung dieser geistlichen Schätze.
In der folgenden Tabelle sind alle acht Seliogpreisungen aufgelistet wie sie uns die Evangelisten Matthäus und Lukas aufgeschrieben haben. Dabei werden wir feststellen, dass Lukas zu dem auch noch Weherufe aufgeschrieben hat und damit werden die Aussagen von Jesus vollständiger.
Fragen / Aufgaben:
- Suche in einem Bibelatlas, wo in etwa die sogenannte Bergpredigt von Jesus gehalten wurde.
- An wen richtet Jesus seine Berglehre?
- Welche Evangelisten haben in ihren Berichten die Berglehre aufgezeichnet?
- Warum beschreibt der Evangelist Matthäus die Zusammenfassung einiger wichtiger Reichsgottesinhalte gleich am Anfang seines Evangelienberichtes?
- Aus welchen Lehrbereichen besteht die Berglehre?
Liste der Seligpreisungen
| Matthäus | Lukas |
| 1. Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer gehört das Reich der Himmel | Glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes
Aber wehe euch Reichen! Denn ihr habt euren Trost dahin |
| 2. Glückselig die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden | Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen
Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen |
| 3. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie sollen das Erdreich besitzen | |
| 4. Glückselig die Hungernden und Dürstenden nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden | Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden
Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern |
| 5. Glückselig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen | |
| 6. Glückselig die Reinen im Herzen, denn sie werden Gott schauen | |
| 7. Glückselig die Friedfertigen, denn sie sollen Gottes Kinder heißen | |
| 8. Glückselig die Verfolgten wegen Gerechtigkeit, denn ihnen gehört das Reich der Himmel
Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln; denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren |
Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden um des Sohnes des Menschen willen.
Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten Freut euch an jenem Tag und hüpft! Denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel; denn ebenso taten ihre Väter den Propheten |
In den nächsten Abschnitten werden wir die acht Seligpreisungen näher betrachten.
Fragen Aufgaben:
- Stelle die Ähnlichkeiten, bzw. Ergänzungen und Unterschiede bei den Evangelisten fest.
- Welche Seligpreisung fällt dir positiv und welche evtl. negativ auf?
- Bewerte die Verschiedenheit in den Berichten.
- Warum waren und sind diese Seligpreisungen in jedem Kulturkreis immer irgendwie störend?
- Welche Seligpreisung würde in der Umsetzung deinen Alltag in Familie, Beruf und Gemeinde stark verändern?
- Welche Seligpreisung könnte für dich Priorität in der Umsetzung gewinnen?
Die 1. Seligpreisung
(Bibeltexte: Mt 5,3; Lk 6,20)
Nach dem Text des Evangelisten Matthäus beginnt Jesus seine Lehre mit: „Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer gehört das Reich der Himmel.“ (Mt 5,3). Nach dem Text des Evangelisten Lukas: „Glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes.“ (Lk 6,20). „Aber wehe euch Reichen! Denn ihr habt euren Trost dahin.“ (Lk 6,24).
Wir entdecken zunächst gewisse Unterschiede in den Vormulierungen der beiden Evangelisten. Während im Text des Evangelisten Lukas nur allgemein die `Armen` glückselig gepriesen werden, ergänzt der Text des Evangelisten Matthäus mit `Armen im Geist`. Nach der Formulierung des Lukas wendet sich Jesus direkt an seine Jünger. Nach Matthäus sind allgemein alle angesprochen, welche die Voraussetzungen für solche Seligpreisung erfüllen oder erfüllen werden. Nach dem Text des Evangelisten Lukas hat Jesus noch als deuitlichen Kontrast einen Weheruf über die Reichen ausgesprochen.
Hätten wir nur den Bericht des Lukas, würden wir einseitig an die materiell Armen und Reichen denken. Und diese Einseitigkeit würde auch verschiedenen Aussagen der Schrift widersprechen, denn weder sind die materiell Armen automatisch glückselig oder glücklich, noch sind die Reichen wegen ihres Reichseins automatisch unglückselig. Einige der Jünger konnte man keineswegs zu den materiell Armen zählen. Doch auch die vollständigere Aussage des Matthäus „Glückselig die Armen im Geiste“ meint auch nicht einfach die geistig Schwachen oder gar geistig behinderten Menschen. Waren doch auch die zwölf Jünger geistig gesehen weder hochintelligent, noch geistig unterentwickelt.
Der griechische Begriff `πνεύμα – pneuma` wird sowohl für den Geist Gottes, als auch den Geist des Menschen verwendet. Im Text des Matthäusevangeliums geht es eindeutig nicht um den Geist Gottes, denn arm sein im `Geiste Gottes`, oder `geistlich` arm sein, wäre nicht im Sinne von Jesus. Doch was meint Jesus denn mit `arm im Geiste`? Unserer Erkenntnis nach geht es hier um eine bewusste und reale, auf Gott bezogene oder von Gott her definierte Einschätzung des wahren Zustandes eines Menschen. Wie so oft, füllt Jesus ganz natürtliche Worte mit geistlichem Inhalt. (Joh 6,63: „Die Worte die ich zu euch rede sind Geist und sind Leben“). Ein Blick in die Psalmen und Propheten, so wie neutestamentliche Aussagen und Beispiele aus dem Erleben mit Jesus, macht es uns leicht diese Seligpreisung zu verstehen.
Der Prophet Jesaja schreibt: „Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist: In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen.“ (Jesaja 57,15). Oder: „Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort.“ (Jes 61,2). Der Psalmist David schreibt: „Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es; Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist (pneuma); ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten.“ (Psalm 51,18-19). Der König David erkannte, bekannte, beugte und demütigte sich vor Gott in seinem Herzen wegen seiner Sünden (Ehebruch, Mord). Im Gegensatz dazu war die religiöse Elite zur Zeit von Jesus reich im Geiste – selbstbewusst, selbstsicher, selbstgerecht, stolz auf ihre detailierten Kenntnisse der Überlieferungen der Ältesten.
Bei dieser Seligpreisung geht es um Menschen, von denen es heißt: „Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich.“ (Mt 18,4).

Abbildung 40 Der See Genezaret bei Kapernaum, in dessen Nähe Jesus die sogenannte Bergpredigt gehalten hat (Foto: April 1986).
Es geht also darum, sich vor Gott in seinem realen Zusatand (arm, bloß, ungelehrt, unmündig, unfähig, sündig) zu erkennen, zugeben und auch bekennen. Es geht auch darum, sich vor Gott zu demütigen und in der Gegenwart der Heilgkeit Gottes den eigenen Stolz und Besserwisserei zerbrechen zu lassen. Diesen Menschen spricht Jesus Glückseligkeit zu. Beispiele: Der Zöllner: Lukas 18,13-14; Simon/Petrus: Lk 5,8. Es geht dabei nicht um angenehme Befindlichkeit oder äußeres Wohlgefühl, sondern um eine Zusage, einen Zuspruch von Jesus – er nennt solche Menschen glückselig.
Es fällt auf, dass diese Armut im Geiste von Gott nicht mit Reichtum oder anderen irdischen Werten belohnt wird. Es geht um das Teilhaben am Reich Gottes. Matthäus verwendet mit Vorliebe die Bezeichnung `Reich der Himmel`, man kann auch übersetzen mit: Königreich der Himmel (gr. `βασιλεία των ουρανών – basileia tön ouranön`). Womöglich ist diese Bezeichnung eine Anlehnung an Daniel 7,14. Offensichtlich führt Jesus in seiner Verkündigung diese Bezeichnung bewusst ein um deutlich zu machen, dass es sich dabei nicht mehr um das alttestamentliche, irdische, territoiell- und zeitlich begrenzte Reich Israel oder Reich Juda geht. Diese Menschen sind Bürger, Teilhaber und Mitgestalter dieses göttlichen Reiches.
Fragen / Aufgaben:
- Jesus spricht eine Sprache, die sich von der, der Schriftgelehrten unterscheidet. Verstehen die Menschen ihn in seiner Lehre?
- Was ist zu beachten bei der Auslegung der Worte von Jesus? Wie kann man feststellen, wann etwas wörtlich gemeint ist und wann die Bedeutung des Wortes oder der Aussage im übertragenen Sinne zu verstehen sind?
- Wen meint Jesus mit den `Armen im Geiste`?
- Jesus spricht oft vom Reich Gottes oder dem Reich der Himmel. Was meint er damit? Worin unterscheidet sich das Reich Gottes, welches von Jesus gepredigt und ausgebreitet wurde, vom Reich in dem er als galiläischer Bürger lebte?
- Was bedeutet der Begriff `Glückselig`?
- Welchen Anteil können Menschen `arm im Geist` am Reich Gottes haben?
Die 2. Seligpreisung
Während in der ersten Seligpreisung ganz konkret vom Geist des Menschen die Rede ist, liegt die Betonung in der zweiten Seligpreisung auf dem Gemüt des Menschen, auf seiner Empfindungsfähigkeit. Auf der Fähigkeit bewusst emotional zu empfinden und auch zu reagieren.
Abbildung 41 Blick vom Berg der Seligpreisungen auf das Nord- und Ostufer des Sees von Genezaret (Foto: Juli 1994).
Im Text des Evangelisten Matthäus lesen wir weiter: „Glückselig die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden.“ (Mt 5,4).
Es ist geradezu auffällig, dass sowohl die erste als auch die zweite Seligpreisung in der messianischen Verheißung aus Jesaja 61,1-3 enthalten ist. Dort steht geschrieben:
Der Geist des Herrn, HERRN, ist auf mir; denn der HERR hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden1 (nach LXX Armen) frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des HERRN und den Tag der Rache (Vergeltung) für unsern Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinthen der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des HERRN, dass er sich durch sie verherrlicht. (Jes 61,1-3).
Der in Matthäus 5,4 werwendete griechische Begriff `πενθούντες – penthountes` wird mit Trauernde oder Leidtragende übersetzt (πένθος – penthos -Trauer). Jesus spricht hier von Menschen, die aktiv und nachhaltig Leid tragen, Trauern über ihr Fehlverhalten. Auch diese Frohe Botschaft ist bereits im Alten Testament vorausgesagt worden. So lesen wir in Jesaja 57,18-19: „Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben; und denen, die da Leid tragen will ich Frucht der Lippen schaffen. Friede, Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der HERR; ich will sie heilen.“
- Dieser tiefgreifende Trost gilt allen, die über ihr eigenes Versagen, ihre eigene Sünde, ihre eigens verursachte Ungerechtigkeit Leid tragen und trauern (vgl auch 2Mose 33,4). Diesen Menschen wird Trost versprochen, Trost durch Vergebung der Schuld. Trauern ist sehr oft mit Weinen verbunden und bildet den Gegensatz zum überheblichen und oberflächlichem Gelächter. So ergänzt Lukas in seinm Text den Matthäus: „Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen.“ (Lk 6,25 vgl. dazu auch Hes 27,31).
Was Jesus hier ausspricht, setzt er später in seinem Dienst ganz praktisch um. Die Stadtbekannte Frau, die sich Jesus näherte im Haus des Pharisäers Simon, trauerte und weinte über ihr sündiges Leben. „Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war; und als sie erfahren hatte, dass er (Jesus) in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl.“ (Lk 7,37-38). Der Trost blieb nicht aus, denn Jesus nimmt sie in Schutz vor Simon wenn er sagt: „Denn ihre vielen Sünden sind ihr vergeben“ und zu der Frau gewandt: „Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden!“ (Lk 7,50).
Die Verheißung des `getröstet werden` löst Jesus also schon hier und jetzt ein, doch erst in der Neuen Welt wird sie vollkommene und ununterbrochene Realität werden, so die Aussagen in dem prophetischen Buch des Jesaja und der Offenbarung des Johannes:
- Jes 25,8: „Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott der HERR wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen; denn der HERR hat’s gesagt.“
- Offb 7,17: „(…) denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. (Offb 7,17).“
- Offb 21,4: „(…) und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid (wörtlich: Trauer) noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.“
Was für eine Aussicht !
Fragen / Aufgaben:
- Wer sind Trauernde und Leidtragende?
- Warum ist das Leidtragen über die bewusst begangenen Sünden eine der wichtigen Voraussetzungen für die Wiedergeburt eines Menschen?
- Was beinhaltet die Verheißung des getröstet werden?
- Wann löst Jesus dieses Versprechen ein?
Die 3. Seligpreisung
„Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen (erben).“ (Mt 5,5).
Es ist nicht einfach diese Seligpreisung zu verstehen, einmal wegen dem Begriff `Sanftmut` und wegen der Verheißung `die Erde zu erben`. Wir fangeNeun hier einmal vom Ende an und fragen, was meint Jesus mit „die Erde erben“?
Abbildung 42 Vom Berg Nebo aus reicht der Blick weit über den Jordangraben jn das Land der Verheißung (Foto: 7. November 2014).
In den meisten Stellen der Bibel ist mit Erde unser Planet gemeint, den Gott geschaffen hat mit allem was darinnen ist (1Mose 1,1-2,24) und diese Erde gehört Gott, wie aus Psalm 24,1 deutlich und unmissverständlich hervorgeht: „Ein Psalm Davids.“ Die Erde ist des HERRN und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.“ Die Eigentumsrechte liegen also bei Gott. An einer anderen Stelle steht geschrieben: „Der Himmel ist der Himmel des HERRN; aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben.“ (Ps 115,16; 1Mose 2,15). Bereits den Patriarchen (Abraham, Isaak und Jakob) versprach Gott ein bestimmtes Land zu geben (1Mose 12,7; 13,15.17; 17.8; 26,3; 28,13; 50,24; 32,13; Jes 34,17; 60,21). Doch das Land hat Gott dem Volk Israel unter konkreten Bedingungen zum Erbe gegeben (5Mose 4,27; 28,15-68; 31,16-21; 1Kön 6,46-53; 14,15-16; Neh 1,5-11). Mit dem Begriff Erde `gr. `γῆς – g¢s`, werden sowohl unser Planet als Ganzes sowie bestimmte begrenzte Territorien beschrieben.
Doch es gibt einige Aussagen, auch schon im Alten Testament über eine neue Erde, so lesen wir zum Beispiel in Jesaja 65,17: „Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird.“ (Jes 65,17). Oder: „Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir Bestand haben, spricht der HERR, (…).“ (Jes 66,22a). Gott hat also eine neue Weltschöpfung unter der Doppelbezeichnung `Himmel und Erde` vorgesehen und vorausgesagt. Jene Vorsehung setzt die zeitweilige begrenzte Bestimmung dieser Erde voraus. Die Vergänglichkeit der jetzigen Erde hat auch Jesus vorausgesagt: „Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen.“ (Mt 24,35). Auch der Apostel Petrus, der Jesus in dessen Lehre gut und richtig verstanden hat, schreibt etwas ausführlicher vom Vergehen der jetzigen Schöpfung und beschreibt die neue Schöpfung:
Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb; dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. (2Petr 3,10-13; Jes 65,17; 66,22).
Wir haben also die Wahl mit dem Begriff Erde `gr. gh;j – g¢s` an diese materielle, zeitlich begrenzte und vergängliche Erde zu denken, an die Erde, die Gott schafft, in welcher Gerechtigkeit wohnen wird oder an beide Schöpfungen, bzw. Wohnbereiche.
Nach der Elberfelder Übersetzung heißt es: „Sie werden das Land erben“, (LÜ nicht so genau: „das Erdreich besitzen“). Diese Übesetzungsvariante könnte unnötigerweise zu einem Denken an ein `irdisches Reich` verleiten. Im Griechischen wird das Verb `erben` verwendet. Beim `erben` handelt es sich um Eigentumsrechte. In Matthäus 25,34 sagt Jesus, bzw. wird er zu denen zu seiner Rechten sagen: „ererbt das Reich“. Bei dieser Aussage geht es eindeutig um das ewige, auf die Zukunft ausgerichtete unvergängliche Erbe, das uns Jesus durch sein Erlösungswerk erworben hat. Aber gibt es bereits hier auf dieser Erde etwas zu erben? Es sieht so aus, dass die jetzige Erde von den Mächtigen dieser Welt beansprucht und verwaltet (oder auch mißbraucht) wird. Wir fragen auch, welche Bestrebungen zeigte Jesus, als er hier war? Nahm er etwas von dieser Erde, diesem seinem Land in dem er lebte in Besitz?
- Er besaß kein eigenes Haus, obwohl er Häuser-Erbauer war.
- Er beanspruchte keinen Grundbesitz in Bethlehem, der Stadt seiner Vorfahren.
- Er sprach nicht über die Wiederherstellung des Territoriums für das Volk Israel, sondern immer nur über die Menschen, die dort lebten. Auf die Frage des Pilatus hinsichtlich seiner Königswürde, sagte Jesus; „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ (Joh 18,36).
Abbildung 43 Die Erde ist des Herrn und alles, was darinnen ist.“ (Psalm 24,1). Blick von der Sinaihalbinsel bei Nuweiba über den Golf von Agaba nach Saudi Arabien – Sonnenaufgang (Foto: 5. Februar 2013).
Doch wenn Gott immer noch der rechtsmäßige Eigentümer dieser Erde ist, so bezieht er auch seine Kinder jetzt in die gottgewollte Verwaltung der Erde und dessen was darinnen ist, mit ein (1Mose 2,15). Beispiele:
Auf der einen Seite verlassen seine Nachfolger ihre Häuser, ihre Heimat, ihre Boote, ihre Äcker um des Evangeliums willen (Mt 19,27-29). Gleichzeitig stellen sie ihre Häuser, Boote, Kleider, Lebensmittel und auch Geld, Gott und seinem Reich zur Verfügung (Mt 8,14; Lk 5,3; Lk 8,1-3; Joh 12,1-11; Mk 14,3; Apg 2,44.46; 4,37) und gehören zu den wahren Verwaltern dieser Erde und der irdischen Dinge. So bekommt diese Seligpreisung für die Sanftmütigen auch eine Anwendung auf das jetzt und hier. In Matthäus 19,29 hebt Jesus den Gedanken hervor, dass seine Nachfolger auch schon jetzt in dieser Zeit Anteil haben werden an all den materiell nutzbaren und erforderlichen Dingen (Äcker, Häuser etc).
Was ist Sanftmut, wie drückt sie sich aus? Es gibt sehr viel Stellen im Neuen Testament, in denen der Begriff Sanftmut als Geistesfrucht (Gal 5,23) und Charakterzug eines Christen erwähnt wird, so in Epheser 4,2; Kolosser 3,12; 1Petrus 3,4 u.a.m.). Am Beispiel von Jesus können wir deutlich erkennen, wie diese Frucht des Geistes sich ausdrückt. »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig (gr. πραῢς – praus) und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen (Fohlen), dem Jungen eines Lasttiers« (Mt 21,5; Sach 9,9). Sanftmut hat gar nichts mit zur Schau gestellten Schwäche zu tun. Jesus weiß um seine Berufung, seinen Stand und seinen Auftrag. Für den Einritt nach Jerusalem als der verheißene, wahre König Israels, benötigt er kein weißes Pferd, ein Zeichen eines Herrschers dieser Welt, sondern begnügt sich mit dem Fohlen einer Eselin. Er kommt um zu dienen, was durch das junge noch nicht benutzte und noch unerfahrene Lasttier deutlich wird. Dies ist ein klarer Ausdruck des sanftmütigen Geistes. Er selber beansprucht sanftmütig zu sein wenn er sagt:
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft (freundlich), und meine Last ist leicht. (Mt 11,28-30).
Die Sanftmütigen in Matthäus 5,5 sind also Menschen, die in der Gesinnung und Haltung ihres Meisters leben.
- Sie sind nicht stolz und keine Angeber, trotz ihrer hohen Berufung und Standes (1Kor 15,10).
- Sie sind nicht hochmütig, trotz ihrer besonderen geistlichen Befähigungen (2Kor 12,1-10).
- Sie maßen sich nichts an, was sie nicht tatsächlich sind oder getan haben (2Kor 10,13).
- Sie sind Menschen, die in rechter Art und Weise Schwachgewordene aufrichten (Gal 6,1-2; Apg 15,39).
- Es sind mutige, besonnene, auftrags- und zielbewusste Menschen, die in Extremsituationen weder in Verzagtheit fallen, noch in einen gefühlsmäßigen Überschwang und Übermut (2Kor 10,1; Apg 27,34-36).
- Es sind Menschen, welche die diesseitigen, materiellen Dinge durch Anwendung geistlicher Prinzipien richtig und sinnvoll verwenden (Apg 2,45; 11,28-30).
Fragen / Aufgaben:
- Wem gehört diese Erde rechtsmäßig?
- Was meint Jesus mit der Verheißung: „Die Erde (Land) erben“?
- An welchen Beispielen aus dem Leben von Jesus und der Apostel kann man die Geistesfrucht `Sanftmut` deutlich erkennen?
- Was schließt die Hoffnung, auf das erben eines neuen ewigen Wohnortes für die Sanftmütigen, jetzt und heute unbedingt mit ein?
Die 4. Seligpreisung
In seinen Lehren benutzt Jesus sehr oft Bilder oder wie hier existenzielle Bedürfnisse eines Menschen, um dadurch eine göttliche Wahrheit deutlich zu machen.
Glückselig die Hungernden und Dürstenden nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen gesättigt werden. (Mt 5,6).
In Psalm 33,5 lesen wir: „Er liebt Gerechtigkeit und Recht; die Erde ist voll der Güte des HERRN.“ Und von Jesus heißt es in Hebräer 1,9: „Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit; darum hat dich, Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen.«
Doch um welchen Aspekt des geistlichen Lebens handelt es sich hier? Der Begriff Gerechtigkeit hat verschiedene Inhalte und wird je nach Grundgesetz unterschiedlich interpretiert und angewandt. Wie immer interessiert uns dieser Begriff im bibloischen Kontext. Der dafür verwendete griechische Begriff `dikaiosu,nh – dikaiosyn¢ ` kommt häufig vor, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament und beschreibt zum einen:
- Die Gerechtigkeit, welche aus der Erfüllung des Gesetzes kommt, zum anderen aber auch
- die Gerechtigkeit, welche aus dem Glauben kommt, bzw. dem Glaubenden an Gottes Verheißung zu- oder angerechnet wird, ohne dass eine Vorleistung (Gesetzeserfüllung) erbracht werden muß.
Gerechtigkeit ist sozusagen ein Qualitätssiegel, so die Erklärung des Apostels Paulus in Römer 4,11: „Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er (Abraham) als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit.“
Auf dem Apostelkonzil in Jerusalem um das Jahr 48 n. Chr. macht Petrus sehr deutlich, dass alle Bemühungen Israels die Gerechtigkeit (Rechtssprechung, Rechtfertigung) und die damit verbundene Errettung, durch das Gesetz zu erlangen, einem schweren Joch gleicht, dass niemand tragen konnte. So lesen wir: „Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsre Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig (gerettet) zu werden, ebenso wie auch sie.“ (Apg 15,10-11).
Der Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit, von der Jesus in Matthäus 5,6 spricht war also die Sehnsucht vieler aufrichtiger und ehrlicher Israeliten, die einsahen, dass sie den Vorderungen des Gesetzes nicht gerecht werden konnten und sich daher nach einer Erlösung sehnten. Dies bescheinigt der Apostel Paulus den Antiochenern in Pisidien (Apg 13,38-39): „So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn (Jesus) Vergebung der Sünden verkündigt wird; und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt.“
Abbildung 16 Wasserfall in der Schlucht von En Gedi am Westufer des Toten Meeres. Hier können Menschen und Tiere das ganze Jahr hindurch ihren Durst löschen (Foto: Juli 1994).
Dieser Hunger und Durst also wird durch den Glauben an Jesus Christus völlig gestillt, denn er ist in Person das Brot und das Wasser des Lebens: „Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“ (Joh 6,35; 4,14).
Wonach es Jesus selber wirklich verlangte (sein Hunger und Durst) und was ihn wirklich sättigte, war, den Willen seines Vaters zu tun (Gott in seinen Erwartungen gerecht zu werden, zu entsprechen), wie er selber zu seinen zweölf Jüngern sagte: „Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk.“ (Joh 4,34).
- Der Wille Gottes wird durch sein Gesetz erkennbar,
- Wenn Jesus den Willen Gottes tut, erfüllt er Gottes Gesetz,
- Wenn er Gottes Gesetz erfüllt, erwirbt er Gottes Gerechtigkeit.
Da er aber immer gerecht war, erwarb er als wahrer Mensch, durch die Erfüllung des Gesetzes an unserer statt und für uns die Gerechtigkeit, die Gott akzeptiert. Daher spricht er jeden Glückselig, der nach dieser, von ihm erworbenen Gerechtigkeit, verlangt. Und in Jesaja 61,10 wird von der Freude des Gerechtfertigten vorausgesagt: „Ich freue mich im HERRN, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott; denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt.“
In Titus 3,5 hebt der Apostel Paulus den Urheber unserer Rettung hervor, wenn er von Jesus schreibt: „(…) machte er uns selig (er errettete uns) – nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit – durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist.“
Doch ist Jesus auch dem äußeren Menschen zugewandt. Er kümmert sich
- um die Schwachen (Witwen (Lk 7) und deren Rechte.
- Er kümmert sich um die Fremden (Ausländer, Migranten): 2Mose 23,9: „Die Fremdlinge sollt ihr nicht unterdrücken; denn ihr wisst um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid.“ (2Mose 23,9).
- Er kümmert sich um das Rechtssystem: „Beim Richten sollt ihr die Person nicht ansehen, sondern sollt den Kleinen hören wie den Großen und vor niemand euch scheuen; denn das Gericht ist Gottes.“ (5Mose 1,17). Oder: „Du sollst das Recht nicht beugen und sollst auch die Person nicht ansehen und keine Geschenke nehmen; denn Geschenke machen die Weisen blind und verdrehen die Sache der Gerechten.“ (5Mose 16,19).
- Er kümmert sich um den wirtschaftlichen Bereich: „Rechte Waage, rechtes Gewicht, rechter Scheffel und rechtes Maß sollen bei euch sein; ich bin der HERR, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat.“ (3Mose 19,36). Er tadelt die Ungerechtigkeit: „Aber deine Augen und dein Herz sind auf nichts anderes aus als auf unrechten Gewinn und darauf, unschuldiges Blut zu vergießen, zu freveln und zu unterdrücken“ (Jer 22,17).
- Er kümmert sich um die Verstoßenen (Behinderten, Aussätzigen),
- um die Ausgegrenzten (Zöllner und Sünder Lk 15).
Gerade in seinem himmlischen, göttlichen Reich, im Bereich seiner Gemeinde lassen sich die genannten Auswirkungen seiner Gerechtigkeit gut praktizieren (Apg 2,42-4,37).
Wer sich Jesus zuwendet, geht nicht leer aus: „Denn Christus ist des Gesetzes Ende (Vollendung, Ziel, Erfüllung); wer an den glaubt, der ist gerecht.“ (Röm 10,4). „Sind wir denn Gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus.“ (Röm 5,1).
Fragen / Aufgaben:
- Warum mag Jesus die Bildrede?
- Erkläre den Begriff `Gerechtigkeit` von seinem Ursprung her, aber auch von der Fülle, die ihm Jesus beimisst?
- Nenne einige Beispiele von Jesus, aber auch anderen Menschen, die ihr Verlangen nach Gerechtigkeit deutlich zum Ausdruck brachten.
Die 5. Seligpreisung
Glückselig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. (Mt 5,7).
Der griechische Begriff `eleh,monej – ele¢mones, eleoj – eleos` beschreibt Menschen `des Erbarmens, des Mitgefühls und Mitleids`. Unser deutsches Wort `Barmherzigkeit` wird zusammengesetzt von Herz und Erbarmen (herzliches Erbarmen). Glückselig werden von Jesus die Menschen genannt, welche beim Anblick der Not und dem Elend der Menschen, nicht wegsehen, sich nicht abwenden, sondern sich Notleidenden in herzlicher, gütiger Zuwendung annehmen und nach ihren Möglichkeiten Hilfe leisten. In dieser Einstellung kommen Mitleid, Mitgefühl, Anteilnahme und Hilfsbereitschaft deutlich zum Ausdruck.
Abbildung 17 Sonnenaufgang am See Genezaret – Gottes Gnade und sein Erbarmen sind in der Tat jeden Morgen neu (Foto: Juli 1994)
Diese Wesenszüge sind in der Haltung und der Tat des Samariters eindeutig erkennbar.
Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin; und als er ihn sah, jammerte er ihn (empfand er Mitleid); und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; und wenn du mehr ausgibst, will ich dir’s bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit (eleos) an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen! (Lk 10,33-37).
Jesus sagt diesen Menschen Barmherzigkeit zu und auch der Apostel Paulus erwähnt einen seiner Mitarbeiter, der bewusst und unter schwierigen Umständen an dem Apostel Erbarmen übte: „Der Herr gebe Barmherzigkeit (eleos) dem Hause des Onesiphorus; denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Ketten nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit finde bei dem Herrn an jenem Tage. Und welche Dienste er in Ephesus geleistet hat, weißt du am besten.“ (2Tim 1,16-18).
Eins der vielen Wesenszüge Gottes ist seine Barmherzigkeit und das was er ist, das tut er auch, so steht von ihm geschrieben: „Der HERR ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke.“ (Psalm 145,9).
Welch starke Motivation zum barmherzigen Lebensstil für die Nachfolger von Jesus !
Die 6. Seligpreisung
Die fünfte Seligpreisung lautet: „Glückselig die Reinen im Herzen, denn sie werden Gott schauen.“ (Mt 5,8). Nun spricht Jesus über die verborgene innere Welt des menschlichen Herzens und über eine Aussicht, welche die Jünger und das Volk an zwei wichtige Realitäten in ihrer Geschichte erinnern konnte.
Die erste Realität ist die Bestandsaufnahme Gottes über das Herz des Menschen. Gott sagte zu Noah nach der Sintflut: „Das Herz des Menschen ist böse von Jugend an.“ (1Mose 8,21).
Die zweite Realität ereignete sich auf dem Berg Sinai. Es waren die siebzig Ältesten Israels, die dem Herrn nahen durften und seine Herrlichkeit schauen. Von diesen heißt es: „(…) und sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist.“ (2Mose 24,10).
Jesus kommt zu den Menschen nicht mit der Rute, nicht mit den Vorderungen des Gesetzes und schon gar nicht mit den Satzungen der Ältesten. Wovon er hier sprach, öffnete praktisch jedem Einzelnen diese herrliche Perspektive. Das war Evangelium, die Frohe Botschaft ! Doch wie gelangt man dahin mit einem Herzen, das voller Unreinheit und Sünde war. Damit weckte Jesus auf der einen Seite bei seinen Jüngern innere Sehnsüchte und und auf der anderen Seite forderte er die Menschen heraus zu fragen: Wie kann das geschehen, wie kommen wir dahin?
Die Aufrichtigen unter ihnen dachten vielleicht an David, der voller Sehnsucht ausrief: „Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?“ (Ps 42,3). Und dann zum Herrn flehte „Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist.“ (Ps 51,12).
Abbildung 18 Im Oberlauf des Jordan ist das Wasser so klar, durchsichtig, dass man bis auf den Grund sehen kann. Jede Art von Verschmutzung des Wassers ist von der Naturschutzbehörde in Israel strengstens untersagt (Foto: Juli 1994).
Jesus sind alle Schriftaussagen über das Herz des Menschen, wie es Gott sieht und was er vorhat daraus zu machen, bekannt. Wer von den Jüngern und vom Volk die Schriften der Propheten kannte, wird sich möglicherweise erinnern an die Verheißung Gottes an sein Volk durch den Propheten Hesekiel: „Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben; und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben; und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut.“ (Hes 36,26-27).
Fragen / Aufgaben:
- Woran können wir erkennen, dass das Herz des Menschen böse ist von Jugend an?
- Warum ist es wichtig, im Menschen die Sehnsucht nach Gott zu wecken?
- Wodurch werden die Herzen gereinigt?
- Was meint Jesus mit „sie werden Gott schauen“?
Die 7. Seligpreisung
„Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen.“ (Mt 5,9).
Das hebräische Wort für Frieden, welches Jesus ursprünglich verwendet hatte, lautet: `Schalom`, es ist sehr inhaltsvoll und umfasst alle Bereiche des menschlichen Wohlbefindens. Das griechische Wort für Frieden lautet: `ειρήνη – eirene` und ist in vielen Sprachen als Personenname bekannt (Irene, Irina, Irena). Dies unterstreicht den Wunsch und die Sehnsucht der Menschen nach Sicherheit, Wohlbefinden, Geborgenheit.
Abbildung 19 Plitvicerseen mit Wasserfällen, über hölzerne Gehwege und Brücken leicht zu begehen – friedliche Landschaft – ein Hauch von Frieden (Foto: Juli 1986).
Im Text wird aber ein Zusammengesetztes Wort gebraucht nämlich: `ειρηνηποιοι – eirenipoioi` und kann mit Friedensmacher, Friedenstäter, Friedensstifter übersetzt werden. Hier geht es nicht allein um Frieden zu halten, zu bewahren, sondern auch um zerstörte Beziehungen zu befrieden durch Vermittlung der Botschaft voin der Versöhnung.
Jede Art von Frieden hat eine bestimmte Qualität wie zum Beispiel:
- Zwei zerstrittene Parteien einigen sich auf der Grundlage bestimmter akzeptabler Regeln,
- Zwei Länder schließen einen freiwilligen oder auch erzwungenen Friedensvertrag und die Koexistenz ist für eine bestimmte Zeit gesichert.
- Zwei Menschen klären ihre zerrissene Beziehung und schließen Frieden,
Die friedensstiftenden Maßnahmen unter Menschen in dieser Welt sind grundsätzlich zu begrüßen, abgesehen davon, dass sie oft auf die Kosten der Schwächeren erreicht werden, oder deutliche Tendenzen zu egoistischen, eigennützigen Motiven zeigen.
Jesus unterscheidet daher zwischen dem weltlichen (typisch menschlichem) und göttlichem Frieden wenn er zu seinen Jüngern sagt: „Meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch wie die Welt gibt“ (Joh 14,17).
Frieden, wahren Frieden bekommt der Mensch, oder zu echtem Frieden gelangt der Mensch nur in der Person Jesu Christi: „Solches habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt besiegt“ (Joh 16,33). Der Friede, den Jesus in diese Welt bringt, beruht auf der Versöhnung, die Gott den Menschen anbietet:
- Versöhnung mit Gott durch Christus und dessen Heilswerk am Kreuz,
- Versöhnung der Menschen untereinander wegen Christus.
- Paulus hebt diesen göttlichen Frieden in seinem Brief an die Epheser heror: „Er (Jesus) machte Frieden“ (Eph 2,15). „Er (Jesus) ist gekommen und hat Frieden verkündigt den Nahen und den Fernen“ (Eph 2,17). Paulus wünscht den Gläubigen in Philippi: „Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus“ (Phil 4,7).
Jesus preist nicht nur alle glückselig, die diesen von Gott gewollten und durch Christus erwirkten Frieden selbst erfahren haben, sondern sich aktiv durch Wort und Tat an der Verbreitung dieses Friedens beteiligen. Die Verheißung lautet: „Sie werden Söhne Gottes genannt werden“. Diese Ehrung bekommen sie natürlich von Gott selber zugesprochen, doch auch Menschen können sehen und erkennen, dass diese Friedensstifter ihrem Meister Jesus Christus, dem Sohne Gottes, sehr ähnlich sind im Sein und im Tun !
Fragen:
- Woher kommt Unfriede?
- Wie sieht der weltliche Frieden aus, wie erstrebenswert ist er?
- Was meint Jesus mit seinem Frieden?–––
- Was vermag der Friede Christi?
- Was tun, wenn ein Christ den Frieden verliert?
Die 8. Seligpreisung
Die achte Seligpreisung ist die längste vom Text und Inhalt, durch sie fordert Jesus die Gläubigen bis aufs Äußerste heraus.
„Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel“ (Mt 5,10).
„Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen“ (Mt 5,11).
„Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln; denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren“ (Mt 5,12).
Und Lukas ergänzt mit den Worten von Jesus: „Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten“ (Lk 6,26).
Die Geschichte der Verfolgung
Die Verfolgung fing schon in der zweiten Menschen-Generation an:
- Abel wurde von seinem Älteren Bruder Kain aus Neid umgebracht (1Mose 4,1ff).
- Isaak wurde von Ismael, seinem älteren Bruder verfolgt (Gal 4,29).
- Jakob wurde von seinem älteren Bruder Esau verfolgt (1Mose 27).
- Josef wurde von seinen älteren Brüdern verfolgt (Mordanschläge, Verkauf in die Sklaverei 1Mose 37).
- Den Propheten ging es nicht besser (Mt 5,11).
- Jesus wurde von den Ältesten des Volkes verfolgt und schließlich zu Tode verurteilt.
- „…an diesem Tag erhob sich eine große Verfolgung wieder die Gemeinde in Jerusalem“ schreibt Lukas in der Apostelgeschichte 8,1.
- „Wir müssen durch viel Bedrängnisse (Trübsal) in das Reich Gottes hineingehen“ sagte der Apostel Paulus zum Abschied den Gläubigen im pisidischen Antiochia (Apg 14,22).
Jesus setzt Verfolgung voraus wie wir in Lukas 11,50-51 lesen: „Damit gefordert werde von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten, das vergossen ist seit Erschaffung der Welt; von Abels Blut an, bis hin zum Blut des Zacharija, der umkam zwischen Altar und Tempel, …“. Mit der Bezeichnung „von diesem Geschlecht“ meint Jesus nicht nur das zu seiner Zeit antigöttliche und antichristliche Lager, sondern ALLE Menschen aller Generationen, die sich gegen Gott und sein Volk auflehnen, (vgl. auch die Aussage in Offenbarung 18,24: „… und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden und das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind).
Verfolgung, – eine unausweichliche Folge der gerechten Lebensführung?!
Die Verfolgung ist notwendig für die Bewährung des Glaubens: „Aber wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes Willen, so fallen sie ab“ (Mt 13,21). Oder mit einem positiven Ergebnis: „Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus“ (1Petr 1,6-7).
- Durch Verfolgung werden die Fronten klar abgesteckt, so schreibt Paulus in 2Tim 3,12 „Und alle, die fromm (gottesfürchtig) leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden“ (vgl. 2Tim 3,11; 2Kor 4,9; Röm 8,35).
Die Zusage der Glückselichkeit gilt also all denen, die in irgendeiner Form, wegen ihrer Zugehörigkeit zu Christus und wegen ihrer gerechten Lebensführung, bedrängt, verfolgt, Mißhandelt, oder gar getötet werden. Auch üble und unwahre Nachrede, falsche, bewusste lügnerische Aussagen, sind in dem Verfolgungskatalog ebenso eingeschlossen. Jesus spricht all diesen Menschen, die solches erleiden und erdulden, schon jetzt Glückseligkeit zu, ja, er fordert sogar auf zum Jubeln, was die Apostel als Vorbilder später auch tun: „Sie gingen aber fröhlich (sich freuend) von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um Seines Namens willen Schmach zu leiden“ (Apg 5,41).
Eines Tages wird sich das Blatt wenden, dann werden die hier Verfolgten im Reich Gottes ihren Trost bekommen. Doch auch schon hier sind die Verfolgten die eigentlichen Sieger – Sieger über das Böse und bezeugen damit ihren Anteil am Reich Gottes und seiner Herrschaft!
Fragen:
- Welche Seligpreisung fällt dir positiv und welche evtl. negativ auf?
- Warum waren diese Seligpreisungen in jedem Kulturkreis immer irgendwie störend?
- Welche Seligpreisung würde in der Umsetzung deinen Alltag in Familie, Beruf und Gemeinde stark verändern?
- Welche Seligpreisung könnte für dich Priorität in der Umsetzung gewinnen?
Wie verhält sich Jesus zum Gesetz?
Die Haupttätigkeit von Jesus war das Lehren: Er lehrte in ihren Synagogen, in den Häusern oder wie hier draußen auf freiem Felde, wo sehr viele zuhören konnten. Besonders aber die Gruppe der Schriftgelehrten aus der Pharisäerpartei hörte genau hin, was er sagte, aber auch was er wann und wie tat. Sie hörten Jesus also sehr kritisch zu und suchten zum Teil bewusst, wie sie ihm Unregelmäßigkeiten in der Gesetzesauslegung oder deren Anwendung auf das alltägliche Leben, unterstellen konnten. Die Frage nach dem rechten Verständnis und der rechten Auslegung und Anwendung des Gesetzes beschäftigte wohl auch viele aufrichtig Gläubigen im Volk. Auf diesem Hintergrund greift Jesus das Thema auf und macht deutlich, wie er zum Gesetz und auch zu den Propheten des Alten Bundes steht.
- „Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und dann wird er noch konkreter: „Denn wahrlich, ich sage euch: Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und nun sagt er etwas über das wie bei der Auslegung des Gesetzes und dessen Anwendung: „Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich6 der Himmel; wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch: Wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen“(Mt 5,17-20).
Das Gesetz, die Propheten und auch die Psalmen waren fester Bestandtteil der jüdischen Bibel, wobei manchmal auch das ganze Alte Testament unter dem Oberbegriff Gesetz verstanden wurde.
Der Begriff Gesetz gr. `νομος – nomos` wird unterschiedlich gebraucht, so zum Beispiel:
- Das Gesetz Moses (Lk 2,23), oder das Gesetz des Herrn – gemeint ist dasselbe Gesetz (Lk 2,24),
- Das Gesetz Christi – „ich aber sage euch“ – es ist bindend (Gal 6,2),
- Das Gesetz des Geistes – welches lebendig macht (Röm 8,2),
- Das Gesetz des Fleisches – welches den Menschen knechtet (Röm 8,3; 7,23),
- Das Gesetz der Sünde und des Todes (Röm 8,2; 7,23),
- Das Gesetz des Verstandes (im Sinnen, in der Gesinnung, im Denken) des Menschen (Röm 7,23; Eph 4,17. 18; Lk 10,27; Kol 1,21; Hebr 4,12),
In unserem Text nimmt Jesus Bezug auf das gesamte Schriftzeugnis des Alten Testamentes.
Der im griechischen Text verwendete Begriff `καταλυσαι – katalysai`, meint auflösen und zwar im Sinne von, außer Kraft setzen, für ungültig erklären. All dies will Jesus nicht tun, sondern sein Ziel und Lebensaufgabe besteht darin, das er erstens: alle Anforderungen (Ansprüche, Erwartungen) des Gesetzes erfüllt und zweitens: alle Voraussagen, Verheißungen in und durch seine Person zur Erfüllung kommen. Der gr. Begriff `πληρωσαι – plirosai` meint `erfüllen` und zwar ganz füllen, es bleibt nichts offen, alles ist gedeckt, auf alle Fragen sind von ihm und durch ihn Antworten gegeben worden.
Jesus beruft sich auf die Schrift
Sehr oft beginnt Jesus seine Rede mit den Worten:
- „Es steht geschrieben“ (Mt 4,4. 6. 10; 21,13; 26,24).
- Jesus bestätigt, die Unzerbrüchlichkeit der Schrift: „Wenn er „die“ Götter nennt, zu denen das Wort Gottes geschah – und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden“ (Joh 10,35).
- „Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, dass zweier Menschen Zeugnis wahr sei“ (Joh 8,17). Mit dieser Berufung auf das Gesetz, unterstreicht er die Wahrhaftigkeit seines Zeugnisses, welches durch Johannes den Täufer als zweitem Zeugen mitbekräftigt wurde.
. Jesus sagt weiter: „Denn er (Mose) hat von mir geschrieben“ (Joh 5,46; 5Mose 18,15-17). Darum beansprucht er gehört zu werdeen.
Jesus ist der beste Gesetzeslehrer (Ausleger)
- „Wenn ihr verstehen würdet, was es heißt, oder bedeutet: „Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, so hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt“ (Mt 12,7; Hosea 6,6). Di neue Betonung bestimmter alttestamentlicher Aussagen ist bemerkenswert.
- „Ihr habt gehört, das gesagt ist ….. ich aber sage euch“ – ist keine Auflösung, sondern eine Vertiefung, bzw Erklärung der ganzen Tiefe des Inhaltes der Gebote Gottes, eben das, was Gott mit diesen Aussagen gemeint hat (Mt 5,21. 27. 33. 37. 38. 43).
In und durch die Person Jesu wird das Gesetz (die Propheten und Psalmen) erfüllt
„Damit erfüllt wird, (damit ist erfüllt), was gesagt oder geschrieben wurde“:
- „Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen“ (2Mose 2,24; Hosea 11,1-2; Mt 2,15), Eine Prophetie, welche ihre historische Erfüllung im Auszug Israels aus Ägypten erfüllte und die sich im Leben von Jesus erfüllte und die sich in einem geistlich-übertragenm Sinne an jedem seiner Kinder erfüllt, die er aus der Slaverei der Sünde herausführt.
- Mt 13,35: „damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht (Psalm 78,2): »Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, was verborgen war vom Anfang der Welt an.«
- Mt 21,4; „Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht (Sacharja 9,9): „Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin.“
- Mt 26,56: „Aber das ist alles geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen“.(Sach 13,7).
- Joh 12,38: „damit erfüllt werde der Spruch des Propheten Jesaja, den er sagte (Jesaja 53,1): »Herr, wer glaubt unserm Predigen? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart?«
- Mt 8,17:„damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht (Jesaja 53,4): »Er hat unsre Schwachheit auf sich genommen, und unsre Krankheit hat er getragen“ (Mt 8,17).
- Lk 22,37: „Denn ich sage euch: Es muss das an mir vollendet (erfüllt) werden, was geschrieben steht (Jesaja 53,12): »Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden.« Denn was von mir geschrieben ist, das wird vollendet (abgeschlossen, erfüllt).“
- Lk 24,44-45: „Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war: Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden,“
Und in der Tat stimmt die Zusammenfassung des Apostels Paulus mit Jesu Aussagen überein, wenn er an die Römer schreibt: „Denn Christus ist des Gesetzes Ende (gr. τελος – telos – Ende, Vollendung, Ziel, Erfüllung); wer an den glaubt, der ist gerecht“ (Röm 10,4).
Fragen:
- Was für eine Meinung herrschte unter dem Volk über Jesus und seine Beziehung zum Gesetz und wie korrigiert Jesus deren Denken?
- Was bedeutet das Wort auflösen und das Wort erfüllen?
- Nenne drei Beispiele, wie Schriftaussagen aus dem Gesetz, den Psalmen und Propheten sich in Jesu Leben erfüllten?
- Was bedeutet es für uns, dass Jesus das Gesetz erfüllte? Welche Bestimmung hat es heute für uns?
Das 6. Gebot – Töte nicht
Nachdem Jesus eine Grundaussage gemacht hat über seine Haltung zum Gesetz, geht er nun in die Details, greift eine Reihe von Geboten und Verboten auf und erklärt sie. Er fängt mit der sogenannten zweiten Gesetzestafel aus 2Mose 20,1-17 an.
„Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist (2.Mose 20,13; 21,12): »Du sollst nicht töten«; wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein.
Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig;
wer aber zu seinem Bruder sagt: Du Nichtsnutz!, der ist des Hohen Rats schuldig;
wer aber sagt: Du Narr!, der ist des höllischen Feuers schuldig.
Darum: wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe.
Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir: Du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast“ (Mt 5,21-26).
Auch hier stellen wir schnell fest, dass Jesus das Gebot zum Schutz des Lebens, viel genauer und detailierter erklärt, als es im Buch Moses beschrieben wird. Doch zunächst die Klärung des Begriffes `Mord`. Im Deutschen ist Mord absichtliche, vorsätzliche Tötung eines Menschen. Eine unbeabsichtigte Verletzung mit Todesfolge wird nicht als Mord bezeichnet und juristisch auch anders bewertet. Auch in 2Mose 21,12-25 wird ausdrücklich zwischen beabsichtigter und unbeabsichtigter Tötung unterschieden mit entsprechenden unterschiedlichen Reaktion darauf.
Doch bei Jesus beginnt Mord schon im Herzen (Mt 15,19-20). Die Vorstufen zum Mord sind Zorn, Grimm und Hass. Und dies wiegt bei Jesus schon so schwer, wie im Alten Testament die physische Tötung.
Wir denken da an Kain, der zunächst
- Neid gegenüber seinem jüngeren Bruder aufkommen ließ,
- dann folgte der Grimm/Zorn auf seinen Bruder,
- dann der Hass
- und schließlich Mord an seinem Bruder Abel, so in 1Mose 4,5-7:
„Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick.“ Und Johannes ergänzt in seinem ersten Brief 3,12: „nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht.“ Und Judas der Halbbruder des Herrn schreibt: „Weh ihnen! Denn sie gehen den Weg Kains“ (Judas 11a).
Doch Gott wollte Mord verhindern und warnte Kain: „Und warum senkst du deinen Blick? Ist’s nicht also? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie“ (1Mose 4,5-7). Nach pheser 4,31 sind Grimm und Zorn nebeneinandegesetzt, so auch nach 1Mose 49,6 dort sagt Jakob seinen beiden Söhnen Simeon und Levi: „Meine Seele komme nicht in ihren Rat, und mein Herz sei nicht in ihrer Versammlung; denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet, und in ihrem Mutwillen (Gimm) haben sie Stiere gelähmt“ (vgl. auch 1Sam 18,8)
Die bösen Gedanken und Emotionen im Herzen eines Menschen suchen nach einer Ausdrucksform und dies ist zunächst das Wort (Du Nichtsnutz, Taugenichts, zu nichts zu gebrauchen, aus dir wird nie was; Du Narr, Dunnkopf, Blödmann), welches über die Lippen geht, dann bei günstiger Gelegenheit folgt die Tat. Beleidigungen, Verletzungen schlimmster Art auch durch Rufmord sind alltägliche Ausdrucksweise in unserer Gesellschaft (leider auch nicht selten unter Christen). Stünden entsprechende Waffen zur freien Verfügung, würde es bei uns noch zu viel schlimmeren physischen Vrletzungen mit Todesfolge kommen.
Doch geht es Jesus nicht einfach nur um Aufklärung oder Bestandsaufnahme, sondern um Vorbeugung, denn dies ist ja der eigentliche Sinn aller Verbote im Gesetz des Mose. Jesus zeigt den Weg, auf dem Schlimmeres verhindert werden kann und bereits zerbrochenes wieder hergestellt wird – nämlich durch Versöhnung mit dem Geschädigten. Dies ist auch die Voraussetzung zu einer geordneten Beziehung mit Gott.
Fragen:
- Warum fängt Jesus mit der Auslegung des 6. Gebotes an?
- Welche neue Qualität zeigt Jesus, mit dem „Ich aber sage euch“, in den Geboten Gottes auf ?
- Wie bewertet Jesus den Zorn, Grimm und Hass des Menschen?
- Was ist der Unterschied zwischen Totschlag und Mord und wie begründet Gott diese Unterscheidung?
- Um was geht es Jesus vorrangig, um die Beurteilung und Bestrafung der Übertretung des Gebotes, oder um die Vorbeugenden Maßnahmen?
Das 7. Gebot – brich nicht die Ehe
(Mt 5,27-32; 2Mose 20,14; 3Mose 20,10-13)
„Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2Mose 20,14): „Du sollst nicht ehebrechen. (μοιχεύσεις-moicheuseis). Ich aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen.
- Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf’s von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde.
- Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre.
Es ist auch gesagt (5Mose 24,1): »Wer sich von seiner Frau scheidet (απολύση-apolyse), der soll ihr einen Scheidebrief (αποστάσιον-apostasion) geben.
Ich aber sage euch: Wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, (Unzucht gr.πορνεία – porneia) der macht (verursacht), dass sie die Ehe bricht;
- und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe“ (Mt 5,27-32).
Auch bei diesem Gebot wollen wir zunächst die für dieses Thema relevanten griechischen Begriffe klären.
- μοιχεία – moicheia – Ehebruch (Ehebruch lag damals erst dann vor, wenn einer der Ehepartner den Ehebund durch sexuelle Untreue, brach).
- πορνεία – porneia – Unzucht (der Begriff wird verwendet, um verschiedene Arten von sexuellen Entgleisungen zu beschreiben).
- απολύση – apolyse – er (der Mann) löst (die Frau) von (sich) los, er scheidet sie von sich. Im jüdischen Kontext wurde die Ehe vom Mann geschieden. Der Mann löst, bzw. schickt seine Frau von sich weg und gibt ihr die Scheidungsurkunde, den Scheidungsbrief in die Hand.
- γάμος – gamos – Heirat, Hochzeit, Ehe. Daher die Fachbegriffe `monogamie – Einehe` und polygamie-Vielehe`.
- αποστάσιον – apostasion – Scheidungsurkunde, Scheidebrief.
Nach dem Buchstaben des Gesetzes war Ehebruch erst dann vollzogen, wenn die Tat vollbracht wurde, d.h. einer der Partner buchstäblich fremd ging und dies stand unter Todesstrafe. Jesus stellt den Ehebruch jedoch schon dann fest, wenn ein Mensch in seinen Gedanken das Begehren (epithymia) gewollt und bejaht hat. Damit wird das Gebot nicht einfach verschärft, sondern er vereinfacht die Einhaltung das Gebotes in seiner ganzen Tiefe. Denn es ist doch leichter den ersten Gedanken abzuwehren, als noch kurz vor der Tat umzukehren. Ein Streichholz zu löschen, ist sehr einfach, doch wenn das Haus erst in Flammen steht, dann ist es in den mesten fällen zu spät. Um die Vorbeugende Maßnahmen geht es bei Jesus, welche er durch draßtische Zuspitzungen unterstreicht. Das Ärgernis des rechten Auges und der rechten Hand, ist von Jesus nicht willkürlich so betont. Die rechte Seite des Menschen, also der rechte Fuß, die rechte Hand, das rechte Ohr und natürlich auch das rechte Auge, werden vom Menschen bevorzugt zur Ausführung von Handlungen gebraucht. Das Ärgernis (skandalon) ist so was wie ein Anstoß, Hindernis, das einen Menschen zu Fall bringen kann, oder eine Art Verführung, Verlockung, Falle, in der sich ein Mensch verfängt. Diese gilt es zu erkennen und dem muß energischer Wiederstand geleistet werden. Es geht um sich zurückhalten von einer Bejahung in Gedanken, Worten oder gar der Ausführung.
- Achtgeben auf die Füße: Jes 58,13;
- Achtgeben auf die Augen: Ps 119,37;
- Achtgeben auf die Hände: Jes 33,15..
Dass Jesus diese Aussagen nicht wörtlich/buchstäblich gemeint hat, macht das Verhalten der Jünger und der ersten Christengeneration deutlich, denn an keiner Stelle der geschichtlichen Beschreibungen über die Missstände in den ersten Gemeinden hat man sich die Augen oder die Hände ausgerissen.
Doch Jesus spricht noch einen anderen Aspekt des Ehebruchs an. Wer seine Frau entlässt, der setzt sie der Gefahr oder auch der Versuchung aus sich mit einem anderen Mann zu verheiraten. Und dadurch wird diese Ehe auch in ihrer sichtbaren und fassbaren Gestallt zerbrochen. Der Mann, der sie zu sich nimmt, macht sich ebenfalls des Ehebruchs schuldig. Es ensteht also eine Kettenreaktion von Übertretungen des Gebotes Gottes und die Folgen sind oft verheerend, besonders für Kinder. (Mir ist bewusst, dass der Abschnitt mit der Entlassung einer Frau mittels eines Scheidungsdokuments von hartherzigen und liberalen Auslegern im Judentum oft zu unrechtsmäügen Scheidungen geführt hat und Jesus womöglich diese lieberale, sogar vom Gesetz nicht gedeckte Scheidungspraxis anprangerte).
Eine deutliche Einschränkung oder zugeständnis zur rechtsmäßigen Scheidung macht Jesus, wenn er sagt, dass wegen oder im Falle von Unzucht, also wegen Treuebruchs eines Partners in der Ehe, der andere das gesetzliche Recht hätte, sich zu trennen, ohne dass es dann ihm, so wäre die Logik, als Ehebruch angerechnet wird wenn er wieder heiratet.
Weitere Aspekte der Ehefragen werden in Matthäus 19,3-12 von Jesus aufgegriffen und erläutert: „Da traten Pharisäer zu ihm und versuchten ihn und sprachen: Ist’s erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen: Der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach (1.Mose 2,24): »Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden „ein“ Fleisch sein«? So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern „ein“ Fleisch1. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden“ (Mt 19,3-6)!
Hier macht Jesus deutlich, dass es überhaupt nicht darum geht, wie man im Falle eines Falles seine Frau entlassen könnte, um eine neue Beziehung eizugehen, sondern im Vordergrund steht die ursprüngliche Ordnung Gottes, nämlich `ein` Mann und `eine` Frau und das für`s ganze Leben.
Das Zugeständnis des Mose (eigentlich das Zugeständnis Gottes durch Mose im Gesetz), wurde nur wegen der Hartherzigkeit der jüdischen Männer gegeben. Gott verhieß jedoch seinem Volk das harte Herz herauszunehmen und ihm ein fleischernes, also ein weiches, empfindsames, lebendiges Herz zu geben (Hes 11,19). Das heißt, es soll immer zuerst die Wiederherstellung der zerbrochenen Ehebeziehung durch Versöhnung und Vergebung angestrebt werden.
Im Alten Testament wird die Beziehung Gottes zu Israel mit einem Ehebündnis beschrieben. Gott ist eigentlich der Betroffene, der Betrogene, Hintergangene, dem Israel die Treue nicht gehalten hatte. Sie liefen ihm immer wieder davon (Jes 50,1-2;
Jer 3,1. 8-20). Gott gab also im Gegensatz zu den natürlichen Ehegepflogenheiten dem Volk Israel immer wieder die Möglichkeit zur Rückkehr durch Einsicht und Buße.
Die Botschaft Gottes ist klar, trotz der Untreue seiner Frau (Israel/Juda) ist sein Arm nicht zu kurz, dass er nicht helfen oder erretten könnte? Und er ruft sie zurück und verspricht sie wieder anzunehmen.
So stellt Jesus die Ehe wieder in Gottes Licht und unter Gottes Schutz. Seine Gedanken sind, Gedanken der Versöhnung, der Wiederherstellung, auch im Falle der Untreue. Dafür aber gab Jesus sein neues Verständnis zur Ehe. Gesetz wird nicht nur erfüllt, wenn die Ehe nicht gebrochen wurde, sondern Gesetz wird erfüllt, wenn die Ehe gepflegt, erhalten, oder wieder erneuert wird, so dass dadurch der göttliche Ehegedanke und Plan Gottes mit seinem Sohn und der Gemeinde reflektiert und geehrt wird.
Fragen:
- Warum ist die Ehe von Gott durchs Gesetz geschützt worden?
- Warum hat dann Gott durch Mose den Israeliten erlaubt mittels eines Scheidebriefes sich von ihren Frauen zu scheiden?
- Was war der ursprüngliche Gedanke und Plan Gottes mit dem Menschen in Bezug auf die Ehe?
- Welche Schwierigkeiten entstehen bei einer Scheidung?
- Siehst du deine Ehe an als ein Geschenk von Gott?
Das Gebot – Schwöre nicht falsch
(Mt 5,33-37)
Die Praxis des Schwörens ist uralt und wurde generell zur Bekräftigung und Beglaubigung einer Aussage gemacht. Ein Gelübde ist auch ein feierliches Versprechen, doch ohne Schwur (1Mose 28,20; 31,13 – Jakobs Gelöbnis/Gelübde). Gott selbst schwor Abraham einen Eid: „und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der HERR: Weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont,
will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel …“ (1Mose 22,16-17). Wenn aber Menschen schworen, dann nahmen sie immer Bezug auf eine, dem Schwörenden höhergestellte Person, oder gar Bezug auf Gott. So lesen wir in Hebräer 6,16: „Die Menschen schwören ja bei einem Größeren, als sie selbst sind; und der Eid (gr. όρκος – orkos) dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende“. Der Schwur trug also dazu bei, dass ein Konflikt beigelegt werden konnte, so fordert Abimelech, der König von Gerar, Abraham zu einem Schwur auf: in 1Mose 21,23 sagt er: „So schwöre mir nun bei Gott, dass du mir und meinen Söhnen und meinen Enkeln keine Untreue erweisen wollest, sondern die Barmherzigkeit, die ich an dir getan habe, an mir auch tust und an dem
Lande, darin du ein Fremdling bist“ (1Mose 21,23).
Auch Isaak und Jakob wurden zum Schwören aufgefordert (1Mose 26,26-31; 31,53-54) und sie hielten sich auch daran. So wurde das Schwören im Gesetz Moses zwar verankert, gleichzeitig aber auch vor Missbrauch gewarnt. „Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht entheiligen; ich bin der HERR“ (3Mose 19,12).
Der übliche und am meisten verwendete Schwur in Israel lautete: „So wahr der HERR lebt! (Jer 12,16; Richter 8,19; Ruth 3,13;1Sam 19,6; 2Kön 2,2). Und in der Tat, wenn der Eid durch die Schwurformel mit Einbeziehung des Gottesnamens wohl überlegt ausgesprochen wurde, war es auch ein Zeugnis der Zugehörigkeit zu Gott. Gott wurde also bewusst in das Leben, den Alltag einbezogen. Doch die Eide verloren nach und nach ihren Whrheitsgehalt und damit wurde der Name Gottes mißbraucht und entheiligt. Jesus nimmt nun Bezug auf diesen Missstand: „Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist (3.Mose 19,12; 4.Mose 30,3): »Du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten.«
Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt,
- weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron;
- noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße;
- noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs.
- uoch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören; denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen“ (Mt 5,33-36).
Nun leitet er eine neue Phase des Umgangs mit Worten, Versprechungen und Beteuerungen, ein. Er reduziert das Ganze auf den wahren Kern einer Aussage – Wenn JA, dann JA, wenn NEIN, dann NEIN. Damit legt er die Aussagen in die volle Verantwortung des Menschen und schützt den Namen Gottes vor Mißbrauch und damit vor einer Entheiligung. Der Gesetzgeber hebt damit nicht ein alttestamentliches Gebot auf, denn solch ein Gebot gab es nicht. Es gab schon vor der Gesetzgebung am Sinai diese allgemeine Praxis des Schwörens. Das Verbot lautete: „Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht entheiligen; ich bin der HERR“ (3Mose 19,12). Das Gebot lautete: „Wenn jemand dem HERRN ein Gelübde tut oder einen Eid schwört, dass er sich zu etwas verpflichten will, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern alles tun, wie es über seine Lippen gegangen ist“ (4Mose 30,3). So erkennen wir, dass sich Jesus wegen des Mißbrauchs dieser Alltagspraxis eine Neue Umgangsform in die zwischenmenschliche Beziehungen einführt, nämlich: „Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel“ (Mt 5,37). Wenn Jesus des öfteren seine Rede mit den einleitenden Worten „Wahrlich, wahrlich, (gr. αμην, αμην – amen, amen) ich sage euch“ beginnt, so ist es kein Schwur, sondern eine feierliche Hervorhebung dessen, was nun gesagt wird.
Die Praxis, ein Gelübde abzulegen, wurde auch in neutestamentlicher Zeit fortgesetzt (Apg 18,18; 21,23).
Als Petrus im Hof des Hohepriesters von den Bediensteten nach seiner Zugehörigkeit zu dem Mann aus Nazaret gefragt wurde, belegte er sich mit einem Fluch und Schwur: „Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich“ (Mt 26,74-75). Diese Erfahrung war so einprägsam, dass ihm so etwas später nicht mehr passierte. Jakobus, der Bruder des Herrn schreibt in seinem Brief: „Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem andern Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt“ (Jak 5,12).
Auch in diesem Bereich will Jesus es uns leichter machen. Durch diese Neuordnung schützt und bewahrt er uns in einer demütigen Abhängigkeit zu Gott. Das stolze: „Ich schwöre dir bei …“, ist also nicht nur überflüssig, sondern auch schädlich. „Dagegen solltet ihr sagen: Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun“ (Jak 4,15).
Fragen:
- Woher kommt die Praxis des Schwörens?
- Was ist der Unterschied zwischen Schwur/Eid und einem Gelübde?
- Welche Bedeutung hatte das Schwören in der Patriarchenzeit?
- Wie lautete die gängige Formel beim Schwören in Israel? Und was verband man damit?
- Warum ändert Jesus diese jahrtausendealte Praxis? Was ist bei der neuen Anweisung Jesu neu?
- Wie viel zählt dein Wort, dein Versprechen? Kann man sich darauf verlassen?
Das Gebot der Nächsten- und Feindesliebe
(Mt 5,43-48; Lk 6,27-35)
Da dieses Gebot die grundsätzliche Beziehung zum Nächsten regelt, betrachten wir es an dieser Stelle. Im Rahmen der Berglehre ist Jesus immer noch im Bereich der zweiten Gesetzestafel, bei der Klärung der Beziehung des Menschen zu seinem Nächsten.
„Ihr habt gehört, dass gesagt ist:
- »Du sollst deinen Nächsten lieben« (3.Mose 19,18)
- und deinen Feind hassen.
Ich aber sage euch:
- Liebt eure Feinde
- und bittet für die, die euch verfolgen,
damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.
- Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner?
- Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden?
Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist“ (Mt 5,43-48; Lk 6,35).
Zunächst stellen wir fest, dass es Jesus hier nicht um die Klärung oder Definition des Feindbildes geht. Dies wird von Jesus an anderen Stellen und in anderen Zusammenhängen angesprochen und geklärt. Hier geht es auch nicht um die Klärung des Gebotes der Nächstenliebe, auch zu dieser Frage nimmt Jesus später klar Bezug. Mit dem „Ich aber sage euch“ setzt er einen ganz neuen Akzent auf die Beziehung zu Menschen, die sich feindselig zu ihren Mitmenschen (auch besonders zu den Jüngern Jesu) verhalten. Es geht hier also eindeutig um Feindesliebe! Der Gedanke oder auch der Ansatz zu einer positiven Haltung gegenüber des Feindes, wenn jener in Not ist, gab es schon zur Zeit des Alten Testamentes. So lesen wir in 2Mose 23,4-5:„Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. Wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf mit ihm zusammen dem Tiere auf.“ Anstatt Schadenfreude gegenüber dem Feind, ist vom Gesetz willige Hilfsbereitschaft gefordert. Auch die Geschichte mit der Speisung feindlichen Heeres mit Brot und Wasser aus 2Kön 6,19-23 macht deutlich, dass je nach Umstand dem Feind Güte entgegen gebracht wurde.
Zugrunde für die prinzipielle Neuordnung durch Jesus liegt Gottes Verhalten und Einstellung zu den sündigen Menschen, die sich passiv oder aktiv gegen ihn stellen. Nicht Gott ist der Menschen Feind, sondern der Mensch stellt sich gegen Gott und wird so zum `Feind` Gottes. Doch Gott will und sucht die Versöhnung des Menschen mit sich selbst (2Kor 5,19) „Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.“. „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben“ (Joh 3,16; Röm 5,6-8). Noch am Kreuz tat Jesus Fürbitte für seine Feinde: „Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun“! (Lk 23,34; Jes 53,12). Auch Stefanus folgte seinem Herrn und bat für seine Verfolger (Feinde) Apg 7,60.
Wir erkennen dabei auch, dass es nicht nur um das Erdulden von Unrecht geht, sondern um aktives `Lieben der Feinde` welches durch Segnung, Fürbitte und sogar Wohltun, deutlich wird.
Auch der Apostel Paulus folgte seinem Herrn in Wort und Tat: „Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist’s möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben (5.Mose 32,35): »Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.« Vielmehr, »wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen; dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln« (Sprüche 25,21-22). Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem“ (Röm 12,17-21). Auch Gott lässt die Sonne scheinen auf Böse und Gute und beweist damit seine Güte gleichermaßen gegenüber allen Menschen. Die vollkommenheit, die Jesus von seinen Nachfolgern erwartet, liegt in der Gott-ähnlichen Gesinnung. Kinder sind in der Regel das Spiegelbild ihrer Eltern. Die Ähnlichkeit der Gläubigen mit Jesus, dem eingeborenen Sohn Gottes, bezeugt auch ihre Gotteskindschaft!
Fragen:
- Wer wurde nach dem Gesetz als Feind Bezeichnet?
- Wie begründet Jesus das Gebot der Feindesliebe?
- Wie kann Feindesliebe ganz bei uns praktisch aussehen?
Εrfüllung des Gesetzes – Feindesliebe
„Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du sollst deinen Nächsten lieben« (3.Mose 19,18) und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel“.
Auch der Evangelist Lukas überliefert diese Jesusworte: „Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen“.
Für einen aufmerksamen Bibelleser stellt sich hier die Frage, ob Jesus etwas ganz Neues einführt, oder ob diese Verhaltensnormen schon im Gesetz und in den Propheten enthalten sind?
Wir finden folgende Beispiele:
- 2Kön 6,20-23 Die Syrer in Samarien
- 1Sam 24,20 Saul und David
- Spr 25,21-22
| Matthäus | Lukas |
| Liebt eure Feinde
Bittet für die, die euch verfolgen, |
Liebt eure Feinde,
1. Tut wohl denen, die euch hassen, 2. Segnet, die euch verfluchen 3. Bittet für die, die euch beleidigen |
Veröffentlicht unter JESUS, WOHIN GEHST DU?, UNTERWEGS MIT JESUS
Verschlagwortet mit Bethsaida, Chorazin, Galiläa, Kapernaum, See Genezaret
Kommentare deaktiviert für 3. Kapitel: Jesus in Galiläa
2. Kapitel: Vorbereitung zum Dienst
Kapitel 2 – Die Vorbereitung zum Dienst

Abbildung 1 Das Städtchen Nazaret ist im Alten Testament nicht erwähnt, war also unbedeutend. Hier begann die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Hier wuchs Jesus auf bis er etwa 30 Jahre alt war. (Foto: Aptil 1986).
2.1 Der zwölfjährige Jesus im Tempel in Jerusalem
(Bibeltext: Lk 2,41-52)
Der Evangelist Lukas berichtet wieder mal als Einziger über diese Geschichte im Leben von Jesus:
Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch (έθος – ethos) des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, und seine Eltern wussten’s nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten, und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. (Lk 2,41-47).
Jedes Jahr gehen Josef und Maria nach Jerusalem zum Passahfest. Damit halten sie sich an Gottes Ordnung für die nationalen Feste Israels (2Mose 12,11; 3Mose 23,5; 5Mose 16,5-6.16). Natürlich nehmen die Eltern ihre Kinder mit, denn so können sie ihnen die Geschichte der Erlösung des Volkes aus der Knechtschaft Ägyptens tief einprägen.
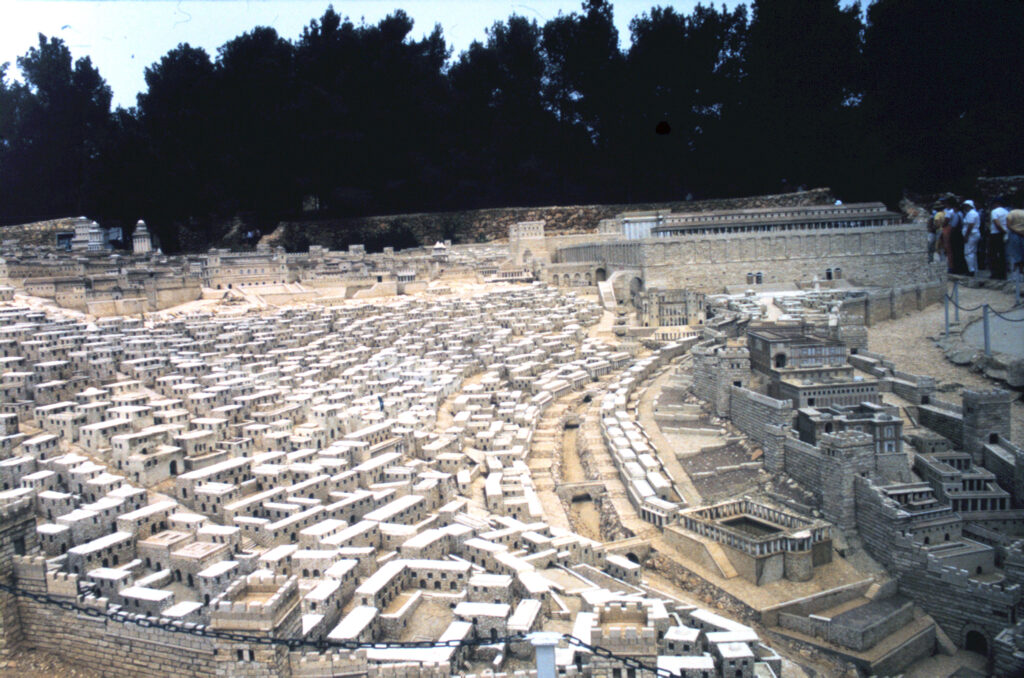
Abbildung 2 Modell der Stadt Jerusalem zur Zeit von Jesus. Die Stadt war in den Grenzen seiner Mauern vielleicht nur etwas mehr als ein Quadratkilometer groß. Fast ein Drittel nahm der Tempelbezirk im Südpsten der Stadt ein. Dazu kamen die Burg Antonia, der Palast der Hohenpriesterfamilie, sowie der Palast des Herodes, Viele wohlhabende und einflussreiche Familien hatten ihre Häuser in den sonst engen Gassen der Stadt. Die Handwerkerfamilien bildeten den nächst größeren Anteil. Viele ärmere Familien lebten außerhalb der Stadtmauern (Foto: April 1986).
Als Jesus zwölf Jahre alt ist, geht die Familie wie immer zum Fest hinauf nach Jerusalem. Wir werden vom Evangelisten Lukas besonders auf das Alter von Jesus hingewiesen. Zwölf Jahre ist ein besonderer Schnittpunkt im Leben eines jüdischen Jungen – er überschreitet die Schwelle vom Kind zum Knaben. Denn es gibt in der jüdischen Kultur folgende Stufen von der Geburt bis zum vollen Mannesalter:
– Säugling (gr. βρέφος – brefos, der Begriff wird auch für Babys, die noch im Mutterleib sind benutzt) bis zum 3. Lebensjahr, bzw. dem Ende der normalen Stillzeit.
– Kind (gr. παίδος – paidos) meist ab dem 4. Lebensjahr; dem Beginn des religiösen Lebens; ab dem 5. Lebensjahr erfolgte der Unterricht in der Schrift; ab dem 10. Lebensjahr in der Mischna.
– Knabe (gr. παίς παιδάριον – pais paidarion) ab ca. dem 12. Lebensjahr; Begin der Berufsausbildung; ab dem 13. Lebensjahr war er zum Halten der jüdischen Gesetze verpflichtet.
– Jüngling (gr. νεανίας νεανίσκος – neanias neaniskos) nach Abschluss der Pubertät; ist schon zum Militärdienst fähig, wird für junge Männer (wenn nicht verheiratet) bis ca. 30 Jahre benutzt.
Die Mutter spricht ihren Sohn Jesus nach einer langen Suche neutral als `τέκνον – teknon` „ganz allgemein Kind“ an (so werden Mädchen, Jungen und im übertragenen Sinne auch Erwachsene gerufen), während der Evangelist Lukas Jesus als Knabe (παίς – pais) vorstellt.
In Lukas 2,43 heißt es: „als vollendet waren die Tage, während sie zurückkehrten (…)“, dieses: „während“ ist eine Besonderheit des Lukas und unterstreicht die Bewegung, die Dynamik in der Geschichte. Im Rahmen der Erzählung ist eines bemerkenswert – die Sorglosigkeit der Eltern. Sie machen sich anscheinend gar keine Sorgen, dass ihr Erstgeborener Sohn Jesus nicht in engem Kontakt mit ihnen während der Wanderung bleibt. Die Zwölfjährigen und dazu noch Erstgeborenen genossen eine relativ große Freiheit, vielleicht sogar eine größere als die jüngeren Geschwister. Aus späteren Berichten erfahren wir, dass Josef und Maria noch vier Söhne und mindestens zwei Töchter hatten (siehe Mk 6,3) und die konnten zu dieser Zeit ebenfalls mit auf der Reise gewesen sein. Die Reise in größeren Reisegruppen trug wohl auch zu dieser relativen Sorglosigkeit bei. Der Weg von Jerusalem hinab nach Jericho war damals ein relativ schmaler Pfad und keine ausgebaute Heerstrasse. Daher war auch der Pilgerzug sehr lang und unübersichtlich. Erst gegen Abend des ersten Reisetages, suchen sie ihren Erstgeborenen Jesus. Und nun geht es wieder eine Tagereise weit steil bergauf bis Jerusalem. Nach mühevollem und verzweifeltem Suchen finden sie ihn `nach drei Tagen`, bzw. `am dritten Tag` im Tempel. Eher stellt sich hier die Frage an die Eltern, warum sie nicht schon am Sammelplatz in Jerusalem und bei der Abreise ihre Kinder zählten? Und wenn sie tagelang in Jerusalem ihren Sohn suchten, warum schauten sie nicht im Bereich des Tempels nach?
Jesus ist bewusst in Jerusalem geblieben. Rätselhaft bleibt, warum er seiner Mutter und Josef nichts davon gesagt hatte. Einerseits verspürt Jesus ein deutliches Verlangen sich in der Nähe des Tempels aufzuhalten. Andererseits macht diese Episode auch deutlich, dass Jesus als heranwachsender Mensch zu diesem Zeitpunkt noch nicht alles über seine Zukunft weiß. Diese Begrenzung oder Einschränkung gehört zu seinem Menschsein. Wenn es von ihm heißt, dass er „zunahm an Weisheit, Alter und Gnade vor Gott und den Menschen,“ dann unterstreicht es den normalen Wachstumsprozess, den ein Mensch durchläuft.
Diese Episode macht auch deutlich, dass Jesus im Kindesalter keine Wunder getan hatte.
Im Gegensatz zu einer apokryphen Schrift aus dem Ende des 2. Jahrhunderts: Kindheitsevangelium nach Thomas. Dort wird geschrieben, wie Jesus aus Lehm fünf Spatzen formte und zu Leben erweckte oder einen Spielkameraden in einem Wutanfall wie einen Baum verdorren ließ.
Es scheint auch, dass er nicht im vollen Umfang den Willen Gottes erfassen konnte. Doch Jesus verbringt seine Zeit auf sehr sinnvolle Weise in Jerusalem. Nach der Fülle der Arbeit, die so ein Fest für die Rabbiner in Jerusalem mit sich brachte, haben sie nun etwas mehr Ruhe und der Alltag im Tempel scheint seinen normalen Lauf zu bekommen. Jesus darf bei den Lehrern sitzen und ihnen zuhören. Dabei bleibt es nicht beim Hören allein, er stellt Fragen und hier und da gibt er auch Antworten. Die Methode der Unterweisung war oft eine Art Lehrgespräch. Jesus fällt dabei mit seinem Wissen und mit seiner Klugheit offensichtlich auf. Im Text wird hervorgehoben: „Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten,“
Mitten in diese Idylle platzen die suchenden Eltern hinein. Verwunderung ist ihnen deutlich anzumerken. Sie sind entsetzt – sogar bestürzt. Die erste Reaktion einer besorgten Mutter ist: „Kind, warum hast du uns das angetan?“ (Lk 2,48). Ist die Erwartung von Maria an den Zwölfjährigen nicht zu hoch, sind nicht die Eltern für ihre Minderhährigen Kinder Verantwortlich?
Die überraschende Antwort von Jesus darauf ist: „Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?“ (Lk 2,49). So einfach diese Worte auch klingen, so zeigen sie doch die besondere und einzigartige Beziehung von Jesus zu seinem himmlischen Vater. Uns als Leser fällt wieder mal auf, dass Josef nicht im Vordergrund steht, sondern die Mutter von Jesus. Die Evangelisten verfolgen einheitlich diese kulturell unübliche Darstellungsweise. Josef sorgt für Jesus – verbleibt aber im Hintergrund. Er ist nicht sein Vater, obwohl Maria in diesem Zusammenhang ihn als Vater bezeichnet – „dein Vater und ich“. (Lk 2,48).
Von Maria hören wir zum wiederholten Mal, dass sie alles was über Jesus oder von ihm gesagt wird, in ihrem Herzen bewegte/bewahrte (Lk 2,51). Sie speichert nicht nur einzelne Aussagen oder Ereignisse, sondern bewegt sie in ihrem Herzen, obwohl sie deren tiefen Sinn noch nicht versteht.
Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. (Lk 2,50-51).
Jesus willigt dann widerspruchslos in den Willen seiner Eltern ein und kehrt mit ihnen nach Galiläa zurück. Er ordnet sich ihnen selbstverständlich unter – eine vorbildliche Einstellung! Der Sohn Gottes macht sich abhängig von fehlerhaften Menschen.
Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. (Lk 2,52).
Jede weitere „Zunahme“ im Leben eines Menschen hängt sehr von dem richtigen und guten Abschluß einer vorangegangenen Lebensphase ab. Damit ist Jesus auch ein echtes Vorbild für Teanager unserer Zeit.
Fragen / Aufgaben:
- Auf welche alttestamentliche Verordnung gründete sich die Gewohnheit der Eltern von Jesus, jedes Jahr nach Jerusalem zum Passahfest zu pilgern?
- In welchem Sinne wird heute der Begriff `Ethos` gebraucht?
- Was bewog Jesus in Jerusalem zurückzubleiben und womit beschäftigte er sich dort?
- Beschreibe die möglichen Gedanken und auch die Gefühle von Maria und Josef, bei der tagelangen Suche nach Jesus?
- Hast du gelegentlich auch zu hohe Erwartungen, Anforderungen an deine Kinder?
- Wie lange sollen Kinder ihren Eltern untertan sein und in welchen Bereichen?
- Welch ein Segen liegt grundsätzlich auf der Unterordnung unter Autoritäten, welche von Gott eingesetzt sind?
- Wie hast du das Erwachsenwerden erlebt? Wann bist du erwachsen geworden?
2.2 Jahre des Reifens
(Bibeltext: Lk 2,52)
Der Evangelist Lukas schreibt: „Und Jesus nahm zu an Alter, Gnade und Weisheit bei Gott und den Menschen.“ (Lk 2,52).
Dies ist wohl die einzige konkrete Aussage über Jesus, die ihn in seiner Entwicklung nach dem zwölften Lebensjahr beschreibt. Fast 18 Jahre vergehen, bis zum öffentlichen Wirken. Keiner der Evangelisten macht konkrete Angaben über jene Zeit.
- Er nahm zu an Alter“, heißt, Jesus wächst ganz normal heran – er hat keine Lebensphase übersprungen. Er entwickelt sich ganz normal vom Teenager zum Jüngling und dann zum Mann.
- „Er nahm zu an Gnade bei Gott und den Menschen“, die Betonung liegt nicht auf ‚Gnade’, die von Jesus ausgeht, sondern von Gott und den Menschen. Ähnlich war es bei Noah: „Noah fand Gnade vor dem Herrn“ (1Mose 6,8), oder bei Salomo: „Er fand Gnade bei Gott“ (Apg 7,46). Gottes ganze Zuwendung, Freude und Wohlwollen ruhen auf Jesus. Auch die Menschen, die ihn umgeben, sind gut auf ihn zu sprechen. Sie freuen sich an ihm, sie sind ihm günstig gesonnen. Und diese Gnade kann Jesus auch reflektieren. Später heißt es von Jesus: „Aus seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.“ (Joh 1,16). Gnade beinhaltet: Gunst, wohlwollende Zuwendung und Zuneigung, mit dem Angesicht zugewandt, wohl gesonnen sein, sich freuen an und über jemanden, Wohlgefallen haben an jemand.
- „Er nahm zu (…) und (an) Weisheit bei Gott und den Menschen“, dass heißt, dass Jesus die Erkenntnisse richtig anwendet. Und dies geschieht vermehrt mit zunehmendem Alter. Er wächst aber auch geistlich. Er hat nicht alles auf einmal bekommen, sondern der jeweiligen Altersstufe entsprechend und zwar in reichem Maß.
Gnade und Weisheit sind göttliche Eigenschaften, es geht darum, die von Gott geschenkten oder durch Menschen und das Leben angelernten Erkenntnisse richtig anzuwenden und umzusetzen. Dies geschieht im Umgang mit Menschen bei der alltäglichen Arbeit und den Pflichten in der Familie. Aus den Aussagen der Evangelisten über die Familie von Jesus oder aus den von Jesus erzählten Gleichnissen können wir einiges ableiten, was in jener Zeit der Reifung geschehen sein könnte.
Jesus ist auch noch nach seinem zwölften Lebensjahr jedes Jahr zum Passahfest nach Jerusalem gepilgert. Dies wird zum einen aus dem Hinweis in Lk 2,41 ersichtlich und zum anderen aus der Tatsache, dass er sich später in Jerusalem und Umgebung gut auskennt. Der Ölberg, Bethanien (Joh 12,1), der Turm am Siloah Teich (Lk 13) und der Teich Bethesda am Schaftor mit seinen fünf Hallen (Joh 5,1ff) sind Orte, die er gut kennt. Die Aussage des Apostels Paulus in Galater 4,4 „Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan“, unterstreicht rückblickend zusätzlich, dass Jesus all die Forderungen des Mosaischen Gesetzes an einen männlichen Bürger Israels beachtete – nicht zuletzt auch, weil Josef und Maria fromme und gottesfürchtige Eltern waren. Mit ihrem Verhalten bildeten sie einen guten Rahmen für eine gesunde Entwicklung von Jesus.
Dass Jesus an den Sabbaten in die Synagoge geht, wie alle anderen gottesfürchtigen Juden, steht außer Frage – heißt es doch auch noch später von ihm, dass er nach seiner Gewohnheit am Sabbat, dem jüdischen Wochenfeier- und Ruhetag in die Synagoge geht (Lk 4,16).
Wie alle jüdischen Knaben muss auch er zum Unterricht in die Synagoge gehen und wird aus dem Gesetz unterrichtet. Die spätere Aussage der Pharisäer: „Wie kennt dieser die Schriften, obwohl er sie doch nicht gelernt hat,“ meint nicht, dass Jesus in seiner Kindheit es nicht für nötig hielt in die Schule zu gehen. Es weist nur darauf hin, dass Jesus keine rabbinische Schule in Jerusalem bei den Schriftgelehrten der damaligen Zeit besucht hat, wie es zum Beispiel bei Saulus/Paulus der Fall war.
Aus Markus 6,3. erfahren wir, dass Jesus den Beruf eines Zimmermanns – wie auch sein „Stiefvater“ Josef – erlernt. Allerdings ist die Berufsbezeichnung „Zimmermann“ nicht ganz korrekt. Wie schon oben aufgezeigt bezeichnet der griechische Begriff `τέκτων– tektön` einen, der Häuser baut. In diesem Beruf arbeitet Jesus wohl mindestens 15 Jahre. Er ist ein guter Meister in seinem Fach:
- Aus dem Gleichnis vom klugen und törichten Mann (Mt 7,24-29) spricht nicht nur Kompetenz, sondern auch Erfahrung.
- Aus dem Gleichnis vom Turmbau (Lk 14,28-30) spricht die Erfahrung mit Kostenberechnung von zu bauenden Objekten.
- Andere, aus dem Bau genommene Beispiele, unterstreichen seine Kompetenz im Handwerk. Wir können davon ausgehen, dass Jesus fleißig, zuverlässig und treu in seinem Beruf war.
Jesus wächst in einer ganz normalen jüdischen Familie auf. Er hatte noch vier Brüder:
- Jakobus, Josef (Joses), Simon und Judas. Alle Brüder glauben bis zu seiner Auferstehung nicht an ihn als den von Gott gesandten Messias (Joh 7,5). Und er hat mindestens zwei Schwestern (Mt 13,55-56; Mk 6,3). Jesus ist also kein Einzelkind. Als Ältester von mindestens sechs Geschwistern, muss er schon früh Verantwortung übernehmen. Mit zwölf Jahren ordnet er sich erneut ganz bewusst den Eltern unter. So erlebt er alle Details im Zusammenleben einer Familie in einem Haus und in der Nachbarschaft. Der Gegensatz zu Johannes dem Täufer wird hier besonders bewusst. Jener wächst als Einzelkind auf und wird durch ein ganz anderes Umfeld geprägt. Das Beziehungsgeflecht in einer Großfamilie ist bis heute eine unersetzliche Schule für soziales Verhalten und Charakterbildung. Fürsorge. Rücksichtnahme und Verantwortung können hier in der Praxis erlernt und gelebt werden.
Jesus führt keineswegs ein verborgenes und verdecktes Leben, denn die Einwohner von Nazaret kennen ihn als Baumeister von Häusern, sie kennen seine Familienangehörigen namentlich und was noch auffällt, mit seiner Weisheit hielt er sich wohl sehr zurück. Erst später bei seinem öffentlichen Dienst, wird von den Bewohnern Nazarets mit Verwunderung festgestellt: „Woher kommt ihm diese Weisheit und Taten?“ (Lk 4,22; Mt 13,54). Das heißt auch, dass er vorher keine Wunder getan hatte. Auffällig ist ganz sicherlich: Jesus heiratet so weit wir wissen – entgegen der normalen Praxis eines Orientalen – nicht im jungen Erwachsenenalter. Wir hören nie etwas von einer Hochzeit, von einer Ehefrau oder Kindern in der biblischen Überlieferung. Auch in den späteren Schriften der Apostel und biblischer Autoren gibt es keine Hinweise darüber, dass Jesus eine eigene Familie gehabt hätte. Überraschender Weise nennt auch der andere bekannte bekennende „Single“ Paulus, Jesus nicht als Vorbild für das Ledigsein. Jesus hatte nie einen eigenen Haushalt geführt (Mt 8,20), was eher für einen Ledigen zutrifft. Am Lebensende ist Jesus um seine Mutter besorgt, doch in keiner Weise muss er sich um eine Ehefrau oder Kinder sorgen. Wir schließen uns hier der christlichen Tradition von dem Single Jesus an. Trotzdem kann Jesus uns auch in Fragen der Ehe bestens verstehen. Von ihm heißt es, dass er versucht wurde „in allem gleich wie wir, doch ohne Sünde.“ (Hebr 4,15). Er kann uns in allen Lebensphasen und Lebenssituationen sehr gut verstehen.
Es ist auffallend und auch herausfordernd, dass Jesus sich (ähnlich wie bei Johannes) 30 Jahre lang auf seinen nur etwa dreieinhalbjährigen Dienst vorbereitet.
Fragen / Aufgaben:
- Über welche Details aus dem Leben von Jesus in der Zeit des Reifens sollten wir ein wenig intensiver nachdenken und Ableitungen für heute wagen?
- Welche menschlichen Faktoren waren günstig für die Entwicklung von Jesus?
- Wie schätzt du deinen persönlichen Werdegang in der Schulzeit und Berufsausbildung ein? Welche Bedeutung haben sie auf dein heutiges Leben?
- Was bedeutet Weisheit für den Alltag?
- Was bedeutet der Prozess des „Zunehmens an Weisheit“ für unser Gemeindeleben?
2.3 Johannes der Täufer – seine Identität und Dienstbeginn
(Bibeltexte: Lk 1,5-25; 38-80; Mt 3,1; Mk 1,1-2; Lk 3,1-3)
Alle vier Evangelien berichten von Johannes, dem Sohn des Zacharias und der Elisabeth, als dem Wegbereiter von Jesus. Der Evangelist Lukas berichtet zusätzlich und ergänzend auch über die Details der Herkunft und Geburtt von Johannes. So berichtet er:
Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abija mit Namen Zacharias, und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind; denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen; und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn; Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. (Lk 1,5-20).
Der Name Johannes hat die Bedeutung: ‚Der Herr ist gnädig’, diese Namensgebung wird durch den Engel angeordnet (Lk 1,13). Gott hat Zacharias und Elisabeth, so wie das ganze Volk Israel gnädig angesehen. Schon die Ankündigung und die Geburt des Johannes ist ein ungewöhnlicher Bericht. Der Evangelist Lukas beschreibt im Detail die heilsgeschichtlichen und auch die menschlichen Aspekte in Bezug auf die Geburt des Johannes. Der Bekanntheitsgrad seiner Eltern ist hoch, wie wir aus der jüdischen Überlieferung wissen. So kommt es zu einer starken Verbreitung der Ereignisse rund um die Geburt und die Kindheit des Johannes. Die Bemerkung der Leute: „Was wird wohl aus diesem Kind werden, denn die Hand des Herrn war mit ihm“ (Lk 1,66), weckt bei vielen Juden neu die Hoffnung auf Gottes Eingreifen in Zeiten der Unterdrückung, Gewalt und Not.
Der Vater des Johannes gehört zur Priestergruppe Abija, seine Mutter stammt ebenfalls aus dem Hause Aaron, somit gehören beide zum Stamm Levi. Auf den Priester Abija fiel das achte Los bei der Diensteinteilung durch den Hohenpriester Zadok nach der Anweisung Davids (1Chr 24,10). Nach der babylonischen Gefangenschaft wurden die 24 Priesterordnungen unter Esra erneuert (Esra 2,36-39; Neh 10,8; 12,4. 17). Jede dieser 24 Priestergruppen waren zweimal im Jahr je eine Woche zum Dienst im Tempel eingeteilt. Bei den drei Jahresfesten (Passah, Wochenfest, Laubhüttenfest) waren alle dienstverpflichtet (Vgl. auch 2Kön 11,5; 2Chr 23,8).
Anmerkungen zum Zeitpunkt der Geburt von Johannes:
- Der Priester Zacharias hatte (neben den drei Jahresfesten) zweimal im Jahr Dienst im Tempel und zwar in der achten Woche nach dem Passah (ca. Mitte Mai-Mitte Juni) und dann in der achten Woche nach dem Laubhüttenfest, das wäre ca. Mitte November – Mitte Dezember.
- Der Evangelist Lukas berichtet: „Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger (…).“ ((Lk 1,23-24a).
- Demnach wäre Johannes entweder im Frühjahr (März) oder im Herbst (September) geboren worden.
- Seinen Dienst begann er nach dem Befehl des Herrn im fünfzenten Jahr der Rerierung des Tiberius Kaiser (Lk 3,1-4), das war zwischen dem 19. August 28 und 18. August 29 im 1. Jh..
- Rechnet man von frühestens Herbst 28 oder spätestens Frühjahr 29 dreißíg Jahre zurück (Dienstalter für den Beginn der amtlichen Priesterdienste), kommt man in den Herbst des Jahres 3 oder Frühjahr des Jahres 2 vor unserer Zeitrechnung für die Geburt des Johannes.
- Da Jesus genau sechs Monate jünger war als Johannes (Lk 1,39) und seinen Dienst ebenfalls mit 30 Jahren begann (Lk 3,23), ergäbe sich für die Geburt von Jesus entweder Frühjahr 2 oder Herbst 2 vor unserer Zeitrechnung.
Ursprünglich hatte Gott für die Priester als Dienstbeginn das Alter von dreißig Jahren festgesetzt und ihr aktiver amtlicher Dienst endete mit fünfzig Jahren. Danach konnten sie den amtierenden Leviten und Priestern helfen, ohne eigene Befugnisse zu haben (4Mose 4,3. 23. 30. 35. 39. 43. 47). Auch Johannes der Täufer beginnt seinen Dienst (als Priestersohn) mit etwa dreißig Jahren. Obwohl Zacharias dem Engel sagt, dass er und seine Frau Elisabeth in die Jahre gekommen sind, war er bei der Geburt des Johannes noch keine 50 Jahre alt (Lk 1,18).

Abbildung 3 Wasserfall in der Schlucht von En Gedi am Ostabhang der Judäischen Wüste und einige Kilometer westlich des Toten Meeres. Hier lagerte David zeitweise mit seinen Männern. Hier können Menschen und Tiere das ganze Jahr hindurch ihren Durst löschen. Wegen der zahlreichen Höhlen in der Gegend hielten sich dort auch Hirten mit ihren Herden auf. Nördlich davon befand sich die Essener-Siedlung. Obwohl es hier das ganze Jahr hindurch Wasser gibt, war die Gegend wenig besiedelt, zählte also zu der Judäischen Wüste (Foto: Juli 1994).
1994).
Johannes hat die Möglichkeit sich ebenfalls auf den Priesterdienst im Tempel in Jerusalem vorzubereiten um dann dort bis ins Alter zu dienen. Doch er wächst in der nicht näher beschriebenen Wüste Judäas auf. Dort wird sein Charakter und seine Gottesbeziehung anders geformt als im priesterlichen Umfeld. So schreibt der Evangelist über Johannes weiter:
Aber das Kind wuchs und wurde stark im Geist und er war in den einsamen Gegenden bis zum Tag seines öffentlichen Auftretens vor Israel. (Lk 1,80).
Johannes weiß wer er ist, da er eine klare Sendung von Gott hat. Auf die Fragen der Gesandten aus Jerusalem: „Wer bist du“? Bist du der Gesalbte (Christus), bist du der Prophet, bist du Elia? antwortet Johannes: „Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste: „Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade.“ (Joh 1,19-23; Lk 3,4; Mk 1,3; Jes 40,3f).
Der Evangelist Markus hebt in seinem kürzesten Bericht noch eine weitere prophetische Aussage aus dem Buch Maleachi hervor: „Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht, der deinen Weg bereiten wird.“ (Mal 3,1a). Der Evangelist Lukas notiert die Voraussage des Engels: „(…) Und er (Johannes) wird vor ihm (Christus) hergehen im Geist und der Kraft des Elia.“ (Lk 1,17. 76). Später bestätigt Jesus die Identität des Johannes mit den Worten: „Dieser ist Elia (…).“ (Mt 17,10-13; Mal 3,23).
Nach dem Zeugnis von Jesus ist Johannes der Täufer nicht einfach ein Prophet wie alle Propheten vor ihm, sondern der größte unter den Propheten (Mt 11,9-11). Die Besonderheit seiner Person wird sogar durch seine Kleidung und Speise unterstrichen (Mt 3,4; 2Kön 1,8). Er trug einen sehr groben Mantel gewoben aus Kamelwolle, darüber einen ledernen Gürtel um seine Hüften und aß Heuschrecken und wilden Honig. Nach dem Bericht des AT wissen wir, dass sich auch Elia so kleidete – typisch und auch praktisch für Menschen, die außerhalb der Orte in der Wüste lebten. Dies war nach 2Kön 1,8 sogar ein Erkennungszeichen für den Propheten. Nach der jüdischen Endzeiterwartung sollte Elia vor dem Ende der Zeit wiederkommen (Mal 3,1. 23-24).
Der Speisezettel des Johannes deckt sich mit dem der Ärmsten seiner Zeit (Keener 1998, Bd. 1, 62).
Auch die Essener hielten sich an eine solche Diät, um sicher zu sein sich nur koscher zu ernähren. Johannes lebte außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft.
Fragen / Aufgaben:
- Beantworte die Frage nach der Herkunft des Johannes. Wer waren seine Eltern, seine Vorfahren? Was bedeutet sein Name?
- Wie können wir mit einiger Sicherheit den Zeitpunkt der Geburt des Johannes berechnen?
- Welche zeitlichen Vorgaben hatten die Priester für ihren amtlichen Dienst?
- Welche Merkmale verbinden Johannes mit Elia?
- Welche Rolle spielt das Umfeld in dem wir aufwachsen?
- Welche Unterschiede zwischen ihm und Jesus fallen dir auf?
2.4 Die zeitlichen Aspekte des Dienstes von Johannes
(Bibeltexte: Lk 3,1-4; Mt 3,1; Mk 1,2; Joh 3,30; 4,1-3)
Der Ev. Lukas verknüpft den Beginn der Wirksamkeit des Johannes mit bekannten geschichtlichen Daten und Namen. Er schreibt:
Aber im fünfzehnten Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Ituräa und der Landschaft Trachonitis, und Lysanias Vierfürst von Abilene, unter dem Hohenpriestertum von Hannas und Kaiphas, geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. (Lk 3,1-3).
Der Beginn der öffentlichen Wirksamkeit des Johannes ist für Lukas so wichtig und bedeutend, dass er einen Zusammenhang zu einer Reihe herausragender Würdenträger der damaligen Zeit herstellt. Es sind fünf politische und zwei religiöse Persönlichkeiten. Für eine Zeitbestimmung des Dienstbeginns von Johannes genügt hier die Zeitangabe in Bezug auf die Herrschaftszeit des Tiberius Kaiser (Lk 3,1).
Kaiser Tiberius trat seine Herrschaft gleich nach dem Tode seines Schwiegervaters, des Augustus Cäsar, am 19. August 14 n. Chr. an. Rechnet man 14 volle Jahre dazu, kommt man in den August 28 n. Chr. So könnte Johannes seinen Dienst schon im Herbst 28 n. Chr. begonnen haben. Doch möglich ist es auch,, dass er erst nach der winterlichen Regenzeit (Januar/Februar 29 n. Chr.) mit seiner Tauftätigkeit begann.
Gottes Wort geschah zu ihm und er kommt in die ganze Gegend am Jordan. Der Ev. Matthäus bezeichnet das Taufgebiet konkreter als „Wüste Judäas.“ (Mt 3,1). Die römische Provinz Judäa ist zur Zeit des Statthalters Pilatus in ihrer Ausdehnung größer als das Stammesgebiet Juda zur Zeit der Könige. Umgangssprachlich verstand man unter Judäa das Gebiet südwestlich der Jabbokmündung in den Jordan und bis an das Mittelmeer, im Süden bis Idumäa.
Johannes wird von den Evangelisten der `Täufer` gr. Ιωάννης ο βαπτιστής – Iöann¢s o baptist¢s genannt, weil Taufen im Wasser seine sichtbare Tätigkeit war.
Der Dienst des Johannes kann in drei zeitliche Abschnitte unterteilt werden.
- Der erste geht bis zur Taufe von Jesus, hier erreicht sein Dienst seinen Höhepunkt. Dies ist der wichtigste und spezielle Auftrag, den er erfüllen muss. Der Ap. Paulus unterstreicht dies in Apostelgeschichte 13,25: „Als aber Johannes seinen Lauf (seinen Auftrag) erfüllte, sagte er: ich bin nicht der, den ihr vermutet (…).“ Die erste Dienstperiode könnte ein halbes Jahr gedauert haben, was dem Altersunterschied zu Jesus entspräche, also von etwa Frühjahr – Sommer 29. n. Chr.
- Die zweite Dienstperiode kann als die Periode des Abnehmens bezeichnet werden, wie er selber in Johannes 3,30 sagt: „Jener (Jesus) muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“ Diese zweite Periode wird etwas weniger als ein Jahr gedauert haben (Joh 3,23). Sie ist durch folgende Etappen im Leben von Jesus markiert: wenn wir annehmen, dass Jesus etwa im Spätsommer oder Herbst des Jahres 29 getauft wurde, ging er nach einigen Wochen zurück nach Galiläa, begann seinen Dienst und zog zum nächsten Passa (Frühjahr 30) nach Jerusalem (Joh 2-3). Danach ging er für einige Zeit an den Jordan (Joh 4,1ff). Erst in dieser Zeit wird Johannes von Herodes Antipas gefangen genommen (vgl. Joh 3,24 und 4,3 mit Mt 4,12 und Mk 1,14) und Jesus begibt sich wieder (und nach der Chronologie des Johannesevangeliums nun schon zum zweiten Mal) nach Galiläa, diesmal über Samarien. Dies geschah etwa Ende Mai, Anfang Juni des Jahres 30 (Joh 4,35). Daher lässt sich die zweite Dienstperiode des Johannes auf etwa ein ¾ Jahr berechnen.
- Den dritten Abschnitt seines Dienstes verbringt Johannes im Gefängnis. Dieser Teil dauert am längsten, etwa zehn Monate (wenn das Fest der Juden in Johannes 5,1 das Laubhüttenfest des Jahres 30 war) oder etwa 22 Monate (wenn das Fest der Juden in Johannes 5,1 das Passafest des Jahres 31 war).
Auf die zweite und dritte Periode seines Dienstes werden wir an passender Stelle, im Rahmen des Dienstes von Jesus, später näher eingehen.
Anmerkung: Die Aussage in Matthäus 4,12: „Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen genommen wurde, verließ er Judäa und kehrte zurück nach Galiläa“ kann den falschen Eindruck erwecken, dass Johannes bald nach der Taufe von Jesus gefangen genommen wurde. Liest man das Johannesevangelium, stellen wir fest, dass Johannes der Täufer noch längere Zeit seine Tauftätigkeit fortgesetzt hatte. So schreibt der Evangelist Johannes in der Zeit des 1. Jerusalembesuches von Jesus im Frühjahr des Jahres 30: „Denn Johannes war noch nicht gefangen genommen worden (…).“ (Joh 3,24). Diese zeitlichen Details sind nicht unwichtig und wir werden bei Gelegenheit darauf Bezug nehmen. Man kann davon ausgehen, dass sich die gesamte Dienstzeit des Johannes auf etwa zweieinhalb bis drei Jahre ausdehnte. Recht kurz im Vergleich zur Zeit seiner Vorbereitung: etwa 30 Jahre!
Fragen / Aufgaben:
- Beschreibe das politische, religiöse, geographische und das topgraphische Umfeld des Dienstes von Johannes dem Täufer.
- In welche Abschnitte könnte die Dienstzeit des Johannes eingeteilt werden?
- Was hältst du von einer guten Ausbildung und wie oder wodurch könnte die geistliche Charakterbildung bei einem jungen Menschen gefördert werden?
- Erstelle eine Zeit-Tabelle für die inhaltlichen Schwerpunkte in deinem Leben.
- Wie ausgedehnt oder auch wie eingeschränkt siehst du deinen Wirkungskreis?
2.5 Der Inhalt der Verkündigung von Johannes
(Bibeltexte: Mt 3,1-12; Mk 1,3-8; Lk 3,4-18; Joh 1,6-8. 19-28)
Die Botschaft des Johannes ist eindeutig und in zweifacher Hinsicht zielausgerichtet: „Denkt um, denn genaht hat sich das Reich der Himmel.“ (Mt 3,2). Und: „Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade seine Pfade.“
Anmerkung: „Juden kennen die Bitte vom Gottesreich, das kommen möge. Es wird in folgenden Gebeten erwähnt:
a) Das 18-Bitten-Gebet: …Du bist heilig, dein Name ist heilig … Vergib uns, unser Vater, denn wir haben gesündigt, verzeih uns unser KÖNIG, denn wir sind voller Schuld.
- b) Das Kaddisch (= die Heiligung; gemeint ist: Gottes): „Erhoben und geheiligt werde sein großer Name in der Welt … Er lasse sein REICH kommen… Sein großer Name sei gepriesen…“
- c) Das Alenu- Gebet (es beginnt: „An uns ist es, den Herrn des Alls zu preisen …. ):
“… .du regierst bald über sie immer und ewig, denn das REICH ist dein… Und der Ewige wird zum KÖNIG über die ganze Erde sein, an jenem Tag wird der Ewige einzig und sein Name einzig sein.“ (aus http://stephanscom.at/bibel/0/articles/2004/02/16/a4854/).
„Denkt um, denn genaht hat sich das Reich der Himmel“ – dies könnte die passende Überschrift der Botschaft des Johannes sein, doch außer der Ankündigung des nahenden Reiches Gottes hat Johannes von Anfang an auch die Ankündigung des Messias in seiner Verkündigung. Eigentlich kommt das himmlische Reich nur in Verbindung mit der Person des Messias / Christus (Mt 3,3).
Folgende Aspekte betont Johannes in seiner Predigt:
- Er predigt die Taufe des Umdenkens (der Sinneswandlung) zur Vergebung der Sünden (Mt 3,1-6; Mk 1,4; Lk 3,3);
- Er fordert das Volk auf den Weg für den Herrn vorzubereiten, eben zu machen. Es geht natürlich nicht um Äußerlichkeiten, sondern um den Lebensstil, der eine tiefe Liebe zu Gott dem Vater und zum Nächsten ausdrückt
- Johannes sieht seine Aufgabe darin, das Volk auf den bald kommenden Messiaskönig vorzubereiten. Der Messias kommt, darum fordert er seine Zuhörer zur Umkehr auf (Joh 1,7-8; 26-27);
- Er greift mit scharfen Worten den frommen Formalismus an, besonders bei den Pharisäern (Mt 3,7-12; Lk 3,7-9);
- Er will die aufrichtigen Frommen des Volkes auf den vorherrschenden Formalismus aufmerksam machen und sie aus ihm herausführen.
- Er gibt Hilfestellung für das praktische Leben (Lk 3,10-14);
- Er bekehrt die Herzen der Väter zu ihren Kindern (Lk 1,16-17);
- Er will die religiösen Hoffnungen der Juden weg von der politischen Befreiung von den römischen Besatzern hin zur Umkehr zu Gott und zum Glauben an den Messias lenken.
- Er erkennt, begrüßt und bezeugt Jesus als Messias und Lamm Gottes und tauft ihn im Wasser (Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; Joh 1,29; 35-36);
- Er weißt noch später rückblendend auf Jesus als „den vom Himmel gekommenen hin“ (Joh 1,15; 3,28-36).
Seine Zuhörer bleiben nicht ununterbrochen bei ihm, sondern sie kommen und gehen. So stellt sich für Johannes die Aufgabe allen in etwa auch das Gleiche zu sagen und diejenigen, die zur Umkehr bereit sind zu taufen im Wasser des Jordan. Diejenigen, die sich nach einer Gesinnungsänderung von Herzen taufen lassen, sind dann auch entsprechend auf das Kommen des Messias vorbereitet und warten auf ihn, harren bei Johannes aus – sie werden zu seinen Jüngern.
Der Evangelist Lukas ergänzt und erweitert das Jesajazitat:
Jede Schlucht soll aufgefüllt werden und jeder Berg und Hügel soll niedrig gemacht werden und das Krumme soll gerade und das rauhe zu ebenen Wegen werden und jedes Fleisch soll die Rettung Gottes sehen. (Lk 3,5-6).
Ein meist aus dem Osten kommender König erwartete in der Vergangenheit immer, dass für ihn die Straßen instand gesetzt wurden. Auch zur Zeit des Johannes kann man überall sehen, wie beim Bau römischer Heerstraßen sehr aufwendig der Untergrund geebnet und vorbereitet wird. Im übertragenen Sinn verwendet Johannes dieses alttestamentliche Bild aus dem Straßenbau für das beginnende Reich Gottes. Das Reich Gottes ist ein Reich des Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude (Röm 14,17). Gerade durch diese Bildrede wird das Wesen des Reiches Gottes verständlich gemacht. Im Reich Gottes ist alles ausgeglichen, Reiche und Arme, Gebildete und Laien nehmen den Status der Kinder Gottes ein und sind somit vor Gott gleich geachtet. Die Aussage: „Alles Fleisch (gr. `πάσα σαρξ – pasa sarx `, gemeint sind alle Menschen) soll die Rettung Gottes sehen“, deutet auf die Einbeziehung der Völker in den Heilsplan Gottes. Damit wird die Verbindung zur Verheißung an Abraham hergestellt: „In deinem Nachkommen sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden.“ (1Mose 22,18). In deinem Nachkommen (Singular): „welcher ist Christus.“ Gal 3,16).
Johannes der Täufer ist von seiner Herkunft her zwar Priester, doch seinen Dienst versieht er nicht im Tempel am Altar, sondern am Jordan. Nicht auf dem Berg Zion in Jerusalem (ca.738 m über NN), sondern unten im tiefsten Tal der Erde, nördlich des Toten Meeres (ca. 380 m unter NN). Der Ort ist für die aus Jerusalem herabkommenden Stadtbewohner ideal, um dort eine anschauliche Predigt von der Sinnesveränderung und Umkehr zu hören. Denn Umkehr erfordert eine innere Beugung, ein sich demütigen, sich erniedrigen. Auch wird durch die Ferne von Jerusalem der Übergang vom Opfergottesdienst durch die Priester am Altar im Tempel, zu einem neuen wahren Gottesdienst deutlich. War dieser doch schon im Alten Testament von Gott als der richtige Gottesdienst vorgesehen:
(…) Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. (Ps 51,18-19).

Abbildung 5 Die Treppen zeigen den Zugang zur Taufstelle im Jordan in den späteren Jahrhunderten. Der Jordan hat seinen Lauf verändert und so liegen diese Steine als stumme Zeugen für die durch die Tradition und die Kirchenbauten aus der Antike bezeugte Taufstelle des Johannes (Foto: 7. November 2014).
Gott hat so durch die räumliche Entfernung des Dienstortes von Johannes, den Übergang vom Alten zum Neuen Testament markiert. Die interessierten Bewohner Judäas müssen sich auf den Weg machen und dabei die gewohnten Wege und Pfade im religiösen Leben verlassen, um zur Taufstelle am Jordan zu gelangen. Der Ort der Taufe ist von Gott bewusst gew#hlt – in derselben Gegend lagerten die Israeliten, bevor sie über den Jordan gingen um das gelobte Land in Besitz zu nehmen. Der Ausgangspunkt für den Einzug in das geistliche gelobte Land des Reiches Gottes ist derselbe, doch die Kriterien für die Einnahme dieses vom Himmel herabkommenden Gottesreiches sind nicht mehr materieller, sondern geistlicher Natur. Der jahrhundertelange Rhythmus im Leben der Israeliten wird damit unterbrochen, damit sie ihre Traditionen und gewohnten Denkmuster neu im Licht Gottes bewerten können. Bei Johannes am Jordan bekommen sie durch das Hören seiner klaren Predigt Neuorientierung.
Die Besorgnis der Jerusalemer Führer kann man verstehen (Joh 1,19ff), da in dieser Zeit der Pilgerstrom umgelenkt wird. Sie befürchten ihren Einfluss zu verlieren – das Volk läuft ihnen mehr und mehr davon. Doch nach Gottes Weisheit läuft der Priesterdienst in Jerusalem ungestört weiter, während Gott etwas Neues in der Wüste beginnt. Während der alte Gottesdienst verblasst, erglänzt der Neue in einem hellen Lichtglanz – zwar anknüpfend an den Geist der Tradition, nicht mehr aber an dem Buchstaben.
Zu den vielen Menschen (besonders an die Pharisärer und Sadduzäer gewandt), die an den Jordan kommen, um sich taufen zu lassen, spricht Johannes:
Otternbrut! Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Früchte; und beginnt nicht, bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater! Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt, jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. (Lk 3,7-9; Mt 3,7).
Anmerkung: „Die Menschen des Altertums glaubten, dass die Brut mancher Schlangenarten sich aus dem Bauch ihrer Mütter herausfräße“ (Keener 1998, Bd. 1, 62). Unterstellt wird mit diesem Ausdruck, dass die Zuhörer Mörder der Eltern (Vorfahren) seien.In diesen Sätzen wird den Israeliten deutlich gemacht, dass Gott nicht an die natürliche Abstammung von Abraham gebunden ist, sondern diesen Begriff international weitet und die Glaubenden aller Völkern als Abrahams Kinder bezeichnet (Röm 9,6ff). Heiden, die zum Judentum übertreten wollten, mussten „Buße“ tun und sich durch Untertauchen waschen lassen. Johannes behandelt die Juden hier wie Heiden (Keener 1998, Bd. 1, 62).
Johannes geht es bei seinen Predigten nicht um eine hohe Anzahl von Täuflingen, sondern die Echtheit der Umkehr. Er sucht nicht Anerkennung, sondern die Ehre Gottes. Seine Predigtart ist geprägt von seiner göttlichen Sendung als Prophet, der mit einem lauten Weckruf seinen Landsleuten entgegen tritt. In der jüdischen Literatur wird manchmal das Symbol des Baumes in Gleichnissen für das Gericht über Israel verwendet (Jes 10,18-19; Jer 11,16; Hes 15,6).
Johannes liegt viel daran, in seiner Predigt die überragende Größe des Messias hervorzuheben. So sagt er dem Volk:
Es kommt der Stärkere als ich, nach mir, vor dem ich nicht gut genug bin mich zu bücken und den Riemen seiner Sandale zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. (Mk 1,7-8). Die Evangelisten Matthäus und Lukas ergänzen: „(…) er wird euch mit dem Heiligem Geist und mit Feuer taufen.“ (Mt 3,12; Lk 3,16).
Nach der Sicht der meisten jüdischen Gelehrten war das Wirken des Geistes seit Maleachis Tod erloschen. Die verheißene Wiederkehr des Geistes, war deshalb ein Hinweis auf das Kommen des Messias.
Die Aussage des Johannes „mit Feuer taufen“ scheint die Ausgangsbasis für die Lehre von der Feuertaufe der Gläubigen zu sein. Wir suchen zunächst nach weiteren Stellen in diesem Zusammenhang. Die direkte Verknüpfung zu der Johannesaussage stellt Jesus selber her. In Apg 1,4-5 sagt er:
(…) entfernt euch nicht von Jerusalem, sondern erwartet die Verheißung des Vaters, die ihr von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. (Apg 1,4-5).
Wie wir sehen, fehlt hier bei Jesus der Zusatz: „und mit Feuer“, so auch an den übrigen Stellen, wie Lk 24,49; Apg 1,8; 2,33; 19,1ff; Eph 1,13 und weiteren Stellen, die den Empfang des Heiligen Geistes beschreiben. Allerdings wird in Apg 2 bei der Ausgießung des Heiligen Geistes das Feuer erwähnt. Dort lesen wir:
Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und sie setzten sich auf einen Jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. (Apg 2,3-4a).
Hier wird nicht gesagt, dass der Heilige Geist im Feuer, oder wie Feuer auf die Jünger herabkam, sondern nur die Zungen waren zerteilt, wie von Feuer. Die Jünger erlebten die verheißene Geistestaufe, nicht eine wie immer geartete Feuertaufe.
Wie kann denn nun die Aussage des Johannes „Er wird euch mit Feuer taufen“ im Matthäus- und Lukasevangelium verstanden werden? Johannes gibt einen Teil der Antwort, die wir in Mt 3,12 lesen:
In dessen Hand ist die Worfschaufel, und er (Jesus) wird seine Tenne ganz säubern und er wird seinen Weizen sammeln in die Scheune, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. (Mt 3,12).
Das ‚Worfeln’ war den Zeitgenossen des Johannes allgemein bekannt: nach der Ernte warf man an einer windigen Stelle die gedroschenen Weizenähren in die Luft. Der Wind trennte das schwerere Korn von der leichteren Spreu. Die nutzlose Spreu wurde meist verbrannt. Dieses Bild finden wir z.B. in Jes 17,13; Jer 13,24; 15,7.
Könnte es nicht sein, dass Jesus hier von der Taufe der Gläubigen mit dem Heiligen Geist spricht und zugleich von einer Feuertaufe derer, die ihm nicht gehorchen (= Spreu) zum Gericht? Dafür gibt es manche biblische Belege, zum Beispiel:
Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer (Hebr 12,29). Wer kann vor seinem Zorn bestehen, und wer kann vor seinem Grimm bleiben? Sein Zorn brennt wie Feuer und die Felsen zerspringen vor ihm. (Nahum 1,6).
Auch in Johannes 15,6 im Gleichnis vom Weinstock und den Reben, heißt es:
Jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen und sie wird ins Feuer geworfen. (Joh 15,6).
In 1Kor 3,12-15 weißt Paulus auf das Feuer des Gerichts Gottes hin, welches auf die Gläubigen bezogen wird. Alle Werke, die nicht in Gott getan sind, werden verbrennen. Aber dieser Art der Feuerbewährung werden die Gläubigen erst am Tag des Gerichts unterzogen.
Zwar gibt es auch Aussagen, die das Feuer in einen positiven Zusammenhang mit dem Heiligen Geist bringen (zum Beispiel: „seid brennend im Geist“), doch muss hier jeweils der Kontext und die Gesamtaussage der Heiligen Schrift beachtet werden. Denn die Elemente Wasser und Feuer werden sowohl für Reinigung oder Läuterung, als auch für das Gericht verwendet (Mt 4,12; 25,46; Eph 5,26; 1Petr 1,7).
Fragen / Aufgaben:
- Was waren die Schwerpunkte in der Predigt des Johannes? Nenne Details seiner Verkündigung, die dir besonders auffallen.
- Welche Bedeutung oder Auswirkung hat die Distanz der Taufgegend am Jordan zu Jerusalem für die Verkündigung des Johannes und die Annahme seiner Botschaft im Volk?
- Im biblischen Kontext werden Menschen gelegentlich mit fruchttragenden Bäumen vergliechen. Was meint Johannes mit der Aussage: „bringt der Buße würdige Früchte hervor“?
- Was bedeutet die Aussage: „Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken“?
- Was bedeutet die Aussage: „Der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft“? Und was ist mit der Taufe im Feuer gemeint?
- Welche Gruppen von Menschen kamen zu Johannes an den Jordan?
- Wie waren die Ergebnisse seiner Predigt? Wie reagierten die verschiedenen Gruppen im Volk auf seinen Ruf zur Umkehr?
- Was können wir für uns aus dem Leben und Dienst des Johannes lernen?
- Wie reagieren heute Menschen auf dein Zeugnis?
2.6 Die Taufe von Jesus im Jordan
(Bibeltexte: Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; Joh 1,29-34)
Als Jesus ungefähr (knapp) 30 Jahre alt ist (Lk 3,23), geht er von Galiläa nach Peräa an das Ostufer des Jordan, in die Nähe des Ortes Betanien, um sich dort von Johannes taufen zu lassen.
Dieses Betanien am Ostufer des Jordans, liegt gegenüber der Stadt Jericho, also in Peräa, dem Herrschaftsgebiet von Herodes Antipas. Schon bei der ersten Begegnung wird deutlich, dass Johannes der Täufer eine Ahnung vom Dienstauftrag seines Verwandten Jesus hatte, denn seine Aussage „Ich bedarf wohl, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir“, unterstreicht diese Vorahnung. Die Aussage des Täufers in Johannes 1,31 „Und ich kannte ihn nicht (…)“, macht deutlich, dass es auch bei Johannes ein stufenweises Erkennen von Jesus als den Messias gab – menschlich gesehen kannte er ihn wohl als weitläufiges Mitglied der Großfamilie mütterlicherseits. Es ist anzunehmen, dass Jesus und Johannes durch ihre Eltern einiges voneinander wussten. Hinzu kommt noch, dass Johannes der Täufer jeden Tag nach dem Messias Ausschau hielt. Als Johannes Jesus zu sich kommen sieht, ruft er aus: „Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt!“ Diese Erkenntnis offenbart ihm der Heilige Geist. So macht seine Aussage „Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden“, und du kommst zu mir?“ deutlich, dass Johannes gleich zu Beginn der Begegnung mehr in Jesus sieht, als nur einen herausragenden Verwandten. Er schlägt sofort vor, dass Jesus als der Höhere ihn als Geringeren taufe. Die Antwort von Jesus lautet: „Lass es jetzt (so sein); denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen.“

Abbildung 7 Eine der antiken christlichen Kirchen, welche in unmittelbarer Nähe am Ostufer des Jordan freigelegt wurde (Foto: 7. November 2014).
Im Zusammenhang mit der Taufe von Jesus werden fünf wichtige Aspekte deutlich:
- Jesus war knapp dreißig Jahre alt, als er sich im Jordan taufen ließ (so steht es in Lukas 3,23). Lukas beziffert das Alter von Jesus zu Beginn seines Dienstes mit ´ungefähr oder knapp dreißig Jahren´, Johannes der Täufer war sechs Monate älter (Lk 1,26). Er hat also seinen Dienst nach dem Befehl Gottes auch mit etwa dreißig Jahren begonnen. Dieses Alter entspricht der Anordnung Gottes für den Beginn der amtlichen Priesterdienste in Israel (4Mose 4,1-47). Dass Jesus von einem Priestersohn, der dazu noch von Gott autorisiert war, getauft wird, ist auffallend, aber auch angemessen. Auch Jesus (der wahre Hohepriester) beginnt seinen Dienst in einem von Gott für die Priester vorgeschriebenem Alter.
- Die angesprochene Taufstelle befand sich vermutlich etwa 8 ½ km nördlich vom Nordende des Toten Meeres bei Betanien (Joh 1,28; 3,26) am Ostufer des Jordan und liegt ungefähr 380 Meter unter dem Meeresspiegel. Die Taufe von Jesus im Jordan und die anschließende Bevollmächtigung zum Dienst durch den Vater und den Heiligen Geist, findet also nicht auf einer Höhe (Jerusalem, Tempelberg) statt, sondern an dem tiefsten Punkt unserer Erde. „Er erniedrigte sich selbst“, trifft somit auch hier bei den äußerlichen Umständen zu.
- Jesus ist im Wasser des Jordan voll untergetaucht worden. Sowohl Matthäus als auch Markus berichten, dass Jesus nach der Taufe aus dem Wasser heraufgestiegen sei. Das griechische Verb `βαπτίζω – baptizö ` bedeutet eintauchen, untertauchen, im Wasser begraben werden. Wir lesen zum Beispiel in 2Könige 5,14 „Da stieg er (Naemann) ab und tauchte unter (εβαπτίσατο – ebaptisato) im Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes geboten hatte.“ Der Begriff wird aber auch für rituelle Waschungen ohne untertauchen verwendet.
- Durch die Formulierung: „Es gebührt uns“ ordnet sich Jesus ganz dem Willen Gottes unter und stellt sich auf die gleiche Stufe mit sündigen Menschen. Für sich selbst hätte er die Taufe nicht benötigt, aber Jesus identifiziert sich mit seinen jüdischen Mitmenschen (denen unter dem Gesetz), aber darüber hinaus mit der gesamten Menschheit, allen gottfernen und herumirrenden Menschen, die einen Erlöser brauchen.
- Diese Wassertaufe zu Beginn seines öffentlichen Dienstes deutet symbolhaft auf seinen Tod und seine Auferstehung hin.
Wie auch in allen anderen Bereichen, ist Jesus damit für seine Nachfolger Vorbild und Beispiel.
Gottes Handeln ist überraschend anders! In der Regel sogar konträr zur Denkweise religiöser Menschen. Im Gegensatz zu den Schriftgelehrten, die die Taufe des Johannes für sich nicht nötig hielten (Lk 7,30), beugt und demütigt sich Jesus unter Gottes Forderungen, die eigentlich nur für uns sündige Menschen gelten. Schon hier wird seine Grundeinstellung und Bereitschaft deutlich. Er wählt den Weg
-
- der Erniedrigung,
- des Dienens und
- des Gehorsams.
Alle vier Evangelisten berichten von seiner Taufe und ergänzen dabei einander.
| Mt: | „Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf; und siehe, die Himmel wurden (ihm) aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herab fahren und auf ihn kommen.“ |
| Mk: | „Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herab fahren.“ |
| Lk: | „(…) und auch Jesus getauft worden war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt, wie eine Taube, auf ihn herabstieg (…).“ |
| Joh: | „Und Johannes bezeugte und sagte: Ich habe gesehen, wie der Geist herabkam vom Himmel wie eine Taube und er blieb auf ihm.“ |
Hier wird von einem einzigartigen Ereignis berichtet. Jesus steigt aus dem Wasser, betet und der Himmel öffnet sich. Das Ungewöhnliche geschieht: der Himmel teilt sich, oder spaltet sich. Die göttliche Sphäre wird für einen Augenblick geöffnet. Der Geist, Heilige Geist oder Geist Gottes kommt in leiblicher Gestalt, wie eine Taube auf Jesus herab und bleibt auf ihm. Zu beachten wäre hier, dass der Heilige Geist nicht in der Gestalt einer Taube, sondern „in leiblicher Gestalt, wie eine Taube“, auf Jesus herabkam.
Der Heilige Geist war auch schon vorher bei/in Jesus. Der Geist Gottes ist überall gegenwärtig. Die Verheißungen der Salbung des Messias mit dem Heiligen Geist ist schon von Ewigkeit her in Kraft, so zum Beispiel Jesaja 61,1f „Der Geist des Herrn ist auf mir“, oder Jesaja 42,1f „Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Heiden das Gericht verkündigen“.
Dieses, nur für Johannes sichtbare Herabkommen des Geistes auf Jesus, ist eine göttliche Bestätigung für den Gesalbten Gottes und markiert gleichzeitig den Beginn des vollmächtigen und auch öffentlichen Auftretens von Jesus.
Johannes der Täufer sagt:
Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: „Auf welchen du sehen wirst den Geist herab fahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. (Joh 1,32. 33; vgl. auch Joh 5,32-33).
Jes 63,19 [andere Zählweise 64,1] beschreibt schon früher den Wunsch, dass der Himmel zerrissen und Gott ‚herabfahren’ würde. An diesem Tag geschieht genau dies, begleitet von einer zumindest für Johannes dem Täufer sichtbar, als auch hörbaren Stimme: „Dieser ist mein geliebter Sohn an dem ich Wohlgefallen habe.“ (Joh 1,32; 5,37). Schon bei der Taufe von Jesus sprechen also zwei Zeugen: der vom Heiligen Geist geleitete Johannes und die Stimme vom Himmel. In den Augen der jüdischen Schriftgelehrten hatte es seit Maleachi keine von Gott gesandten Propheten mehr gegeben. Gott sprach nur noch durch eine Stimme vom Himmel. Hier wird deutlich, dass die Evangelisten für ihr jüdisches Umfeld beides in ein Paket schnüren: Johannes war der göttliche Prophet und Jesus der Sohn Gottes. Für eine Identitätsbestimmung genügen nach dem Gesetz zwei Zeugen. Das Zusammenwirken von Vater und Heiligem Geist bei der Taufe des Sohnes ist eine wesentliche Bestätigung und Stütze für die Wahrheit und Realität des dreieinigen Gottes. Gott – Vater, Sohn und Heilige Geist sind aktiv um die Erlösung für uns Menschen vorzubereiten.
Fragen / Aufgaben:
- Was fällt dir bei der Begegnung zwischen Johannes und Jesus auf?
- Erkläre den Begriff Taufe. Was ist der Unterschied zwischen der Taufe des Johannes und den späteren Taufen der Jünger von Jesus? Beschreibe den Vorgang und erkläre die Bedeutung der Taufe. Was war die Taufe von Jesus im Jordan im Gegensatz dazu?
- Was fällt dir bei Gottes Zeugnis über seinen Sohn auf?
Kann Jesus mit seiner Taufe uns heute für eine Entscheidung zur Gläubigen-Taufe ermutigen? Welche Bedeutung hat für dich deine Taufe?
2.7 Jesus siegt in den Versuchungen
(Bibeltexte: Mt 4,1-11; Mk 1,12+13; Lk 4,1-13)
2.7.1 Der Ort und die Zeit der Versuchungen
Alle drei synoptischen Evangelien berichten über die Versuchungen von Jesus in der Wüste. Der Evangelist Markus beginnt in seiner typischen Art mit: „sofort treibt ihn der Geist hinaus in die Wüste (…).“ (Mk 1,12). So als ob Jesus von jemandem oder etwas aufgehalten werden könnte. Und menschlich gesehen, hätte er nach solch einem eindrucksvollen Zeugnis durch Johannes recht bald viele Anhänger bekommen. Der Heilige Geist ist es, der ihn in die Wüste hinauf führt, drängt. Wüste meint unbewohnte Gegend. Er muß sich bestimmten Versuchungen von Seiten des Feindes Gottes stellen. Anscheinend steht dahinter ein göttlicher Gedanke, wie es später von ihm heißt: „Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde.“ (Hebr 4,15). Dies könnte die Antwort auf die `Warum-Frage` sein. Jesus blieb also nichts erspart. Der Versucher wird in den drei Evangelientexten unterschiedlich bezeichnet.
- `διάβολος – diabolos – Durcheinanderbringer` (Teufel – Mt 4,1; Lk 4,2). Der griechische Begriff beschreibt den Feind Gottes als einen der zerstört, trennt, zerstreut, Unordnung und Chaos anrichtet.
- `σατανά – satanas – Gegner` (Mk 1,13). Der hebräische Begriff dafür ist `שָׂטָן` und beschreibt den Feind Gottes der sich entgegen stellt oder auch anklagt.
Der Evangelist Matthäus beginnt mit den Worten: „Danach, darauf hin (…).“ (Mt 4,1). Hier geschieht also etwas, was in der Reihenfolge an nächster Stelle steht und Priorität hat. Auch bei dem Bericht des Evangelisten Lukas wird deutlich, dass die Versuchungen sich der Taufe am Jordan anschließen (Lk 4,1). Da Jesus sich jedoch nach dem Bericht des Johannesevangeliums noch einige Tage in der Nähe der Taufstelle aufhält, ist anzunehmen, dass er nach der Versuchung zunächst wieder an den Jordan zurückkehrt und nicht sofort nach Galiläa aufbricht.
Der Evangelist Matthäus schreibt: „Jesus wurde hinaufgeführt in die Wüste“ und der Evangelist Lukas formuliert ergänzend: „Jesus kehrte zurück vom Jordan und wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt.“ (Lk 4,1). Das könnte heißen, dass die Stelle der Versuchung in der Judäischen Wüste, also westlich des Jordan zu suchen ist. Traditionell wird angenommen, dass die Versuchungen Jesu westlich der Stadt Jericho auf einem der ansteigenden Bergen stattfand. Doch ist nicht ausgeschlossen, dass Jesus auf einen der unbewohnten Hügel (Berge) weiter südöstlich der Taufstelle geführt wurde, kehrte er doch nach den 40 Tagen wieder zur Taufstelle zurück (Joh 1,36ff). Übrigens liegt die Taufstelle knapp 380 Meter unter dem Meeresspiegel und daher ist ein „Sich entfernen“ vom Jordan besonders in Richtung Osten immer ein „Hinaufgehen“ wie der Evangelist Matthäus es formuliert (Mt 4,1). Im Westen dagegen zieht sich die etwa 8 Kilometer breite und langestreckte Jerichoebene hin.
Nach dem Bericht des Evangelisten Lukas markiert die Taufe (Lk 3,23a) den Beginn der öffentlichen Wirksamkeit von Jesus. Der Evangelist Matthäus schreibt: „Als Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, danach war er hungrig (…).“ Der Evangelist Markus notiert nur: „Er war in der Wüste 40 Tage.“ Aus der Formulierung bei Lukas entsteht der Eindruck, dass Jesus vierzig Tage lang versucht wurde. (Matthäus: „(…) nach vierzig Tagen wurde er versucht.“). Feststeht, dass er vierzig Tage und Nächte nichts aß, sich unter wilden Tieren des Feldes befand (Mk 1,13), und am Schluss der Versuchungen dienten ihm die Engel. „Und als vollendet waren vierzig Tage, hungerte ihn.“ (Lk 4,2b). Es wird deutlich, dass der Teufel erst mit seinen Versuchungen anfing, als der Hunger Jesus schon sehr plagte. Prüfungen stehen oft am Anfang, so bei Adam im Garten oder beim Volk Israel zu Beginn der Wüstenwanderung.

Abbildung 8 Im Vordergrund sind die Ausgrabungen von Alt-Jericho zu sehen, im Hintergrund die ansteigenden Berge der judäischen Wüste (Foto: April 1986).
Beide Prüfungen wurden nicht bestanden. Eine erste Prüfung ist also wichtig für alle Beteiligten. Besteht man sie, kann der Dienst weitergehen. Auffällig ist auch die Parallele von Jesus zu Mose, er war auch 40 Tage auf dem Berg Sinai (2Mose 34,28) ohne zu essen. Das griechische Wort `πειρασμός – peirasmos` weist auf einen Zeitraum der Prüfung oder Versuchung hin. .

Abbildung 9 Südöstlich von der Taufstelle bei Betanien, steigt die Landschaft an zum Gebirge Moab (Foto: 7. November 2014).
Gott prüft zum Positiven, zum Bestehen, zur Festigung, zur Bestätigung. Der Satan versucht zum Bösen, um zu Fall zu bringen, er fordert heraus aus böser Absicht. Alle drei Versuchungen haben die Überwindung der Versuchung einer falschen Messiashoffnung zum Gegenstand. Allen drei Versuchungen liegt zu Grunde – Jesus will in keiner Form als politischer Messias auftreten.
2.7.2 Die drei Versuchungsphasen
Die Evangelisten Matthäus und Lukas schildern uns den Versuchungshergang in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Beide nennen drei Versuchungspunkte.
| Matthäus | Lukas |
| 1. „Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden.“1a. „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, dass durch den Mund Gottes geht.“ (Mt 4,3-4). | 1. „Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass dieser Stein Brot werde.“ (Lk 4,3).1a. „Es steht geschrieben: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.“ (Lk 4,4). |
| 2. „Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinunter, denn es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): Er wird seinen Engeln befehlen über dich und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein anstößt.“ (Mt 4,5-6).2a. „Es steht geschrieben: Du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen.“ (Mt 4,7). | 2. „Diese ganze Machtfülle und ihre Herrlichkeit gebe ich dir, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie wem ich will. Wenn du also vor mir niederfällst und mich anbetest, soll alles dein sein.“ (Lk 4,6-7).2a. „Es steht geschrieben: Den Herrn deinen Gott sollst du anbeten und ihm allein sollst du dienen.“ (Lk 4,8). |
| 3. „Dies alles werde ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.“ (Mt 4,9).3a. „Geh weg von mir Satan, denn es steht geschrieben: Du sollst den Herrn deinen anbeten und ihm allein sollst du dienen.“ (Mt 4,10). | 3. „Wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich von hier hinunter, denn es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): Er wird seinen Engeln befehlen über dir, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf den Händen tragen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein anstößt.“ (Lk 4,9-11).3a. „Es ist gesagt: Du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen.“ (Lk 4,12). |
Anders als damals das jüdische Volk besteht Jesus alle Prüfungen, die ihm auferlegt werden. Manche Theologen haben den verbalen Schlagabtausch zwischen Jesus und dem Teufel mit einem rabbinischen Streitgespräch verglichen. „Personen, die sich schweren moralischen Prüfungen unterzogen und sie bestanden, wie Jesus hier, spielen auch im jüdischen Schriftgut eine wichtige Rolle“ (Keener 1998, 64).
Wir betrachten nun der Reihenfolge nach die drei Versuchungen und zwar, wie sie uns der Evangelist Matthäus aufgeschrieben hat.
Die 1. Versuchung
In barmherziger Art tritt der Versuchende (gr. ο πειράζων – o peirazön) zu dem vom langen Fasten geschwächten Jesus heran mit den Worten: „Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden.“ „Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde.“ (Mt 4,3; Lk 4,3). Wenn wir einsam, müde, erschöpft, leidend oder gerade eine gute, großartige geistliche Erfahrung gemacht haben, dann ist Satan zur Stelle! Wie und woran erkannte Jesus den Satan? Kann dieser, für Menschen akustisch hörbar, reden? Er benutzte hier wohl kaum ein Geschöpf aus der Tierwelt, hätte er sich damit sofort selber enttarnt. Oder trat er als ein Engel des Lichts – in scheinheiliger, blendender Gestalt vor Jesus? Das ist eher der Fall, denn so schreibt der Apostel Paulus später an die Korinther: „Und das ist auch kein Wunder; denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts.“ (2Kor 11,14).
Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann brauchst du nicht zu hungern. Mach dich selbstständig, unabhängig vom Vater! Jesus könnte als Gottessohn ohne Schwierigkeit das Hungerproblem für sich und die ganze Welt lösen! An dieser Stelle war Adam und das Volk Israel gescheitert. Die folgende Antwort gibt Jesus aus 5Mose 8,3: „Der Mensch lebt nicht allein vom Brot.“ Der Sinn dieses Zitates ist folgender: Gott hatte dem Volk Israel durch das Manna gezeigt, dass sie in ihrer Ernährung völlig von Gottes Segen abhängig waren.
„Viele Juden hofften auf einen neuen Exodus unter der Führung eines neuen Mose – einschließlich Manna, dem Brot vom Himmel. Der Teufel will Jesus dazu verleiten, den Erwartungen seiner Zeitgenossen nachzukommen (Keener 1998, 65). Jesus sagt also: Ich brauche nicht einfach Brot, sondern Brot von meinem Vater. Der Teufel versucht außerdem die Gottessohnschaft von Jesus an bestimmte Bedingungen festzumachen und Jesus zu einer Beweisführung anzustacheln“ (Keener 1998, 65).
Wir sehen und erkennen Folgendes:
- Für Jesus war es eine Sünde in irgendeinem Punkt nicht vom Vater im Himmel abhängig zu sein
- Jesus der Sohn Gottes kämpft nicht mit eigenen wohl durchdachten Worten; er nutzt das Wort Gottes; er zitierte aus dem Gesetz.
Auch heute noch ist der Hunger in der Welt schrecklich, aber dennoch ist dies nicht das vorrangigste Problem. Die tiefere Ursache liegt in der Tatsache verborgen, dass sich der Mensch von Gott und seinem Wort löste.
Jesus sagt, dass der Mensch niemals Leben in materiellen Dingen finden wird. Die wirkliche Aufgabe des Glaubens ist es als neue Menschen zu leben – anders zu leben – z.B. als Wohltäter für meinen Nächsten! Gott will mit neuen Menschen neue Verhältnisse schaffen! Nicht umgekehrt.
Die 2. Versuchung
Bei der zweiten Versuchung sieht sich Jesus auf den zahnartigen Mauerabschluss des Tempels (Zinne des Tempels) gesetzt – der Teufel führte ihn dorthin, wahrscheinlich im Geist (nicht im Körper). Der Herodianische Tempel hatte eine Gesamthöhe von etwa 45 Metern. Der Teufel fordert Jesus heraus sich hinabzuwerfen, stellt sich dabei ganz fromm und greift selber zum Alten Testament und zitiert aus dem großen Glaubenspsalm: „Denn er bietet seine Engel für dich auf, [dich zu bewahren auf allen deinen Wegen]. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.“ (Ps 91,11-12). Beachten wir, dass der in Klammern gesetzte Satz von ihm ausgelassen wird. Der Teufel versucht in dieser Versuchung Jesus zur:
- Übersteigerung oder Überspitzung des Glaubens anzureizen,
- um eine Verheißung Gottes, die für besondere Notlagen seiner Kinder gegeben wurde, zu Missbrauchen,
- und er versucht Jesus, eine Verheißung in Anspruch zu nehmen, welche er aus dem Kontext reißt und sie bewusst unvollständig zitiert.
Er lässt den Satz: „dich zu bewahren auf allen deinen Wegen“ einfach aus. Er löst das Bibelwort aus dem Zusammenhang heraus. Wo steht denn, dass Gott seine Kinder auf all ihren Luftsprüngen behüten will? Gottes Schutz gilt besonders für Situationen, in die seine Kinder unverschuldet hinein geraten. Schriftworte und ihre aus dem Zusammenhang gerissene Auslegungen können auch für Gläubige zur Versuchung werden. Jede Lehre muss auf 2 oder 3 klaren Bibelstellen ruhen, nicht auf einer einzigen, die dann noch einseitig ausgelegt wird.
Satan will Jesus locken Gott zu versuchen. Gott soll herausgefordert und zum Eingreifen gezwungen werden. Damit wäre Gottes Heiligkeit und Majestät entehrt. Gott würde „frech herausgefordert“ werden, wie man das griechische Wort `έκπειράσεις – ekpeiraseis` hier auch übersetzen kann. Das ist Gotteslästerung. Wir dürfen Gott jede Hilfe zutrauen, aber nie eine einzige Hilfe ihm vorschreiben. Dies ist kein Glaube, sondern falsches Vertrauen – geistliche Überhebung. Darum antwortet Jesus schlicht aus 5Mose 6,16 „Du sollst den Herrn Deinen Gott nicht versuchen.“ Die Antwort von Jesus ist ein klarer rückschlag für den Versucher, doch er gibt noch nicht auf.
Die 3. Versuchung
Lukas.4,5-8 (lesen)
Der Teufel führt Jesus auf einen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit in einem Augenblick- wahrscheinlich in einer Vision – und spricht: „Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben; denn mir ist sie übergeben, und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein.“ (Lk 4,6. 7; Mt 4,9).
Der Teufel spielt sich als unumschränkter Besitzer und Herrscher der Welt auf und spricht damit eine Lüge aus, denn: „Die Erde ist des Herrn und alles, was darinnen ist (…).“ (5Mose 10,14; Ps 24,1-2). Noch mehr, indem er von Jesus Anbetung fordert, spielt er sich als Gott auf – eine nicht zu überbietende Frechheit. Weil Adam und Eva auf ihn hörten und seinem Rat gehorchten, bekam er große Macht und Einfluss über die Menschen. Er raubte mit List und Lüge, was ihm nicht gehörte und niemals übergeben wurde. Natürlich kann er den Menschen, den er begünstigt, auf die höchste Stufe irdischer Macht erheben. Dies geschieht immer wieder wenn Menschen sich unter seinen Einfluß stellen. Doch auch dies geschieht nur unter der Zulassung Gottes, bzw. Gott lässt sie gewähren. Der Christ weiß, wie stark der „altböse Feind“ ist. Aber trotzdem weiß der Glaube, dass in allem, was ihm begegnet, er nicht mit zwei Herren – also Gott und Satan – zu rechnen hat, sondern nur mit dem einen Herrn ganz allein (Dan 4,32). So hat es auch der Herr Jesus in der 3. Versuchung gehalten. Er hat ganz allein mit Gott, Seinem Vater gerechnet.
Die Versuchung besteht hauptsächlich darin, in Jesus das Verlangen zu wecken, die Krone ohne das Kreuz zu erwerben. Ist dies nicht auch die Versuchung des Teufels heute? Die Krone diesseitigen Lebens – Glück, Erfolg, Gesundheit, Ansehen, Wohlergehen und Luxus zu erhalten, ohne einen Preis dafür bereit sein zu zahlen? Gott wollte, dass sein Sohn den Weg des Kreuzes geht, um dann von ihm die Krone verliehen zu bekommen. Auch für Jesusnachfolger gibt es Leid, Probleme und Verfolgung! Können wir solche Verse noch recht hören: „Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird’s verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird’s finden.“ (Mt 10,38).
Satan will Jesus überreden einen Kompromiss zu schließen. Satan meint doch mit unseren Worten: „Ich habe die Menschen in meiner Gewalt. Setz deine Maßstäbe nicht so hoch an. Lass uns einen Handel miteinander abschließen. Mach dem Bösen nur ein kleines Zugeständnis, dann werden die Menschen dir folgen.“ Doch Jesus lässt sich darauf nicht ein. Er weiß: Gott bleibt Gott und darum bleibt Recht Recht und Unrecht Unrecht. Im Kampf mit dem Bösen darf es keinen Kompromiss geben.
Die Antwort von Jesus ist beeindruckend. Mit aller Entschlossenheit seiner Willenskraft, mit der Klarheit und Kraftfülle des Wortes Gottes tritt er dem Feind entgegen. „Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen.“ (5Mose 6,13). Mit allem was Jesus hat und was er ist, will er genau dies in seinem Erdenleben tun:
- Gott anbeten
- und die eigene Wellness-Sehnsucht hinter sich zu lassen – bis hinauf nach Golgatha.
Der Evangelist Lukas schließt die Versuchungen mit den Worten ab: „Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, verließ er ihn für eine Zeit (genauer: bis zu einer gelegenen Zeit; hier kann auch übersetzt werden: bis zu einer passenden Gelegenheit). Das hier verwendete griechische Wort für Zeit ist `καιρός – kairos` und hat die Bedeutung von „qualitativer Inhalt der Zeit, eine Zeitlang, bis zu einer passenden Gelegenheit“. Bis der Teufel wieder einen Angriffspunkt findet oder Gott es zulässt.
Der Evangelist Markus hebt noch hervor, dass Jesus von Engeln umgeben wird, die ihm nach der schweren Prüfungszeit zu Diensten stehen. „Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm.“ (Mt 4,11). Dieser Dienst der Engel kann vielseitig ausgesehen haben. Möglich ist, dass sie ihn mit Nahrung versorgen, denn Dienst hat sehr oft mit Tischdienst, also mit Essen und Mahlzeiten zu tun (vgl. dazu 1Kön 19,5).
Fragen / Aufgaben:
- Lies die Paralleltexte in den Evangelien und ordne die Versuchung zeitlich in das Leben von Jesus ein. Beschreibe das geographische Umfeld, also wo fand die Versuchung statt?
- Nenne die Unterschiede und/oder die Ergänzungen in den Evangelientexten.
- Was ist das Besondere an der Versuchung von Jesus und gibt es Zusammenhänge zum Alten Testament?
- Wie widersteht Jesus dem Teufel in den einzelnen Versuchungsphasen?
- Welche Versuchung ist dir besonders verständlich? Ist es normal für Jesusnachfolger, dass sie versucht werden?
- Welche Kosten sind Jünger von Jesus bereit zu tragen?
2.8 Jesus kehrt zurück an den Jordan
(Bibeltext: Joh 1,15.29-34)
2.8.1 Das erneute Zeugnis des Johannes über Jesus
Der Evangelist Johannes verfolgt nicht immer eine chronologische Darstellung der Ereignisse.
- In Johannes 1,15 lesen wir das Zeugnis des Täufers über Jesus. Diese Aussagen formuliert Johannes nach der Taufe. Dort lesen wir: „Johannes zeugt von ihm und hat gerufen, sagend: Dieser war es, den ich mit meiner Rede gemeint habe; Der nach mir Kommende, er hat Vorrang vor mir und war eher als ich.“ (Joh 1,15).
- Ab Johannes 1,19 spricht Johannes der Täufer zu den Abgesandten von Jerusalem, was wohl eher vor der Taufe von Jesus geschehen sein musste.
Der Textabschnitt in Johannes 1,29-34 kann als Ergänzung zum Taufbericht der Synoptiker gesehen werden. Denn das Zeugnis Johannes des Täufers über Jesus wurde wohl erst im Anschluss an die Taufe von Jesus gegeben. Der Evangelist Johannes geht an dieser Stelle davon aus, dass seine Leser den vollständigeren Bericht über die Taufe von Jesus aus den anderen Evangelien kennen. Jedenfalls beschreibt er den Taufvorgang selbst nicht. Die synoptischen Evangelien beschreiben die Rückkehr von Jesus nach Galiläa direkt nach der Versuchung. Da wir aber wissen, dass die drei Evangelisten nicht alle Details aus dem Leben von Jesus festgehalten haben, obwohl sie sich an einigen Stellen ergänzen, nehmen wir an, dass Jesus mindestens zweimal am Jordan bei Johannes dem Täufer war – zu seiner Taufe und direkt nach den Versuchungen.

Abbildung 10 Die ganze Gegend im Bereich von Betanien am Ostufer des Jordan ist historisch reich an Ereignissen aus biblischen Zeiten. Das Volk Israel lagerte hier, bevor es den Jordan überquerte. Elia der Prophet wurde in dieser Gegend gen Himmel aufgenommen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Johannes der Täufer und auch Jesus gerne diese Gegend aufsuchten oder sich hier aufhielten (Foto: 7. November 2014).
Nur im Johannesevangelium lesen wir von den ersten fünf Jesusjüngern. Sie werden ihre Begegnung mit Jesus nicht vor, sondern erst nach den Versuchungen von Jesus, erlebt haben. Am Jordan hören die Zuhörer dieses wiederholte Zeugnis von Johannes dem Täufer in Bezug auf Jesus. Der Evangelist Johannes hält dies nur in der Kurzform fest (Joh 1,36). Johannes der Täufer bezeugt im Laufe seines Dienstes einige Male Jesus in der Öffentlichkeit als gekommen und damit seine Prophezeiung als erfüllt.
So erscheint uns folgende Reihenfolge der Ereignisse schlüssig zu sein:
- Ankündigung des Messias durch Johannes den Täufer,
- Die Taufe von Jesus im Jordan,
- Die Bestätigung und Bevollmächtigung von Jesus durch den Heiligen Geist,
- Das Zeugnis des Vaters über seinen Sohn,
- Die anschließende Versuchung von Jesus in der Wüste,
- Die Rückkehr von Jesus an die Taufstelle,
- Das erneute Zeugnis des Täufers über Jesus,
- Einige Jünger des Johannes wechseln zu Jesus.
2.8.2 Die ersten Jünger von Jesus
(Bibeltext: Joh 1,35-51)
Nur der Evangelist Johannes beschreibt die Begegnung von Jesus mit den ersten fünf Jüngern. So lesen wir in Johannes 1,35-40:
Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger; und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm! Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi – das heißt übersetzt: Meister –, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht! Sie kamen und sahen’s und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Einer von den zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus.
Nach dem erneuten Zeugnis und Hinweis des Täufers auf Jesus, wechseln zwei seiner Jünger ihren Rabbi und folgen ab jetzt Jesus nach. Folgen meint im jüdischen Kontext: vom Lehrer den Weg des Lebens lernen. Dies tun Andreas und ein namentlich nicht genannter. Es handelt sich sehr wahrscheinlich um Johannes den spääteren Evangelisten. Der Name Andreas kommt aus der griechischen Kultur und bedeutet soviel wie `Tapferkeit, Mannhaftigkeit`. Diese zwei Jünger 0fragen nach der Unterkunft von Jesus und drücken so den Wunsch nach einer Einladung zu einem ungestörten längeren Gespräch aus. Jesus geht darauf gerne ein.
Die Zeitangabe „am folgenden Tag“ ist beim Evangelisten Johannes nicht immer einfach einzuordnen, da der Bezugspunkt auch ein nicht berichtetes Ereignis sein kann. Im Fall von Johannes 1,29: „Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt“, könnte sich diese Angabe jedoch auf den Tauftag von Jesus beziehen. Ebenso in Johannes 1,43: „Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen (…)“, kann sich diese Zeitangabe nahtlos auf den nächsten Tag beziehen.
Die zehnte Stunde in Johammes 1,39 war damals schon unklar. Es gab die hebräische Zählweise (6 Uhr morgens plus 10 Stunden = 16.00h) und die römische Zählweise (unsere heutige = 10.00h vormittags). Vergleicht man Johannes 19,14: „Es war aber der Rüsttag für das Passafest, um die sechste Stunde (…)“, mit Markus 15,25: „Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten (…)“, ist es wahrscheinlich, dass der Evangelist Johannes die Zeitangabe mit Mitternacht und Mittag als Bezugspunkt vorzieht, während der Evangelist Markus die Zeitangabe mit dem Sonnenaufgang als Bezugspunkt vorzieht.
Die Bemerkung in Johannes 1,39a: „Sie kamen und sahen’s und blieben diesen Tag bei ihm“, spricht eher für 10h am Vormittag, also römische Zählweise. Diese Zeitangabe vermittelt den Eindruck, der Evangelist Johannes sei ein Augenzeuge dieses Ereignisses, da er den genauen Zeitpunkt der Jesusbegegnung für erwähnenswert hält. Noch Jahre später konnte der Evangelist die Details vor seinem inneren Auge sehen.
„Im Johannesevangelium fällt auf, dass der Evangelist seinen Lesern aramäische Begriffe erklärt, so zum Beispiel: Rabbi Lehrer/Meister (Joh 1,38), oder Messias Christus/Gesalbter (Joh 1,41), oder Kephas Petros: Fels/Stein (Joh 1,42). „Jesus trug den aramäischen Titel ραββί Rabbi bis zu seiner Auferstehung. Danach wird er vollständig von dem auch vorher schon gebräuchlichen Titel κύριε kurie (HERR) verdrängt.“ (Hendriksen 1976a, 103).
Dies macht deutlich, dass der Evangelist es für notwendig hält seiner griechisch sprechenden Leserschaft – die schon deutlich einem anderen Kulturkreis angehört – diese Begriffe direkt im Text zu übersetzen.
Bald macht Andreas seinen Bruder Simon mit Jesus bekannt. Er nutzt dazu die sensationellen Worte: „Wir haben den Messias gefunden!“ Simon drängt sofort zu einer Begegnung mit Jesus. Jesus gibt Simon bei dieser ersten Begegnung den hebräischen Beinamen Kephas. Kephas – aramäisch Stein (Joh.1,42). Sein Vater hieß Johannes (Joh. 1,42; 21,15-17). Der Evangelist Johannes übersetzt das aramäische Kephas ins griechische: πέτρος – petros.
Am Tag darauf findet Jesus Philippus und „spricht zu ihm: Folge mir nach!“ (Joh 1,43b). Es ist die erste ausdrückliche Berufung eines Jüngers, die Jesus selbst ausspricht. Der Name griechische Name `Φιλιππος – Philippos` bedeutet `Pferdefreund`und er kommt „aus Betsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus.“ (Joh 1,44a). Der Evangelist Johannes legt nicht nur viel Wert auf die Inhalte der Lehren von Jesus, sondern macht Angaben zu Zeiten, Orten und Bedeutung von Namen und Begriffen. Diese Details unterstreichen zusätzlich die Historizität seiner Berichte.
Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn, aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen! Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh! Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel! Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf- und herabfahren über dem Menschensohn. (Joh 1,45-51).
Philippus findet Nathanael aus dem galiläischen Kana und lädt ihn zu Jesus ein. Wir können annehmen, dass dies der selbe Jünger ist, der in den anderen synoptischen Evangelien Bartholomäus (Bar Tholmai – Sohn des Tholmai) genannt wird, da er dort immer gleich nach Philippus kommt, obwohl dort nie der Name Nathanael erwähnt wird. Nathanael (sein hebräischer Name bedeutet: Gott hat gegeben) ruht sich unter einem Feigenbaum aus. Es erinnert uns an eine Bildrede aus dem Alten Testament, die von Ruhe und Sicherheit spricht (1Kön 5,5; Micha 4,4). Von Philippus hört er am Anfang des Satzes den Hinweis auf den Messias: „von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben“.
Denkt Philippuns an 5Mose 18,15 und 2Samuel 7,11-16? Am Ende des Satzes aber nennt Philippus arglos den Ortsnamen Nazaret. Bei dieser Bemerkung wird Nathanael skeptisch: „Was kann aus Nazareth Gutes kommen“. Die Bewohner von Galiläa kannten einander recht gut, war doch das Gebiet recht überschaubar. Das Galiläische Kana und Nazaret lagen Luftlinie in Nord- Südrichtung nur 16 Kilometer voneinander entfernt.
- Ob aus einer regionalen Rivalität heraus, die zwischen den kleineren Städten Kana und Nazaret geherrscht haben mag,
- oder ob den Nazarenern ein schlechter Ruf anhing,
- oder ob aus seiner Kenntnis, dass dieser Ort nie im Zusammenhang mit einem messianischen Ereignis genannt wurde,
äußert Nathanael ganz unbekümmert seine offene Ablehnung. Doch wieder ist die einzig passende Antwort seines Freundes: „Komm und sieh!“ Und Philippuns führte ihn zu Jesus.
„Mit jedem Schritt, den sich Nathanael Jesus näherte, zerbrechen seine – und auch unsere – Zweifel und Argumente gegen Jesus mehr und mehr.“ (Edersheim 1979, 350).
Das Zeugnis, welches Jesus Nathanael ausstellt „Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist“, ist (wie wir später Jesus kennen lernen werden) keine Schmeichelei, um Anhänger zu gewinnen. Jesus sieht in das Herz des Nathanael, nicht nur, wo er sich körperlich aufhält. Nathanael ist von dieser Gottesoffenbarung so überwältigt, dass er mit überzeugung ausruft: „Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel!“ (Joh 1,49).
Jesus nimmt bei dieser Begegnung mit Nathanael Bezug auf das Erleben Jakobs auf der Flucht, wie in Johannes 1,51 deutlich wird, als er auf den nächtlichen Traum Jakobs anspielt (1Mose 28,12). Ob Nathanael darüber im Schatten des Feigenbaumes nachsann? Auf jeden Fall spricht Jesus Nathanael bewusst im Gegensatz zu Jakob (den Lügner) als einen „Israelit in dem kein Trug ist“ an. Nathanael erkennt, dass Jesus seine Gedanken kennt, bevor sie miteinander reden. So bricht sich im Zweifler oder Skeptiker eine wunderbare Christuserkenntnis Bahn.
- Gottes Sohn (2Sam 7,14a),
- König von Israel (2Sam 7,12-16).
Schon am Jordan folgen Jesus fünf Jünger, allerdings ist diese Nachfolge noch offen, da die eigentliche Berufung der Meisten noch nicht ausgesprochen war. Lukas berichtet in Apostelgeschichte 1,21-23 von dem Kriterium zur Nachwahl in den Apostelkreis nach dem Ausscheiden des Judas Iskariot.
Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweg aufgenommen wurde – von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. (Apg 1,21-23).
Der Evangelist Lukas gibt uns also den Hinweis, dass neben den späteren Jüngern von Jesus weitere Personen schon seit der Johannestaufe zum Kreis der Jesusnachfolger gehörten. Aus dieser Perspektive ist es verständlicher, dass bei der späteren Berufung – die eben nicht aus heiterem Himmel heraus geschieht – alle sofort bereit sind ihre aufgebaute Existenz zu verlassen und Jesus nachzufolgen. Sie waren schon von Anfang an dabei und vorbereitet zur Nachfolge.

Abbildung 11 Die vor uns liegende Landschaft hieß in alttestamentlicher Zeit `Schittim` oder auch `Jordantal der Moabiter`, wo das Volk Israel lagerte, bevor es über den Jordan ging um das Land Kanaan einzunehmen (Foto: April 1986).
Am folgenden Tag will Jesus nach Galiläa zurückkehren. Wir bemerken, dass der Evangelist uns schon für diesen sehr frühen Dienstabschnitt mitteilen will, dass das Leben von Jesus sehr planvoll verlaufen ist. Weiter scheint es so, dass ihn die neuen Jünger auf dem Weg nach Galiläa begleiteten. Eine relativ kleine Gruppe von Menschen, mit denen Jesus den Jordan überquert und sich anschickt das Reich Gottes aufzurichten. Die Parallele ist zu auffällig, als dass sie übersehen werden könnte. Das Volk Israel lagerte hier am Ostufer des Jordan etwa zwei Monate lang, bevor es unter der Führung des Josua den Jordan überquerte, um das ihnen von Gott versprochene Land einzunehmen. Jetzt ist es der von Gott gesandte und durch den Heiligen Geist bevollmächtigte Jeschua, der sich aufmacht die verlorenen Schafe aus dem Hause Israel zu sammeln (Mt 10,6). So kommt Jesus mit einer kleinen Mannschaft zunächst zurück nach Nazaret. Er verlässt seinen natürlichen Wohnsitz und zieht nach Kapernaum hinab, um dort mit der Verkündigung der Frohen Botschaft vom Reich Gottes zu beginnen (Mt 4,17).
Fragen / Aufgaben:
- Was bedeutet die Aussage des Johannes: „Siehe, das ist Gottes Lamm“?
- Warum ist es gut bei der Bekehrung und bei der Taufe einen Zeugen zu haben?
- Wie viele Jünger sind es am Jordan, nenne sie alle mit Namen. Wenn möglich nenne die Bedeutung der Namen. Welcher ist dir sympathisch? Warum?
- Worin bestand der Andreas-Dienst? Wie können wir ihn heute ausüben?
- Was meinst du, wie ging Johannes der Täufer mit der Situation um, dass ihn einige Jünger verließen und Jesus nachfolgten? Immerhin war es für einen jüdischen Rabbi sehr ungewöhnlich, seine Nachfolger auf einen anderen Lehrer zu verweisen.
- Was fällt bei der Begegnung von Jesus mit Nathanael auf? Was möchte Jesus ihm verdeutlichen?
- Kannst du die Parallelen zwischen der natürlichen Landnahme unter Josua und der geistlichen Landnahme unter Jesus erkennen?
Veröffentlicht unter UNTERWEGS MIT JESUS
Verschlagwortet mit Ein Zwölfjähriger, Jesus im Tempel, Pubertät
Kommentare deaktiviert für 2. Kapitel: Vorbereitung zum Dienst
UNTERWEGS MIT JESUS
Jesus, wohin gehst du?
„Ich muss wandern heute und morgen und am dritten Tag werde ich vollendet.“
Kapitel 1 : Die Geburt und Kindheit von Jesu

Abbildung 1 Kapernaum am Nordufer des Sees von Genezaret. Von dem Ausgrabungsgelände ist wegen dem vielen Grün nicht viel zu sehen, dafür aber sticht die, östlich der alten Hafenstadt gelegene, griechisch-orthodoxe Kirche mit ihrer roten Kuppel deutlich hervor (Foto: Juli 1994).

Abbildung 2 Das Nordost- und Ostufer des Sees von Genezaret. Der dichte Baumbestand markiert den Verlauf des Jordan unmittelbar vor seiner Mündung in den See. Im Osten des Sees steigt das Gelände steil aufwärts zum Gebiet der ehemaligen Dekapolis (heute Golanhöhen) (Foto: Juli 1994).
Eine Bibelstudienreihe über das Leben und den Dienst von Jesus Christus für Hauskreise von Paul Schüle und Hans-Ulrich Linke
Vorwort
Die vorliegende Bibelstudienreihe zum Leben und dem Dienst von Jesus Christus für Hauskreise von Paul Schüle und Hans-Ulrich Linke ist in 12 Kapitel unterteilt. Damit der Leser schnell zu den gewünschten Stellen findet, sind die Kapitel in Haupt- und Unterabschnitte aufgeteilt. Die Fragen bzw. Aufgaben am Ende von jedem Abschnitt sind eine Hilfe zur Vertiefung der Themen und regen zum Eigenstudium an. Die Zeichnungen sind signiert, die Fotos von den Urhebern genehmigt, bei weiterer Verwendung nur mit Quellenangabe bzw. Angabe der Webseite. Da die vorliegende Arbeit noch nicht abgeschlossen ist, werden die einzelnen Kapitel nach und nach hochgeladen und veröffentlicht.
Einleitung
Paul Schüle, Pforzheim, und Hans-Ulrich Linke, Biebesheim, stehen im Gespräch über manche Details des folgenden Textes. Oft erstellte Paul eine Vorlage, die dann bearbeitet wurde.
Die Bibelzitate sind direkt übersetzt oder stammen aus der Elberfelder Übersetzung (1985/1991), Lutherübersetzung (1984/85 und 2017) oder anderen am Ort genannten Bibelübersetzungen.
Die Bibelzitate (fett und kursiv) sind im Text bewusst eingefügt worden, um die Heilige Schrift selbst sprechen zu lassen.
Diese Ausarbeitung wurde geschrieben, da sich die beiden Autoren an der Debatte über die Bedeutung des historischen Jesus für unsere Theologie heute beteiligen wollen. Unser Projekt besteht darin, dass Leben und Werk unseres Herrn und Erlösers Jesus geordnet – wenn möglich – chronologisch wiederzugeben. Dabei gehen wir von der kanonischen Form der Heiligen Schrift aus und nehmen die vier Evangelien in gleichberechtigter Weise zur Grundlage. Während die synoptischen Evangelien vom irdischen Jesus geprägt einen Bericht geben, ist das Evangelium nach Johannes stark vom himmlischen Jesus her geprägt. Alle vier Berichte jedoch gehen nach unserer Erkenntnis als Bekenntnistexte auf Augenzeugen zurück. Ein gebräuchliches Wort für Augenzeugen, „Beobachter“, ist in der griechischen Literatur `έπόπται – epoptai`. Es wird in 2Petr 1,16 benutzt (Thiede 2006, 60). Diese sind wahrscheinlich in der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts verfasst worden und sind von der frühen Kirche gemeinsam in den Kanon aufgenommen worden. Carsten Peter Thiede merkt an: „Kenner der antiken Literatur und vor allem der Geschichte bevorzugen inzwischen frühe Datierungen, nämlich vor der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus.“ (Thiede 2006, 50)
Uns ist bewusst, dass es nicht „die Biographie” von Jesus geben kann, da Geschichte immer nur interpretierte Geschichte ist. Die Evangelisten hatten den Freiraum aus den ihnen vorliegenden Informationen bestimmte Aspekte hervorzuheben oder andere wegzulassen. Die so entstandenen unterschiedlichen Darstellungen bestärken unser Vertrauen in die Historizität dieser Berichte. Bei dieser Interpretation helfen uns in besonderer Weise Prophetien und Verheißungen des Alten Testaments und die daraus abgeleiteten jüdischen Endzeiterwartungen.
Zu beachten ist dabei die zweifache Art der jüdischen Textüberlieferung. Die strikte Textüberlieferung finden wir bei der Textüberlieferung für den Gottesdienstgebrauch, Studium und bei der Arbeit des Abschreibens. Wir kennen aber auch die freiere Textüberlieferung, wie wir sie in den Lehrschriften (Haggada der Midraschim) und in den Übersetzungen (Targumim) finden. Die freiere Überlieferung lässt Raum für die theologische Arbeit der Evangelisten in Bezug auf Anordnung und Gestaltung des Rahmens. Die Harmonisierung der Evangelien ist an vielen Stellen nicht möglich, da dies auch nicht das Ziel der Autoren und der frühen Gemeinden war. Darum sehen wir dies auch nicht als unseren Auftrag an. Bei der Einarbeitung der Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung interessieren uns besonders die literarischen Hinweise aus dem 1. Jahrhundert vor und nach der Geburt von Jesus, sowie die kulturellen Hinweise aus dieser Zeit. Uns ist dabei bewusst, dass die Evangelien für Gemeindeglieder verfasst wurden, die schon reichlich durch mündliche Berichte informiert waren. Doch genau diese mündliche – oft apostolische – Tradition als Hintergrundinformation (siehe Apg 10,36-43) fehlt uns heute. Im Vordergrund stehen das Kennen lernen der biblischen Informationen und eine vergleichende Bestandsaufnahme der vom Heiligen Geist inspirierten vier Evangelien. Diese sind jedoch Gelegenheitsschriften an jeweils eine besondere Zielgruppe. Wir sind uns dabei bewusst, dass auch das Lesen der Evangelien eine soziale Angelegenheit ist: Wir wollen uns immer wieder fragen: Wie dachte, empfand und handelte man damals im 1. Jahrhundert in Israel und wie wir Mitteleuropäer im 21. Jahrhundert. Die Unterschiede sind wesentlich zum Verständnis der Texte. Dazu konsultieren wir literarische und kulturelle Quellen, deren Ursprung sich mit diesem Raum und dieser Zeit verbinden lassen. Uns interessieren dabei insbesondere die vielen Details im Verhältnis des Juden Jesus zu seinen Zeitgenossen – ohne gleich die späteren theologischen Streitfragen der frühen Kirchengeschichte zu reflektieren. Jesus wurde schließlich von seinen gelehrten jüdischen Zeitgenossen weder als ein alles überragender Prophet noch als ein geachteter Schriftgelehrter betrachtet. Wir sehen unseren Schwerpunkt in der Darlegung seines Verhaltens (liebt die Gesellschaft mit „Sündern“) und seiner Taten (Heilungen) und schließen von dort auf seine Reden. Wir wollen also im Auge behalten: Wo erkennen wir Jesus als einen Juden in Harmonie mit seinen Zeitgenossen und wo war Jesus ganz anders, sodass er eine Bewegung gründete, die schließlich mit dem traditionellem Judentum brach.
Die Gliederung lässt sich von geographischen und folgenden chronologischen Gesichtspunkten leiten. Jesus war wie jeder gesetzestreue Jude verpflichtet, dreimal im Jahr zu den drei großen Festen nach Jerusalem zu reisen (2Mose 34,23-24). Besonders im Johannesevangelium finden wir einige Hinweise zu seinen regelmäßigen Jerusalembesuchen (Joh 2; 5; (6); 7; 12). So ist er mindestens einmal im Jahr nach Jerusalem zum Passahfest (Lk 2,41) hinaufgegangen. Daher ist es sinnvoll, seinen Dienst während seiner über drei Jahre dauernden Wirksamkeit nach seinen Aufenthalten anlässlich der Passahfeste in Jerusalem zu gliedern. Die erarbeitete Reihenfolge verstehen wir als einen möglichen Vorschlag, wobei wir manche Schwächen erkennen. Diese Arbeit ist ein gemeinsames Werk aller Beteiligten der Studiengruppen in Pforzheim und Biebesheim, da Anregungen fortlaufend einfließen. Das erarbeitete Material richtet sich darum an Studiengruppen und Hauskreise.

Abbildung 3 Der See Genezaret – auch See von Tiberias – und Galiläisches Meer genannt. Das Wirken von Jesus erstreckte sich auf das gesamte umliegende Land und sogar auf den See. In seiner Länge von etwa 22 km und Breite von etwa 12 km liegt er mehr als 200 Meter unter dem NN. Dieser fischreiche Süßwassersee bildet eine einzigartige Landschaft. Der Blick von Gadara (heute: Umm Qais) reicht bis zum Libanongebirge im Norden. Links des Sees erstreckt sich Galiläa und rechts das Gebiet der biblischen Dekapolis (heute Golanhöhen) (Foto: 3. November 2014).
1.2 Jesus Christus – sein göttlicher Ursprung
(Bibeltexte: Mt 1,18-25; Lk 1,26-38; Joh 1,1-18)
Nach dem Betrachten der `menschlichen` Abstammung von Jesus Christus machen wir uns auf die Suche nach Textaussagen über seinen göttlichen Ursprung. Dieser ist besonders in seiner Menschwerdung sowie in seinem besonderen Dienst durch Wort und Tat zu erkennen.
Schon der Prophet Micha sagt über den Ursprung des Messias folgendes:
Und du Bethlehem Efrata, das du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. (Micha 5,1).
Der Evangelist Lukas ist der Einzige, der die Botschaften des Engels Gabriel aufgeschrieben hat. Der Engel Gabriel wird außer in Lukas Kapitel 1 nur in Daniel 8,16-17; 9,21 erwähnt. Der Engel Gabriel erklärt dem Propheten Daniel die Visionen sowie deren Bedeutung und überbringt dem Priester Zacharias die Botschaft von der Geburt des Johannes (Lk 1,19). Zu Maria wird er von Gott gesandt, um ihr die Menschwerdung des Sohnes Gottes zu übermitteln.
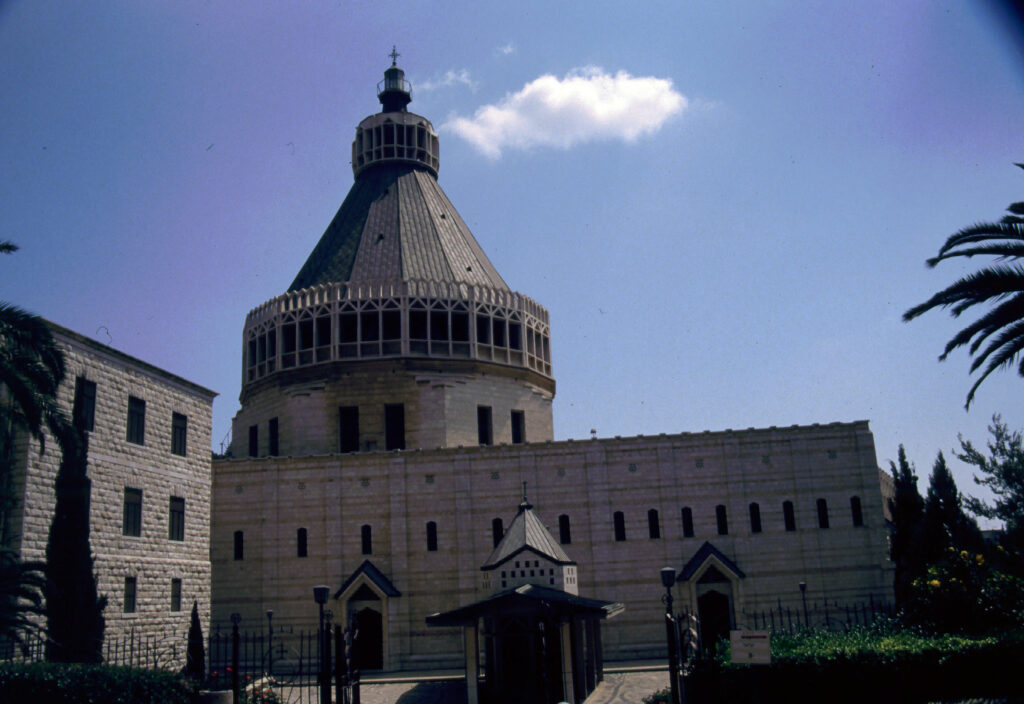
Abbildung 5 Die römisch-katholische Verkündigungskirche in Nazaret. Die Ursprünge des Kirchenbaus an dieser Stelle gehen in das 4. Jh. zurück in Erinnerung an die Verkündigung der Geburt Jesu durch den Engel Gabriel an die Jungfrau Maria. Die früheren Kirchengebäude wurden durch Eroberungen und auch Erdbeben immer wieder zerstört und wieder aufgebaut. Die heutige Kirche stammt aus dem Jahre 1955 (Foto: Juli 1994).
Und so lesen wir in Lukas 1,31-32 von der Botschaft Gottes an Maria durch den Engel Gabriel:
Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden.
Die verständliche Nachfrage der Maria: „Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß“ (Lk 1,34) gibt uns nicht nur einen Einblick in ihr korrektes Verhalten als Verlobte, sondern unterstreicht gleichzeitig, wenn auch nur indirekt, den göttlichen Ursprung von Jesus Christus. Natürlich kennt Maria Josef, ihren Verlobten, aber sie haben als Verlobte keinen geschlechtlichen Umgang miteinander. Aus der großen Perspektive Gottes ist es nicht vorgesehen, dass zwei junge Menschen, auch wenn sie schon verlobt sind, sexuell miteinander verkehren. Wenn Gott dies in die Beliebigkeit der Einzelnen gestellt hätte, wäre der biblische Hinweis auf die Jungfrauengeburt noch schwieriger nachzuvollziehen. Hier sollten wir die Hinweise Gottes aus 5Mose 22,16 kennenlernen (wir denken dabei an den polygamen Hintergrund des Kapitels). Das Zeichen der Jungfräulichkeit der Frau war das Laken/Decke, das in der Hochzeitsnacht genutzt wurde. Wenige biblische Hinweise finden wir für die Jungfräulichkeit des Mannes vor der Ehe. Als Grundtext für dieses Thema gilt: Epheser 5,23f (der reine Christus und seine reine Braut = die Gemeinde).
Gott hatte von Beginn an die Geburt seines Sohnes durch eine Jungfrau geplant, so bekommt auch die Ordnung für Verlobte einen Sinn (siehe 5Mose 22,14).
Der Engel Gabriel lässt Maria natürlich nicht in Unwissenheit über die Art und Weise der Zeugung, er erklärt: „Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten (= Gott) wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden.“ (Lk 1,35)

Abbildung 6 Das unendliche Blau des Himmels, die Wolken und Berggipfel erinnern an die himmlische Sphäre, von der aus sich Gott im Laufe der Geschichte den Patriarchen, den Propheten Mose, Samuel, David, aber auch der Maria in Nazareth offenbart hat (Foto: Petra im Süden von Jordanien 5. November 2014).
P. Thiede bemerkt hierzu: „Sie (Maria) muss genauso verwirrt gewesen sein, wie die Leser es seither sind, und die Erklärung, die der Engel gibt, zielt nicht darauf ab, Gynäkologen zufrieden zu stellen.“
Ob Maria es verstanden hat, ist nicht sicher, geglaubt hat sie es, denn ihre Antwort lautet: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn; es geschehe mir nach deinem Wort.“ (Lk 1,38).
Kritiker des Neuen Testamentes behaupten, dass Götter und Söhne von Göttern in der heidnischen Antike auf ähnliche Weise geboren wurden. Doch wir weisen auf den unübersehbaren Unterschied zu den so genannten religionsgeschichtlichen „Parallelen“ hin. Der biblische Bericht ist zurückhaltend, nüchtern und beschreibt nicht den Vorgang der Empfängnis im Detail. Mit knappen Worten wird die Empfängnis aus der Gottesperspektive beschrieben. In der heidnischen Mythologie werden die Vorgänge aus menschlicher Perspektive, oft in pervertierter Ausschmückung beschrieben. Somit ist die Jungfrauengeburt tatsächlich ohne jegliche biblische oder gar religionsgeschichtliche Ähnlichkeit. Vergleichbar mit der jungfräulichen Empfängnis ist lediglich der alttestamentliche Gedanke des Wohnens (yTin>k;v; – scha½anti ich wohne = Schechinah, die Einwohnung) Jahwes bei den Menschen z. B. in der Stiftshütte (2Mose 25,8-9).
Der Engel Gabriel hat noch eine wichtige Zusatzbotschaft an Maria zu verkünden, nämlich:
Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. (Lk 1,32b-33).
Diese Prophezeiung ist nicht neu, sie wurde schon rund eintausend Jahre vorher dem König David gegeben (2Sam 7,13b-16) und sie lautet:
Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. (…) Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig, dein Thron soll feststehen für ewig.
Gott hielt seine Zusage – „als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau (…).“ (Gal 4,4).
Der Evangelist Matthäus schreibt:
Mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich so; Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger gefunden von dem Heiligen Geist. (Mt 1,18).
Das Ungewöhnliche, das Besondere, das Einmalige wird hier betont. Maria wurde schwanger, „(…) ehe sie (Maria und Josef) zusammenkamen“. Hier betont auch der Evangelist Matthäus, dass Geschlechtsverkehr vor der Ehe nicht üblich war – Jesus also nicht natürlich gezeugt wurde. Für diese ungewöhnliche Zeugung fand er eine alttestamentliche Prophezeiung aus dem Buch des Propheten Jesaja:
Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. (Jes 7,14).
Diese Prophezeiung ist, wie viele alttestamentliche Aussagen, mehrschichtig. Das Zeichen, dass eine junge Frau (auf natürliche Weise) schwanger würde, bezog sich zuerst auf Jesajas Zeitgenossen Ahas und das Volk Juda. Der hebräische Begriff `hm’l.[;h‘ ha±almah` bedeutet allgemein: die junge Frau im heiratsfähigen Alter, kann aber auch die weibliche Person bezeichnen, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatte (was in Israel die Regel war). Aber wie viele andere Verheißungen des Alten Testamentes barg auch diese eine noch in der Zukunft liegende Erfüllung. Bei der Übersetzung des hebräischen Alten Testamentes in die griechische Sprache wurde an dieser Stelle der Begriff `parqe,noj parthenos – Jungfrau` gewählt.
HINWEIS: Die griechische Übersetzung des Alten Testamentes aus dem 2. Jh. vor Chr. wird Septuaginta/LXX (=Siebzig/lateinische Zahlen für 70) genannt, da angeblich 72 Übersetzer nach 72 Tagen diese Übersetzung im 2Jhd. v. Chr. anfertigten (Aristeasbrief 9-11.41.46.50.121.301f.307-311).
Dieser griechische Begriff meint im Neuen Testament an den meisten Stellen eine junge Frau, die noch nie Geschlechtsverkehr hatte (wörtlich/buchstäblich Lk 1,27; 2,36; Apg 21,9; 1Kor 7,25.28.34.36.37.38; im übertragenen Sinne; 2Kor 11,2; Offb 14,3-4). Der Evangelist Matthäus (aber auch Lukas) heben mit diesem Begriff die Jungfräulichkeit Marias hervor. So wie damals der Herr durch eine junge Frau mit ihrem Sohn den Zeitgenossen Jesajas ein Zeichen gegeben hatte, so wurde Maria von Gott auserkoren als `Jungfrau` schwanger zu werden und einen Sohn zu gebären als Zeichen zu ihrer Zeit.
Der Evangelist Johannes beginnt sein Evangelium mit den Worten:
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Einziggeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.” Johannes (der Täufer) zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte: Der nach mir kommt, ist vor mir, denn er war eher als ich. (Joh 1,1.14-15). Johannes der Täufer ruft aus: „Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. (Joh 1,34).
Der Evangelist Markus beginnt sein Evangelium mit den Worten: „Anfang des Evangeliums Jesu Christi (des Sohnes Gottes).“ (Mk 1,1).
Weitere Bibelstellen zum göttlichen Ursprung von Jesus Christus: vgl. Ps 110,1 mit Mt 22,42-44; Joh 1,18; 3,16; 5,17-19; 8,58; 10,30-36; 20,28; 1Joh 5,20; Röm 1,1-3; 9,5; vgl. Ps 2,7 und 2Sam 7,14 mit Hebr 1,3-5ff.
In den folgenden Abschnitten unserer Bibelstudien wollen wir die verschiedenen Details der Menschwerdung und Geburt von Jesus zeitlich-chronologisch betrachten und zwar in dem historischen, geographischen und kulturellen Kontext der damaligen Zeit.
Fragen / Aufgaben:
- Lies zu Mt.1,18-25; Lk.1,26-38; Joh.1,1-18 in Ruhe die angegebenen Parallelstellen deiner Arbeitsbibel.
- Stelle den göttlichen Ursprung von Jesus Christus aufgrund der einzelnen Aussagen dar.
- Welche Aussagen betonen die Jungfräulichkeit Marias? War sexuelle Enthaltsamkeit vor der Ehe damals allgemeine Norm im Judentum? Worauf wurde dieses Verhalten gegründet?
- Welche Meinung herrschte unter dem Volk in Bezug auf den Ursprung/die Herkunft von Jesus?
- Warum ist es so wichtig am göttlichen Ursprung von Jesus Christus festzuhalten?
1.3 Gott spricht zu Josef im Traum
(Bibeltext: Mt 1,18-25)
Gott sucht sich einen Mann namens Josef, als Adoptivvater für seinen Mensch gewordenen Sohn. Dieser übernimmt die Fürsorgepflicht und die Verantwortung für die leibliche und materielle Versorgung von Jesus. Josef,- der Name bedeutet: Gott möge hinzufügen. Markus und Johannes erwähnen Josef nicht. Es könnte sein, dass der Evangelist Matthäus seine Information über Josef von Jakobus, dem Bruder von Jesus erhielt. Lukas könnte Jakobus selbst befragt haben.

Abbildung 7 Die heutige Stadt Nazaret in Südgaliläa mit überwiegend arabisch-christlicher Bevölkerung ist Anziehungspunkt für die meisten Pilger, welche aus aller Welt nach Israel kommen (Foto: Juli 1994).
Josef stammt vom Hause David ab, hat aber irgendwann die Heimatstadt Bethlehem, wahrscheinlich aus beruflichen Gründen, verlassen. So wohnt und arbeitet er in Nazaret, einer Kleinstadt im südlichen Galiläa.
Dort geht er seinem Beruf nach und baut Häuser (Mt 13,55; Mk 6,3). Der griechische Begriff für diesen Beruf ist `te,ktwn – tekt÷n` und beschreibt „einen, der Häuser baut“. Die Wortwurzel ist noch im deutschen `Archi-tekt` herauszuhören.
Der Evangelische Pastor Ludwig Schneller lebte und arbeitete Ende des 19. Jh. in Bethlehem und weist darauf hin, dass die Bewohner Bethlehems unter anderem gute Meister im Häuser bauen waren. Er nimmt an, dass es in Bethlehem nicht genug Arbeit gab und Josef mit anderen Berufskollegen außerhalb Bethlehems Arbeit suchte (Schneller 1890, 58ff).
Die nordeuropäische Vorstellung, dass er Zimmermann war und mit Holz arbeitete, ist vor dem Hintergrund des Waldreichtums in Nordeuropa zu sehen. Zur Zeit Martin Luthers baute man Häuser zum größten Teil aus Holz. In Palästina gab es allerdings bereits im Altertum wenige Wälder und damit wenig Holz. Schon der König David und sein Sohn Salomo ließen für den Bau des Tempels in Jerusalem Holz aus dem Libanon importieren (1Kön 5,15).
Josef wird von den Evangelisten Matthäus und Lukas als `di,kaioj –dikaios – gerecht` charakterisiert (Mt 1,19; Lk 1,27). Gerecht bedeutet im Neuen Testament grundsätzlich: dem Standard, Willen und Charakter Gottes entsprechend. Hier dürfen wir wenigstens feststellen: Josef lebt in einer aufrichtigen Beziehung zu Gott. Maria ist mit ihm verlobt und sie warten auf den geeigneten oder auch schon bestimmten Termin für ihre Hochzeit. Der Begriff Hochzeit oder Heirat, griechisch `ga,moj – gamos`, kommt zwar in diesen Texten nicht vor, wird aber umschrieben mit: `sunelqei,n – synelthein` zusammenkommen; andere Übersetzer weniger passend: heimholen. Der Satz: „ehe sie zusammengekommen waren” (Mt 1,18) lässt sogar die Vermutung zu, dass der Hochzeitstermin schon feststand. Dem Evangelisten Matthäus liegt viel daran zu betonen, dass die Schwangerschaft ohne Zutun des Josef zustande kam.
Es gibt nur eine Möglichkeit, wie Josef von der Schwangerschaft Marias erfährt. Nur sie selbst kann es ihm gesagt haben. Es entsteht der Eindruck, dass er ihr erst nicht glaubt und sie entlassen will, natürlich ohne Aufsehen und ohne sie bloß zu stellen (Mt 1,19).
HINWEIS: „Eine Verlobung aufzulösen, wurde wie eine Scheidung betrachtet = eine rechtlich wirksame Entlassung geschah meist schriftlich. Nach dem Gesetz hätte Maria bei ungenauer Untersuchung des Falles im Extremfall die Todesstrafe durch Steinigung gedroht (5Mose 22,20-27). Im 1. Jahrhundert wurde allerdings dieses Extrem meist vermieden“ (Strack 1982, 45f).
Josef hat das Recht Maria anzuzeigen, da sie seine Verlobte ist. In dieser, für Josef und Maria schwierigen Situation, greift Gott ein. Ein Engel erscheint Josef im Traum und nimmt ihm Furcht und Zweifel: „Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn das in ihr gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden.“ (Mt 1,20b-21). Mehrfach offenbaren sich Josef Engel: Mt 1,20.24; Mt 2,13.19. Gut möglich, dass derselbe Engel Gabriel auch die Botschaft für Josef überbrachte. Auch er bekommt den Hinweis, dass die Empfängnis durch den Heiligen Geist geschehen ist. Gleichzeitig bekommt er den Auftrag, dem Kind den Namen Jesus zu geben. Josef, vom Schlaf erwacht, ändert sofort seine Einstellung und Meinung in Bezug auf Maria, seine Frau. Warum bezeichnet der Engel die Maria bereits als Frau von Josef (Mt. 1,20)?
„Diese Bezeichnung für eine Verlobte entspricht der Aussage in 5Mose 22,24. Niemand konnte ihnen etwas tun, da Josef das Kind Jesus legitimiert hatte, indem er Maria geheiratet und ihren Sohn adoptiert hatte“ (Thiede 2006, 67).
Josef zeigt sofortigen Gehorsam dem Wort des Herrn gegenüber. „Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich.“ (Mt 1,25a). Dem Evangelisten Matthäus war noch wichtig zu betonen, dass Josef seine „Frau nicht erkannte, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte.“ (Mt 1,25b). Das griechische Wort `egi,nwsken – eginösken – erkannte` meint auf dem Gebiet der Ehe den Geschlechtsverkehr, das Ein-Fleisch-Werden (so in 1Mose 4,1: „Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger (…).“). Vielleicht hat der Evangelist Matthäus dies deswegen betont, damit bei den Lesern keine unnötigen Fragen oder Zweifel in Bezug auf die übernatürliche Schwangerschaft der Maria aufkommen. Zwei Menschen mit einem großen Geheimnis! Es sieht nicht danach aus, als hätten sie das Erlebte nun allen erzählt. Denn auch später herrscht die Meinung, dass Jesus der Sohn Josefs sei. In Lukas 3,23 (auch Joh 1,45; 6,42) heißt es: „Und er selbst, Jesus, (…) war, wie man meinte, ein Sohn des Josef.“
Fragen / Aufgaben:
- Welche Aussagen über Josef fielen dir auf? Beachte die Herkunft Josefs, seinen Beruf.
- Jede Empfängnis und Geburt ist ein „Wunder.“ Wo gibt es die großen Unterschiede zur Situation von Maria und Josef? Was ist ähnlich?
- Beschreibe das rücksichtsvolle Verhalten Josefs zu Maria im kulturellen Umfeld des Judentums. Was können Männer heute von ihm lernen?
- Wie reagierte Josef vor und nach dem Besuch des Engels?
- Was bedeuten „Engelbesuche“ – damals und heute? (170 mal im NT erwähnt; Hebr 13,2; 2Kor 11,14).
- Wie deuten wir den „blinden“ Gehorsam des Josef?
- In welchen Bereichen können wir das Verhalten Josefs als „gerecht“ beschreiben?
- Können wir Geheimnisse über die Herkunft von Kindern bewahren? Sollten wir es?
1.4 Maria besucht Elisabeth auf dem Gebirge Juda
(Bibeltext: Lk 1,39-56)
1.4.1 Die Umstände des Besuches
Der Evangelist Lukas macht hier eine Zeitangabe: „In diesen Tagen“ (Lk 1,39), d.h. nicht lange nach Beginn der Schwangerschaft reist Maria hinauf in das Gebirge Juda zu ihrer Verwandten Elisabeth. Dies ist ungewöhnlich, doch geschieht es wohl mit der Einwilligung Josefs. Ob er beruflich unabkömmlich war? Der Evangelist Lukas unterstreicht, dass Maria die Reise in Eile antritt. Dieser Besuch ist für Maria wichtig, da der Engel Gabriel ihr von Elisabeth und deren ungewöhnlichen Schwangerschaft im hohen Alter berichtet hatte (Lk 1,36). Elisabeth, die Frau von Zacharias, war aus dem Stamm Levi, wie wir aus Lk 1,5 erfahren. Nach Lukas 1,36 ist Maria Elisabeths Verwandte. Somit wäre Maria ebenfalls aus dem Stamm Levi. Rechtlich musste Jesus ja aus dem Hause David kommen und dies ist aufgrund der Adoption durch Josef gegeben. Doch scheint hier noch die Komponente der priesterlichen Herkunft (Stamm Levi) rechtlich gegeben. Demnach wäre der Status ‚Priester/König‘ bei Jesus damit indirekt angedeutet. Wahrscheinlich hat sich Maria nicht ganz allein auf den mühsamen Weg hinauf auf das Gebirge Judäa gemacht. Meist reiste man nicht allein (hier wenigstens 4-5 Tage), ohne dazu einen wichtigen Grund zu haben; schon gar nicht als junge, schwangere Frau. Entweder schließt man sich einer Karawane an oder Pilger tun sich in Gruppen zusammen (Lk 2,44). Wahrscheinlich wohnten Zacharias und Elisabeth nicht in Jerusalem, sondern in einer der Städte oder Ortschaften Judas. Den Priestern, Aarons Nachkommen waren Städte verteilt im Land und durch das Los zugeteilt worden. So lesen wir im 1. Chronikbuch:
Und sie gaben den Söhnen Aarons die Zufluchtstadt Hebron und Libna und seine Weideflächen und Jattir und Eschtemoa und seine Weideflächen und Holon und seine Weideflächen, Debir und seine Weideflächen und Aschan und seine Weideflächen und Bet-Schemesch und seine Weideflächen. (1Chron 6,42-43).

Abbildung 8 Landschaft auf einer Hochebene zwischen Bethlehem und Hebron, das zum Gebirgesland von Juda gerechnet wurde (Foto: April 1986).
Wahrscheinlich wohnten Zacharias und Elisabeth nicht in Jerusalem, sondern in einer der oben im Text genannten Städte im Stammesgebiet von Juda, welche speziell für Priester und Leviten vorgesehen waren. Die Begrüßung ist sehr herzlich, so dass Elisabeth spürt, wie ihr Kind im sechsten Monat sich heftig regt.
Der ganze Abschnitt konzentriert sich auf zwei Frauen, von denen die eine von keinem Mann „weiß“, während der Mann der enderen verstummt war. Sie begrüßen als erste Menschen in der Kraft des Geistes den kommenden Herrn. Darum ist alles vom Jubel erfüllt.
1.4.2 Der Segens- und Jubelhymnus der Elisabeth
Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, wie die Stimme deines Grußes mir in die Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. (Lk 1,41b-45).
Bemerken wir die Freude über das Glück des anderen? Der Geist Gottes hat immer wieder gerade Frauen erfüllt und sie empfindsam gemacht für sein Wirken. Menschen unter der Leitung des Geistes Gottes werden sehr ehrlich und offen zueinander. Persönliche tiefe Empfindungen werden mit Freuden ausgesprochen. Die wunderbaren Führungen Gottes werden in der kleinen Hausgemeinde des Zacharias gerühmt. Elisabeths und noch mehr Marias Lobpreis wirken fast unheimlich, doch die allererste Christus-Erkenntnis ist schon eine Gabe des Geistes Gottes.
1.4.3 Marias Lobpreis (Magnificat)
Wir finden vier Lobgesänge im Lukasevangelium: von Elisabeth, Maria, Zacharias und Simeon. Nach ihrem lateinischen Beginn werden sie als Benedictat (benedicta tu inter mulieres = Elisabeth Lk 1,42-45), als Magnificat (Maria Lk 1,46-55), als Benidictus (Zacharias Lk 1,68-79) und als Nunc dimittis (Simeon Lk 2,29-35) bezeichnet. Seit Thomas Müntzer, Luthers Gegner, verstehen manche Marias Worte als eine Ermutigung zu einer Neuordnung der irdischen Verhältnisse, ja zum Umsturz und zur Revolution (auch Befreiungstheologie heute). Doch nicht der Mensch (auch nicht Maria!), sondern Gott ist der Adressat dieses Lobpreises. Maria preist den Herrn im Hause des Zacharias:
Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat frohlockt in Gott, meinem Heiland. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm, er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. (Lk 1,46-51).
Marias Lobpreis kann für unseren heutigen Lobpreis eine praktische Anleitung sein:
- Es preist meine Seele den Herrn,
- Gott ist mein Retter (hier wird dasselbe Wort für »Retter« benutzt, welches später Jesus bezeichnet (vgl. Mt 1,21!) – im Deutschen früher als »Heiland« wiedergegeben. »Mein Retter« heißt: Gott erlöst mich aus Sünde und Finsternis, er hilft mir ganz umfassend auf allen Gebieten meines Lebens, vor allem aber bringt er mich in sein ewiges Reich. Hier spiegeln sich Jes 63,16 und Hab 3,18 ganz deutlich wider, aber auch Ps 24,5; Ps 25,5; Ps 35,9. Die zweite Hälfte von Lk 1,47 stimmt sogar wörtlich mit dem Schluss von Hab 3,18 in der griechischen Bibel überein.
- In Jubel geraten ist mein Geist über Gott, meinen Retter,
- Er hat auf die Niedrigkeit seiner Dienerin hingesehen, (wörtlich auch: seine Aufmerksamkeit zuwenden)
- Von nun an werden mich glücklich preisen alle Generationen,
- Der Mächtige hat mir Großes getan, heilig ist sein Name,
- Seine Barmherzigkeit erfahren Generationen nach Generationen, wenn sie ihn fürchten; (wie oft wurde im AT diese Barmherzigkeit Gottes besungen! Vor allem gilt dies für Ps 103, an den sich Maria vielleicht angelehnt hat),
- Er übt Macht aus mit seinem Arm (2Mose 15,6; Ps 89,11; Ps 118,15),
- Er zerstreut die Übermütigen im Denken ihres Herzens,
- Die Mächtigen holt er herunter von den Thronen und erhöht Niedrige,
- Hungernde bekommen Gutes in Fülle, Reiche dagegen schickt er leer weg, (das Bild dieser Reichen hat Jesus im reichen Mann und armen Lazarus und im reichen Kornbauern eindrücklich gezeichnet (Lk 16,19ff.; 12,16ff),
- Er hat sich seines Volkes angenommen und will sich an die Barmherzigkeit erinnern, die er den Vätern, Abraham und seinem Nachkommen (im Singular – welcher ist Christus) für ewig in Aussicht gestellt hatte (Vgl. V. 55 mit Gal 3,16),
Wir beobachten hier:
- den Glauben einer, Gott aufrichtig dienenden jüdischen Frau
- eine ganze Linie von alttestamentlichen Frauen, die uns bis heute als Glaubensvorbilder dienen können: Lea, Rebekka, Hanna, Elisabeth, Maria;
- einen Lobpreis, der tatsächlich Gott und sein Wort in die Mitte stellt, und nicht etwa einen Aufruf an Menschen, die bestehenden Verhältnisse umzustürzen;
- eine echte Prophetie der Maria, worauf schon die Lehrer der Alten Kirche (z. B. Irenäus) hinwiesen;
- eine erstaunliche Bibelkenntnis der Maria, die sich auf die prophetischen Aussagen des Alten Testaments beziehen;
- eine nicht weniger erstaunliche Verwandtschaft mit der Verkündigung von Jesus, z. B. im Vaterunser und in der Bergpredigt (vgl. Mt 6,9.10; Mt 5,3.4. 6; Lk 6,20.21.22, aber auch Mt 23,12; Joh 8,56).
In Elisabeth hat Maria nicht nur eine Verwandte, sondern auch eine Freundin. In Nazaret kann Maria diese Freude nur mit Josef teilen. Hier im Haus des frommen Priesters Zacharias und seiner Frau kann offen darüber gesprochen werden. Das erfahrene Heil, belegt durch alttestamentliche Verheißungen, führt zu einem geistlichen Aufblühen von Elisabeth und Maria. Ihre Erfahrungen drängen sie, sich einander mitzuteilen.
Maria ist eine längere Zeit bei Elisabeth. Lukas, der nicht gerade sparsam mit Zeitangaben ist, schreibt in Kapitel 1,56: “Und Maria blieb ungefähr drei Monate bei ihr, und sie kehrte zu ihrem Haus zurück.” (Lk 1,56). So kehrt Maria nach etwa drei Monaten, noch vor der Geburt des Johannes, nach Nazaret zurück.
1.4.4 Der Lobpreis des Zacharias
Nach der Geburt seines Sohnes stimmt Zacharias einen Lobpreis an (Benedictus Lk 1,67-79). In diesem Hymnus/Lobpreis kehren gleiche Wörter in chiastischer (umkehrender) Reihenfolge wieder: a) besuchen (68b) – b) Volk (68b) – c) Heil (69) – d) Propheten (70) – e) Feinde (71) – f) Hand (71) – g) unsere Väter (72); dann umgekehrt g‘) unser Vater (73) – f‘) Hand (74) – e‘) Feinde (74) – d‘) Prophet (76) – c‘) Heil (77a) – b‘) Volk (77a) – a‘) besuchen (78b). Verheißungen, Bilder und feststehende Begriffe aus dem Alten Testament kann Zacharias auf seinen Sohn Johannes als Wegbereiter des HERRN beziehen:
Erlösung schaffen `gr. lu,trwsij – lytrösis` Vergebung, Befreiung; vgl. Ps 111,9 tWdP. pedût Loskauf, Auslösung, Lösegeld.
- „Das Horn des Heils wird die Feinde zerstreuen“ ist ein Beispiel für die Zerstörung durch das „Horn“ Dan 8,5-7: Das Horn des Gesalbten (1Sam 2,10) wird als Messias-Verheißung verstanden. Bis heute betet der gläubige Jude im sog. Achtzehngebet (Schemone Esre aus dem 9. Jh.): »Den Spross Davids lass bald sprießen, und sein Horn sei erhöht durch deine Hilfe. Gepriesen seist du, Jahwe. der du sprießen lässest das Horn des Heils«.
- Befreiung von allen, die uns hassen: Jesus wird die Festungen Satans zerstören! Siehe besonders Ps 68,2 und Offb 17,14!
- Erkenntnis des Heils und Vergebung: siehe hier Dan 9,9.
- Die herzliche Barmherzigkeit Gottes (dia, spla,gcna ele,ouj qeou, – dia splagxna eleous theou) besucht uns: hier werden die innersten Gefühle Gottes (innere Organe des Erbarmens unseres Gottes) offenbart.
- Zacharias spricht vom Aufgehen (LXX: hier Spross) eines Gestirns, des „großen Lichtes“ (Jes 9,1), der „Sonne der Gerechtigkeit“ (Mal 3,20) oder des „Sterns aus Jakob“ (4Mose 24,17; auch Jes 9,1; 60,1-2). Allerdings geht dieses Licht nicht über dem Horizont auf, sondern in der „Höhe“, wie das plötzliche Aufstrahlen eines Meteors. A. Schlatter sagt: „Er ist ein Ewiger, der von oben her aus Gottes Nähe heraus in die menschliche Gemeinschaft herab gesandt wird.“ Es ist auch nicht allgemeine Erhellung, sondern Licht, das „uns“ besucht, auf „uns“ hinschaut (s. zu V.68) und so allen Todesschatten aufhebt und die Menschen auf den richtigen Weg weist. Zacharias sieht in Christus Gott, der wieder in das Leben der Menschen eintritt und jenen, die in Finsternis leben, das Licht schenkt.
Fragen / Aufgaben:
- Warum zog es Maria zu Elisabeth?
- Welche Auswirkung hat das Verhalten einer schwangeren Frau auf ihr Kind? Stimmt es, dass Kinder im Mutterleib vieles von ihrer Umwelt wahrnehmen können?
- Welche Abschnitte im Lobpreis Marias sprechen dich an? Erläutere warum!
- Zeitangaben stehen nicht willkürlich in der Bibel. Vorschlag beim Lesen der vier Evangelien: Markiere die Zeitangaben zum Leben von Jesus in deiner Arbeitsbibel. Notiere sie weiter in einer Tabelle. So hast Du sie alle zusammen auf einen Blick.
- Wie würdest du aus diesem Text begründen, dass Abtreibung nie Gottes Wille, sondern Mord ist? Welche Hilfestellung können wir Frauen und Männern geben, die mit dieser Fragestellung als Betroffene kämpfen?
- Beschreibe deine persönliche Haltung zu Maria, der Mutter von Jesus? Kann es sein, dass wir hier etwas korrigieren müssen?
- In der kleinen Hausgemeinde des Zacharias florierte der Lobpreis! Wie können wir in unseren Hauskreisen, in unserer Gemeinde das Dichten und Komponieren von Lobpreis anregen?
1.5 Josef und Maria ziehen nach Bethlehem um
(Bibeltext: Lk 2,1-6)
Als Maria von Elisabeth nach Nazaret zurückkehrt, ist sie schon im vierten Monat schwanger. Josef wird durch seine Arbeit zuverlässig für den Lebensunterhalt gesorgt haben. Nach außen hin eine ganz normale junge Familie, die sich in froher Erwartung ihres ersten Kindes befindet. Womöglich wurden ihre Pläne durchkreuzt, denn:
Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung (δόγμα – dogma) vom Kaiser Augustus ausging, die ganze Ökumene (in Listen) einschreiben zu lassen. Diese Einschreibung (in Listen) war die erste während (der Zeit), da Quirinius Statthalter von Syrien war. (Lk 2,1-2).
„In jenen Tagen“ bedeutet in diesem Zusammenhang, in dem Zeitraum nach der Rückkehr der Maria nach Nazaret. Nur der Evangelist Lukas verbindet das Jesus-Evangelium mit der allg. Weltgeschichte. Das gr. Wort `οικουμενη – oikoumen¢` kommt im Neuen Testament 15 mal vor und meint meist die ganze Welt/den ganzen Erdkreis/alle Bewohner der Erde. In diesem Zusammenhang jedoch ist es auf alle Bewohner des römischen Reiches begrenzt (Vgl. dazu auch Apg 17,5; 24,1f).
Unser heutiger Text sagt aus, dass Josef seine Verlobte nahm um nach Bethlehem zu ziehen. In einem überlieferten Dokument aus Ägypten lesen wir, dass ein Ehepaar mit Grundbesitz bei der Einschreibung persönlich anwesend sein musste (Aalders 1938, 34.35). Hatte Josef Grundbesitz in Bethlehem? Maria wird hier die Verlobte (Anvertraute) genannt – doch nach Matthäus 1,24b.25 war sie bereits seine rechtmäßige Ehefrau. Warum diese Unterscheidung? Der Grund kann darin gesucht werden, dass die Ehe noch nicht durch Geschlechtsverkehr vollzogen war. So war Maria nach allen Rechten und nach dem Gesetz (sozusagen nach außen hin) die Frau von Josef, biologisch war sie jedoch noch Jungfrau und daher seine Verlobte.
Josef und Maria haben die Strecke zu Fuß zu bewältigen, was in der Antike etwa vier bis fünf Reisetagen entspricht. Zur Zeit des Augustus gab es im Römischen Reich auch im Osten bereits ein gut ausgebautes Straßensystem. Seit dem Bau der Via Appia von Rom nach Capua im Jahre 312 v. Chr. waren viele neue Staatsstraßen in Italien und in den Provinzen gebaut worden. Die Meilen (1,6 km) waren durch Meilensteine markiert, auf denen auch die Entfernungen zu den nächsten Städten eingemeißelt waren. Die Straßen sind hauptsächlich von Staatsdienern und Militärs benutzt wurden, dann auch von Kaufleuten, Pilgern und Privatreisenden. Es sind von Staats wegen alle va. 30 km Raststationen, Ställe und Wechselstationen für die Pferde errichtet worden, in denen auch Josef und Maria hätten einkehren können.
Beim Umzug von Nazaret nach Bethlehem müssen die beiden 110-150 km je nach Route zurücklegen. Nazaret liegt etwa 98 km nördlich von Jerusalem auf der Höhe des Sees Gennesaret, während Bethlehem etwa 8 km südlich von Jerusalem liegt.
Der Umzug wird vordergründig durch den kaiserlichen Erlass veranlasst. Doch hinter dem weltpolitischen Geschehen steht der Plan Gottes: der Messias soll aus Bethlehem kommen. Ob Josef an die Prophetie aus Micha 5,1 denkt, wird in diesem Zusammenhang nicht erwähnt, möglich ist es jedoch, da später die Schriftgelehrten diesen Vers auf den Messias beziehen (Mt 2,4-6; Joh 7,42). Die Tatsache, dass Josef und Maria nach der Geburt des Kindes noch längere Zeit in Bethlehem bleiben und nach der Rückkehr aus Ägypten zunächst wieder dorthin gehen wollen, spricht für eine gewisse Kenntnis dieser Schriftstelle. Doch nach dem Lukastext ist die kaiserliche Verordnung der Hauptgrund für den Umzug nach Bethlehem. Gott wählt hier ein weltpolitisches Ereignis um den Geburtsort von Jesus nach Bethlehem zu verlegen. Dieses politische Ereignis kann nebenbei auch noch über die Zeitbestimmung der Geburt von Jesus gewisse Auskunft geben (näheres dazu im nächsten Abschnitt „Die Geburt von Jesus in Bethlehem“).
Was die Umstände und die Zeit des Umzugs nach Bethlehem betrifft, so können wir Josef wesentlich mehr Verantwortung zugestehen, als in den üblichen Weihnachtserzählungen oft geschildert wird. Die beiden sind keineswegs wenige Tage vor der Entbindung von Nazaret aufgebrochen und am Vorabend der Geburt in Bethlehem angekommen, um dann festzustellen, dass alle Gasträume bereits überfüllt waren. Von früherer Zeit war das Grab Rahels, der Lieblingsfrau von Jakob nördlich von Bethlehem ein Mahnmal für die Reisenden im hochwangeren Zustand (1Mose 35,16-20). Josef ist ein besonnener, gottesfürchtiger und dazu noch praktisch veranlagter Mann. Der Satz: „Als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären soll (…).“ (Lk 2,7), deutet an, dass Maria und Josef sich bereits einige Zeit in Bethlehem befanden. Dort wohnten sie entweder im Elternhaus oder bei einem seiner Verwandten. Josef kommt keineswegs als Fremder nach Bethlehem zurück. Der Evangelist Lukas vermerkt, „Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine (Vater-) Stadt.“ (Lk 2,3). Die Eintragung in Listen setzt voraus, dass Josef in Bethlehem gemeldet ist und sehr wahrscheinlich von seinen Vorfahren her hier Grundbesitz hat. So hat er genug Zeit, um die geforderte Eintragung in die amtlichen Listen vorzunehmen, und auch Maria kann sich in aller Ruhe auf die Entbindung vorbereiten.
Fragen / Aufgaben:
- Nenne den Grund des Umzugs von Josef und Maria nach Bethlehem? Beschreibe auch die Reisebedingungen damals (Schau mal ans Ende deiner Bibel/Arbeitsbibel in die Karten oder forsche im Bibelatlas/Bibellexikon).
- Kamen Josef und Maria wirklich erst am Vorabend der Geburt ihres Sohnes in Bethlehem an, wie oft in den Weihnachtsgeschichten zu hören ist? Passt dies zu Josef? Beachte den genauen Wortlaut des Textes in Lukas 2,7.
- Nenne mindestens drei Bereiche aus unserem bürgerlichen Leben, bei denen das Gebot der Unterordnung unter die Obrigkeit (Röm 13,1-8) auch für uns bindend ist, also Geltung hat.
- Können wir Gottes Hand in den Daten und Orten unserer Lebensgeschichte erkennen?
- Ärgert es dich, wenn unsere Regierung immer wieder neue Steuergesetze erlässt?
1.6 Bethlehem – der Geburtsort von Jesus
Im Jahr 33, etwas mehr als 30 Jahre nach der Geburt von Jesus, war das Wissen über seinen Geburtsort allgemein nicht mehr bekannt (Joh 7,41-42). Und heute: Jedes Kind weiß, dass Jesus nicht nur in der Stadt Bethlehem, sondern auch noch in einem „Stall in Bethlehem“ zur Welt kam, weil Maria ihn nach der Geburt in eine Futterkrippe legt. In der Weihnachtszeit zeigen die Krippenspiele meistens auch noch einige Haustiere (Schafe, Esel, Ochsen), die daneben stehen und neugierig das Jesuskind in der Krippe beäugen.

Abbildung 11 Bethlehem – der Geburtsort von Jesus Christus. Blick von West nach Ost (Foto: Juli 1994).
Der Evangelist Lukas schreibt: „Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in dem Raum (gr. καταλυμα – katalyma) für sie kein Platz war.“ (Lk 2,6-7).
Beachten wir zunächst die Wendung: „während sie dort waren (gr. εν τω είναι αυτούς εκει – en tö einai autous ekei) erfüllte sich die Zeit (…)“ dass sie (Maria) gebären sollte. Das heißt, sie sind schon eine Zeitlang in Bethlehem. Die Formulierung: „während sie dort waren (sind)“ ist im gleichen Sinne wie „als sie dort verweilten“ oder „sich dort aufhielten“. So ähnlich wie es später von Jesus heißt:
- Es geschah aber während er in einer Stadt war – Lk 5,12); oder,
- Es geschah aber während er an einem Ort war und betete (Lk 11,1; 9,18).
Die gleiche Formulierung hat Lukas auch in Kapitel 2,6. Auch hier ist nicht das Ankommen betont, sondern die Handlung oder das Ereignis während des Aufenthaltes an einem bestimmten Ort. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wohnen sie in einem Haus ihrer Verwandten und nicht in einer Herberge oder Gaststätte. Denn das Handwerk, Häuser zu bauen, war wohl Tradition in der Familie von Josef. Und dass seine Vorfahren als Baumeister für die eigene Familie ein ordentliches Haus gebaut hatten, ist auch nahe liegend. Übrigens ist im Text auch keine Rede von einem Stall.

Abbildung 12 Die Geburtskirche in Bethlehem zählt zu den ältesten christlichen Bauwerken aus der Antike – Anfang des 4. Jahrhunderts (Foto: Juli 1994).
Heute steht mit vielfältigem Glanz die Geburtskirche über einer Felsgrotte.
Es war also nicht im Haus als Ganzes, sondern nur im üblichen Gästeraum (Wohnraum) kein Platz, für die Entbindung und wo man hätte das neugeborene Kind hinlegen können. Dieser übliche Raum wird vom Evangelisten Lukas als ´καταλυμα – katalyma´ bezeichnet. Er verwendet diesen Begriff noch einmal für ein Oberzimmer in einem Haus in Jerusalem, in dem Jesus mit seinen Jüngern das Passahlamm essen wollte. Dort heißt es:
Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen: Der Lehrer sagt dir: Wo ist der Raum (καταλυμα – katalyma), wo ich mit meinen Jüngern das Passah essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern belegten Obersaal zeigen, dort bereitet (Lk 22,11-12, vgl. dazu auch den Paralleltext aus Mk 14,14 wo der Evangelist Markus für den angefragten Raum den gleichen Begriff verwendet).
Diese Aussagen geben uns sogar einen gewissen Einblick in die Architektur eines Hauses in Jerusalem. Diese Bauweise ist heute noch überall im Mittelmeerraum gegenwärtig. Die Pontus-Griechen nahmen diese Bauweise sogar nach Mittelasien mit. Wenn es also einen Obersaal, oder Oberzimmer (durch αναγαιον – anagaion, der „obere“ angedeutet) im Hause gibt, dann gibt es eben auch Räume im Erdgeschoss, die wohl eher als Wirtschafsträume genutzt werden. Dort wohnen die regulären Hausbewohner während der Zeit der vielen Gäste – während die Gäste selbst im besseren oberen Raum unterkommen. Für die Entbindung und das neugeborene Kind ist in diesem Raum kein Platz. Sie wohnen also mit den regulären Bewohnern in den unteren Räumen.
Anmerkung: Allerdings muss diese Aussage vor dem Hintergrund der LXX eingeschränkt werden. Das griechische Wort steht dort für vier verschiede hebräische Worte, darunter definitiv auch für eine öffentliche Herberge (2Mose 24,4). Doch hier geben wir Lukas und Markus Vorrang mit der Zuordnung dieses Begriffes.
Darum ist die Übersetzung „Herberge“ in Lukas 2,7 missverständlich, weil er dafür ein anderes griechisches Wort verwendet, und zwar `πανδοχειον – pandocheion` (Lk 10,34), was so viel wie Khan, Karawanserei bedeutet. Dort geht es tatsächlich nur um eine Übernachtungsmöglichkeit für Pilger oder Geschäftsleute mit ihren Pferden, Eseln oder Kamelen. Aber Josef und Maria sind mit Jesus auch später noch, als die Weisen ankamen, in einem Haus (Mt 2,11). Dem sogenannten abweisenden „Gastwirt“ in Bethlehem wird häufig in den Weihnachtsanspielen Unrecht getan, zumal auch er im Text gar nicht vorkommt.
Wie kommt dann eine Krippe in den unteren Raum des Hauses? Wenn nach Lukas 22,11 καταλυμα – katalyma ein Oberzimmer beschreibt, kann es sich im Falle der Geburt von Jesus um einen im Erdgeschoss befindlichen Vielzweckraum des Hauses handeln, wo gelegentlich oder bei schlechtem Wetter, Jungtiere oder Kleinvieh zusammen mit den Hausbewohnern Unterschlupf finden und wo zu diesem Zweck selbstverständlich auch eine Futterkrippe steht.
Ludwig Schneller beschreibt die innere Ausstattung eines arabischen Hauses in Bethlehem aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Die Araber (überwiegend christliche Bewohner der Stadt) hatten zu der Zeit höchstwahrscheinlich eine andere Bauweise, doch gibt es auch Ähnllichkeiten zu der Zeit von Jesus:
„Die meisten Häuser in Bethlehem bestehen aus einem einzigen Raum. Im Winter und in der Regenzeit wird dieser nicht nur von Menschen, sondern auch von Tieren bevölkert. Es ist keine Seltenheit, dass in diesem Raum eine Krippe steht. Da es keinerlei Möbel, wie Betten und Schränke gibt, kann eine Futterkrippe als sehr günstiges Bettchen für einen Säugling dienen“ (Schneller 1890, 31).
Wer nun die beschriebenen unteren Räume eines Hauses in Bethlehem als Stall bezeichnen will, kann es tun, dieses Wort steht jedoch nicht im Text. Das griechische Wort αυλη, – aul¢ , welches Luther in Johammes 10,1.16 mit ‚Stall‘ übersetzt, kommt noch an folgenden Stellen des Neuen Testamentes vor:
- es beschreibt in Lk 22,55 und Paralleltexten den Hof (Palasthof) des Hohenpriesters;
- in Offb 11,2 den Vorhof des Tempels;
- und in Johannes 10,1.16 eben das Schafgehege.
Wenn also Josef und Maria schon rechtzeitig vor der Geburt des Kindes in Bethlehem wohnen und nach der Geburt nicht nur bis zur Darstellung im Tempel, 40 Tage danach (Lk 2,22), sondern auch noch als die Weisen aus dem Morgenland viele Monate später ankamen, in Bethlehem sind (Mt 2,1.7.16), dann passt die Vorstellung der Geburt von Jesus in einem Gehege (Schafstall) überhaupt nicht in den Zusammenhang. Viel einfacher ist die Vorstellung, dass Jesus in einem Haus bzw. in einem unteren Raum des Hauses, wo bei Kälte und regnerischem Wetter auch Haustiere Unterschlupf finden, zur Welt kommt und Maria ihn in eine sich dort befindliche Futterkrippe legt.

Abbildung 13 Die sogenannte Geburtsgrotte in der Geburtskirche, in welche die Pilger über eine Treppe hinabsteigen können (Foto: April 1986).
Seit dem 2. Jh. gibt es eine Tradition, dass Jesus in einer Felsgrotte, an die das Wohnhaus angebaut war, geboren sei. Doch auch dies passt in das Bild, das Jesus in dem Nebenraum eines Hauses geboren wurde – weil es im Hauptraum, den man Gästen anbieten würde, keinen Platz gab.
ANMERKUNG: Die Tatsache, dass die Hirten auf freiem Felde mit ihren Herden übernachten, lässt nicht auf das Vorhandensein von Tieren in den Häusern Bethlehems schließen. Dezember und Januar sind die niederschlagreichsten Monate des Jahres. Das sonst graue Land erstrahlt in frischem Grün und viele Hirten nutzen die zwar ungemütliche „Winterzeit“ und wandern mit ihren Herden über die näheren Winterweiden, während sie im Sommer wieder zu den weiter entfernt gelegenen Sommerweiden ziehen. Das Übernachten auf dem Felde weist eher auf eine Zeit von April bis November hin. Das Jesus mitten im Winter geboren wurde ist unsicher und eher unwahrscheinlich – siehe nächster Abschnitt: Der Zeitpunkt der Geburt von Jesus. Doch es bleibt dabei, niemand kann nach so langer Zeit mit Sicherheit den genauen Ort und den genauen Zeitpunkt für die Geburt von Jesus nennen.
Fragen / Aufgaben:
- Was ist das Besondere an dem kleinen Ort Bethlehem?
- Was könnte Josef empfunden haben beim Anblick und Einzug in seine Vaerstadt Bethlehem?
- Was schließen wir aus dem Umstand, dass Jesus im Vielzweckraum geboren wurde?
- Bewerte die Argumente, welche für die Geburt von Jesus in einem unteren Raum des Hauses sprechen.
- Hast du Informationen über die Umstände deiner Geburt?
1.7 Geburt von Jesus in Bethlehem
(Bibeltexte: Gal 4,4; Lk 2,7; Mt 1,25. 2,1; Hes 16,4.5)
1.7.1 Wann wurde Jesus geboren?
Jesus wurde geboren als „die Zeit (gr. χρόνος – chronos) erfüllt war.“ (Gal 4,4). Das konkrete Handeln Gottes wurde in unserer Geschichte offenbar. So gesehen ist es auffällig, dass im Neuen Testament wenig Wert auf konkrete Angaben zum Geburts- und Todesjahr gelegt wird. Thiede merkt an: „(…) in der Antike wurde Einzelheiten der Geburt, des Geburtsorts, der Kindheit und Jugend nicht als wesentliche Informationen betrachtet“ (Thiede 2006, 65). Die Ereignisse selbst stehen im Mittelpunkt der Berichterstattung. Es gibt jedoch eine Reihe von erwähnten Personen und anderer Details, die mehr Licht auf unsere Fragestellung werfen könnten. Diese sollen der Reihe nach untersucht werden.
Im Wesentlichen sind es fünf mögliche Schlüssel, die zum Geburtsjahr von Jesus führen könnten.
Der Tod des Herodes (des Großen)
Der Stern des Königs
Die Statthalterschaft des Quirinius
Die Einschreibung in Listen
Das Jahr des öffentlichen Auftretens von Jesus, minus ungefähr (knapp) dreißig Jahre
- Das Todesjahr des Herodes
Werner Papke kommt in seiner wenig beachteten Ausarbeitung („Der Stern des Messias“ 1995) zu dem Schluss, dass Jesus im Spätsommer des Jahres 2 v. Chr. geboren wurde. Wenn wir uns im Folgenden seinen Gedanken anschließen, soll deutlich werden, dass er seine Berechnungen plausibel begründet. In den gängigen Chronologien zum Leben Jesu wird das Jahr 4 v. Chr. als das Todesjahr des Herodes angegeben.
| Diese Berechnung beruht auf der Aussage des Josephus in seinen „Jüdischen Altertümern“, Herodes sei nicht lange vor dem jüdischen Passafest gestorben. In dem Zusammenhang berichtet er von vielen Ereignissen und Tätigkeiten des Herodes (geboren 74 v. Chr., König seit 37 v. Chr.) unter anderem, dass er zwei namhafte Priester verbrennen ließ, während in der Nacht eine Mondfinsternis stattfand. Diese (parzielle, kaum bemerkbare) Mondfinsternis fand in der Nacht vom 12 auf den 13 März (Julianisch) 4 v. Chr. statt. Von 4 v, Chr. bis 1 v. Chr. fand jedoch keine totale Mondfinsternis statt, außer der vom 9./10. Januar 1 v. Chr.. Sie ist demnach als diejenige zu betrachten, die vor dem Tod des Herodes eintrat, so dass Jesus im Jahre 2 v. Chr. noch zu Lebzeiten des Königs Herodes geboren wurde, wie Matthäus berichtet (Papke, 1995, 94-99 auszugsweise). |
In den Texten der Evangelien gibt es nur indirekte Hinweise zum Datum der Geburt von Jesus.
„Eins müssen wir allerdings feststellen: Keine Aussage von Lukas dem Arzt als Historiker konnte widerlegt werden“ (Hendriksen 1978, 141).
- Der Stern des Königs
Leider hat Herodes die Kenntnis über das „wann der Stern erschienen sei“ (Mt 2,7), nicht veröffentlicht. Die Weisen aus dem Osten haben höchstwahrscheinlich das Datum dieser Beobachtung in ihrem Heimatland weitererzählt oder sogar aufgezeichnet. In den letzten Jahrzehnten ist auch das Jahr 7 v. Chr. als das Geburtsjahr von Jesus favorisiert worden. Zu diesem Schluss kam man, weil es im Jahr 7 eine größere Planetenkonjunktion von Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische gegeben hat (Kroll. G. 1988, 65-66).
Diese Planetenkonjunktionstheorie (wie auch andere Konjuktionen um die Zeitenwende) widersprehen jedoch den Aussagen des Evangelisten Matthäus, der dreimal von einem Stern `αστόρ –ast¢r` spricht (Mt 2,2.9.10). Wir täten gut, diesem ausgebildeten Zöllner und Evangelisten mehr Kompetenz in der Astronomie zuzugestehen. Der Schluss, er könne nicht zwischen Stern und Planet unterscheiden ist vorschnell und im Kontext nicht haltbar.
Das Neue Testament erwähnt `αστέρες πλανέται –asteres plan¢tai` also Planeten und nennt sie „irrende Sterne“ (Judas 13). ‚Irrend‘ heißt, sie sind in ständiger Bewegung. Sie haben selbst keine Leuchtfähigkeit, sondern scheinen nur, wenn sie von einem Stern (Sonne) angestrahlt werden. Die oben genannte Planetenkonjunktion wiederholt sich im Laufe von Jahrhunderten – ist also kein so einmaliges Ereignis wie es in den Evangelien dargestellt wird. Da die Geburt (Menschwerdung) von Jesus jedoch einmalig ist, wäre die logische Folgerung, dass es sich bei dem Stern des Königs um ein einmaliges Ereigmis handelt. Das hieße auch, es kann durch astronomische Nachberechnungen nicht erfasst werden.
Das Jahr 7 v. Chr. als das Geburtsjahr von Jesus ist auch noch deswegen zu früh, weil der Beginn der Wirksamkeit von Jesus dann im Jahre 24 zu datieren wäre, doch zu diesem Zeitpunkt war Tiberius erst 10 Jahre im Amt. Nach Lukas 3,1 begann Johannes (Jesus kurze Zeit später) seinen Dienst jedoch im fünfzehnten Jahr des Tiberius. Tiberius trat seine Herrschaft am 19. August des Jahres 14 n. Chr. an.
- Die Zeit der Statthalterschaft des Quirinius
Der Evangelist Lukas liefert uns einige Angaben über die zeitlichen Umstände und Personen, welche im Zusammenhang der Geburt von Jesus bedeutend sind.
In Lukas 2,1-2 wird berichtet:
- Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung (gr. δόγμα – dogma)
vom Kaiser Augustus ausging, die ganze Ökumene (in Listen) einschreiben zu lassen. Diese Einschreibung (in Listen) war die erste während (der Zeit), da Kyrenius Statthalter von Syrien war.
Wüssten wir die Daten der Statthalterschaft des Quirinius, könnten wir das Geburtsjahr von Jesus leicht feststellen. Publius Sulpicius Quirinius (so sein vollständiger Name) wurde um das Jahr 45 v. Chr. in Lanuvium geboren, einer Stadt in der Nähe Roms. Seine Familie war wohlhabend, hatte aber weder Senatoren noch Magistrate hervorgebracht. Nach außerbiblischen Quellen nahm Quirinius in dem Jahrzehnt vor und dem Jahrzehnt nach der Zeitenwende eine hervorragende Stellung ein. Doch außer dem Evangelisten Lukas erwähnt niemand seine Statthalterschaft in Syrien zur Zeit der Geburt von Jesus. Wir kennen eine durchgehende Liste der Statthalter von Syrien für den Zeitraum 13/12 v. Chr. bis 6/7 n. Chr.. Nach diesen Angaben bleibt der Statthalterposten nur für den Zeitraum von Frühjahr 2 v. Chr. bis Herbst 2 v. Chr. unbesetzt. Könnte es sein, dass gerade in diesem Zeitraum Quirinius Statthalter von Syrien war und den von Saturninus begonnenen Zensus zu Ende geführt hatte? (Papke 1995, 99 – auszugsweise. Siehe auch Anhang – Quirinius, Statthalter von Syrien).
- Die Einschreibung in Listen
Kaiser Augustus regierte von 30 (31) v. Chr. – 14 n. Chr. (Andere Quellen: 27 v. Chr. bis 14 n. Chr.). Unter seiner Herrschaft erlebte das Römische Reich eine Festigung. Die verschiedenen Völker lebten in relativem Frieden. Zur Zeitenwende wurde das Wort Caesar = Kaiser als Beiname des Herrschers gebraucht. Erst später wurde „Kaiser“ zur Titulatur der römischen Herrscher. Im Jahre 27 v. Chr. erlangte er auf legalem Wege die Alleinherrschaft im römischen Reich, als ihn der Senat zum Princeps ernannte.
„Am 5. Februar des Jahres 2 v. Chr. wurde Augustus vom römischen Senat offiziell die höchste Auszeichnung des Staates verliehen: Augustus wurde zum Pater patriae ‚Vater des Vaterlandes’ ernannt, was den Höhepunkt in der politischen Laufbahn des Augustus bedeutete und ihm unumschränkte Macht im Römischen Reich einbrachte“ (Papke 1995, 98).
Das Jahr 2 v. Chr. war gleichzeitig auch das 25-jährige Jubiläum der Alleinherrschaft des Augustus. Dieses Jahr wurde dadurch auch mit Feiern im ganzen Reich begangen. Josephus spricht von einem Treueid, den Augustus etwa ein Jahr vor dem Tode des Herodes veranlasste. Und er ergänzt, dass 6000 Pharisäer den Treueid verweigerten, während die ganze jüdische Bevölkerung einen Eid ablegte, dem Kaiser treu zu sein (Josephus, Altertümer XVII 2,4). Sicher wissen wir über Pharisäer im Zeitraum vor 70 n. Chr.: eifrig im Studium und der Erkenntnis des Gesetzes, Glaube an die Auferstehung und Akzeptanz der Überlieferung der Ältesten. Josephus berichtet, dass Essener nie das Essen anderer anrühren (BJ II. 143f) – er sagt allerdings nichts dergleichen über Pharisäer aus (Sanders 1985, 188).
Das hier von dem Evangelisten Lukas gebrauchte Verb ,απογράφεσθαι – apografesthai – eingeschrieben werde` (in Listen) entspricht in etwa dem uns aus der römischen Geschichte wohl vertrauten „census civium“, der mit einer Volkszählung verglichen werden kann. Lukas schreibt, dass es die „erste“ Einschreibung war. Wohl die erste in ihrer Art, weil sie alle im Römischen Reich umfasste, denn auch vorher ist der römische Staat nicht ohne Steuern ausgekommen. Inschriftlich belegt ist ein „Zensus“ jeweils für das Jahr 9/8 v. Chr., 6/7 n. Chr. und 13/14 n. Chr. Der Zensus wurde gewöhnlich im Sieben-Jahresturnus durchgeführt. Dies würde einen Zensus im Jahre 2 v. Chr. bestätigen. Nach Gerhard Kroll umfasste der römische Provinzialzensus zwei administrative Akte:
– „Die `απόγραφη – apograf¢` – Aufschreibung und Aufnahme des Personalstandes, die Eintragung in die amtlichen Steuerlisten und die Erfassung des Grund und Hauseigentums“ (Kroll 1990, 12).
– „Die `αποτιμέσις – apotimesis` – Schätzung der Vermögenswerte und die Festlegung des jeweiligen Steuersolls.“
Der Evangelist Lukas verwendet nur den Begriff „apograf¢“ und präzisiert, dass es die „erste Einschreibung“ war. Die erste, in ihrer Art, weil sie das gesamte Römische Reich `πάσαν την οικουμένην – pasan t¢n oikoumen¢n` umfasste. Und er fügt hinzu, dass diese Einschreibung während der Statthalterschaft des Quirinius stattfand. Die Aussagen dieser genannten Quellen führen uns in das Jahr 2 v. Chr. für das angenommene Geburtsjahr von Jesus.
- Vom Zeitpunkt des Beginns der Wirksamkeit Jesu minus 30 Jahre
Es gibt jedoch noch einen weiteren Ansatz, um das Geburtsjahr von Jesus näher zu bestimmen. Dieser Ansatz ist so einfach und plausibel, dass er selten in Betracht gezogen wird. Rechnen wir vom Jahr des Beginns der Wirksamkeit von Johannes dem Täufer und von Jesus knapp 30 Jahre zurück (Lk 3,23), kommen wir in das Geburtsjahr von Jesus. Wenn Johannes im 15. Jahr des Tiberius Kaisers öffentlich auftrat, dann ist es die Zeit zwischen dem 19. August 28 und dem 18. August 29 n. Chr. Vielleicht hat Johannes schon im Herbst 28, spätestens jedoch im Frühjahr 29 seinen Dienst begonnen. Jesus kam etwa ein halbes Jahr später (entsprechend dem Altersunterschied zu Johannes) zu ihm an den Jordan. So könnte der Beginn des öffentlichen Wirkens von Jesus auf etwa Frühjahr bis Sommer des Jahres 29 datiert werden. Rechnen wir von Sommer 29 etwa 30 Jahre zurück, so kommen wir in den Sommer oder Spätsommer des Jahres 2 vor der Zeitenwende als dem Geburtsjahr von Jesus.
Unter zusätzlicher Einbeziehung der Daten der Wirksamkeit von Jesus so wie seines Todesjahres (3. April 33 unserer Zeitrechnung), scheint die Fixierung der Geburt von Jesus auf das Jahr 2 vor der Zeitenwende gut begründet zu sein.
| Die uns ganz vertraute Rechnung der Jahre „nach Christus“, genauer: „nach Christi Geburt“, geht auf den römischen Mönch Dionysius mit dem bescheidenen Namen Exigus, der „ganz Kleine“, zurück. Dionysius führte im Jahre 525 n. Chr. die „christliche Ära“ ein, wobei er die Geburt Jesu ins Jahr Null setzte und das folgende Jahr als das erste „nach der Menschwerdung des Herrn“ (ab incarnatione Domini) zählte.
Der englische Benediktiner-Mönch Beda (ca. 672-735), Venerabilis, der „Ehrwürdige“, genannt, hat das Jahr 1 „nach Menschwerdung“ Christi bei Dionysius als das Jahr der Geburt Jesu selbst missverstanden; seinem Einfluss ist es zu verdanken, dass seitdem irrtümlich ein Jahr weniger gerechnet wird; das Jahr 1999 n. Chr. ist also eigentlich das Jahr 2000 n. Chr. Für die Zeitenwende gelten demnach folgende Entsprechungen: Das Jahr 2 v. Chr. entspricht dem Jahr „Null“ des Dionysius, das Jahr 1 v. Chr. entspricht dem Jahr 1 des Dionysius, das Jahr 1 n. Chr. entspricht dem Jahr 2 des Dionysius. (Beachte: auf das Jahr 1 v. Chr. folgt das Jahr 1 n. Chr.; es gibt kein Jahr „0“ in der seit Beda üblichen Bezeichnungsweise.) Dieser bescheidene Mönch hat bezüglich des Geburts-Jahres des Erlösers sich nicht, wie allgemein zu lesen ist geirrt, sondern im Gegenteil genau richtig gerechnet! (Papke, 1995, 93). |
1.7.2 Tabelle zum möglichen Datum der Geburt Christi
nach Lk 3,1 und 3,23
Zunächst müssen wir beachten, dass es kein Jahr 0 (im Sinne von 12 Monate-Dauer) gibt, wie der Mönch Dionisius in seinem Kalender festgelegt hatte. Null bildet de facto eine Linie zwischen dem Jahr eins vor und dem Jahr eins nach unserer Zeitrechnung.
| Spätsommer 2 v. – 1 v. | Das erste Lebensjahr (Darstellung im Tempel – Lk 2,22ff; Besuch der Weisen – Mt 2,1-12; Flucht nach Ägypten (Mt 2,13ff;, Rückkehr und Niederlassung in Nazaret – Mt 2,22-23) |
| 1 v. – 1 n. | Das zweite Lebensjahr (Er nahm zu an Alter, Weisheit und Gnade – Lk 2,52) |
| 1 n. – 2 n. | Das dritte Lebensjahr (Er nahm zu an Alter, Weisheit und Gnade) |
| 2 n. – 3 n. | Das vierte Lebensjahr (Er nahm zu an Alter, Weisheit und Gnade) |
| 3 n. – 4 n. | Das fünfte Lebensjahr (Er nahm zu an Alter, Weisheit und Gnade) |
| 4 n. – 5 n. | Das sechste Lebensjahr (Er nahm zu an Alter, Weisheit und Gnade) |
| 5 n. – 6 n. | Das siebte Lebensjahr (Schulzeit – Synagogenbesuch) |
| 6 n. -7 n. | Das achte Lebensjahr (Schulzeit – Synagogenbesuch) |
| 7 n. – 8 n. | Das neute Lebensjahr (Schulzeit – Synagogenbesuch) |
| 8 n. – 9 n. | Das zehnte Lebensjahr (Schulzeit – Synagogenbesuch) |
| 9 n. – 10 n. | Das elfte Lebensjahr (Schulzeit – Synagogenbesuch) |
| 10 n. – 11 n. | Das 12. Lebensjahr (Jesus bleibt drei Tage allein im Tempel in Jerusalem – Lk 2,41ff) |
| 11 n. – 12 n. | Das 13. Lebensjahr (als 13-jähriger übernimmt Jesus mehr Verantwortung) |
| 12 n. – 13 n. | Das 14. Lebensjahr |
| 13 n. – 14 n. | Das 15. Lebensjahr (Berufsausbildung) |
| 14 n. – 15 n. | Das 16. Lebensjahr (Berufsausbildung) |
| 15 n. – 16 n. | Das 17. Lebensjahr (Berufsausbildung) |
| 16 n. – 17 n. | Das 18. Lebensjahr (Beruf/Handwerk) |
| 17 n. – 18 n. | Das 19. Lebensjahr (Beruf/Handwerk) |
| 18 n. – 19 n. | Das 20. Lebensjahr (Beruf/Handwerk) |
| 19 n. – 20 n. | Das 21. Lebensjahr (Berufsjahre) |
| 20 n. – 21 n. | Das 22. Lebensjahr (Beruf/Handwerk) |
| 21 n. – 22 n. | Das 23. Lebensjahr (Beruf/Handwerk) |
| 22 n. – 23 n. | Das 24. Lebensjahr (Beruf/Handwerk) |
| 23 n. – 24 n. | Das 25. Lebensjahr (Beruf/Handwerk) |
| 24 n. – 25 n. | Das 26. Lebensjahr (Verantwortung als Erstgeborener in Familie und Berufsleben) |
| 25 n. – 26 n. | Das 27. Lebensjahr (Verantwortung als Erstgeborener in Familie und Berufsleben) |
| 26 n. – 27 n. | Das 28. Lebensjahr (Verantwortung als Erstgeborener in Familie und Berufsleben) |
| 27 n. – 28 n. | Das 29. Lebensjahr (Verantwortung als Erstgeborener in Familie und Berufsleben) |
| 28 n. – 29 n. | Das 30. Lebensjahr |
| 29 n. (Sommer) | Jesus ist knapp 30 Jahre alt (Er lässt sich von Johannes im Jordan taufen, siegt in den Versuchungen in der Wüste, zieht anschließend von Nazaret nach Kapernaum um und beginnt mit seinem Dienst – (Lk 3,23; Mt 4,17). |
Dass wir heute die Geburt von Jesus am 24./25. Dezember feiern, ist eine Tradition der Westkirche. In Palästina wurde das Weihnachtsfest am 24./25. Dezember erst zu Beginn des 6. Jahrhunderts auf Drängen der Westkirche eingeführt. Das Kommen von Jesus in diese Welt ist zentraler Inhalt der Evangeliumsbotschaft, die ununterbrochen verkündigt werden soll. Doch tun wir gut, wenn wir uns an einem bestimmten Tag im Jahr an die Geburt von Jesus Christus im Besonderen erinnern.
1.7.3 Die Umstände der Geburt von Jesus
Die Geburt eines Kindes, speziell des ersten Sohnes, war ein freudiges, sehr bedeutsames Ereignis im Leben der orientalischen Familie. Die Geburt selbst war meist nicht so schwierig – die heute üblichen Zivilisationskrankheiten trugen hoffentlich nicht zur Erschwerung bei. Nur wenige Texte der Bibel machen Detailangaben über die Geburt eines Kindes. Wir lesen im Buch des Propheten Hesekiel von einigen Details, die nach der Geburt nicht beachtet wurden. Aus dieser recht leidvollen Beschreibung geht dennoch hervor, was das normale war.
Bei deiner Geburt war es so: Am Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten; auch hat man dich nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber würdest, dich nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Denn niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich, dass er etwas von all dem an dir getan hätte, sondern du wurdest aufs Feld geworfen. So verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest. (Hes 16,4-5).
Dennoch beschreibt der Hesekiel-Text die Details, die bei der Geburt zu beachten waren.
Was für ein Kontrast zum liebevollen Verhalten von Josef und Maria gegenüber ihrem Kind! Wir können also annehmen, dass nach der Geburt von Jesus:
- Die Nabelschnur behutsam abgetrannt wurde,
- Das Neugeborene mit oder im Wasser gebadet wurde,
- Danach (wohl zur Desinfektion) mit Salz abgerieben,
- Danach in Windeln gewickelt,
- Anschließend in eine mit Stroh und weichen Tüchern gepolsterte Futterkrippe gelegt.
- Beide, Maria und Josef wachten über dem Kind.
Nach 1Mose 35,17; 38,28, 2Mose 1,15-22 und 1Sam 4,20 waren immer andere weibliche Personen bei der Geburt als Hilfe anwesend. Dies waren Freundinnen der Mutter oder ältere Verwandte. Auch gab es wohl einen Geburtsstuhl 2Mose 1,16 wörtlich: „(…) wenn ihr sie auf dem Geburtsstuhl al ha‚obnajim seht (…)“ Über die Anwesenheit von anderen Frauen wird in den biblischen Texten nichts erwähnt (…) dennoch wäre es sehr außergewöhnlich, wenn nicht Frauen der erweiterten Sippe – auch bei sehr losen Beziehungen – hilfreich einer Erstgebärenden zur Seite gestanden hätten. Bei den Windeln handelt es sich um lange Stoffstreife n, mit den üblicher Weise die Glieder der Säuglinge festgebunden werden, damit sie „gerade“ wachsen.
So ist Jesus, wie auch viele andere Kinder in einem der unteren Wirtschaftsräume des Hauses zur Welt gekommen und weil es für sie oben in der guten Stube keinen Platz gab, legten sie ihn in Windeln gewickelt in die dort befindliche Futterkrippe.
Fragen / Aufgaben:
- Was ist dir über den Zeitpunkt, bzw. das Jahr der Geburt von Jesus bekannt? Wie kamen die Forscher zu den unterschiedlichen Ergebnissen?
- Ist Weihnachten (24/25. Dezember) wirklich der Geburtstag von Jesus?
- Suche auf einer Karte Bethlehem (Mt 2,1), beschreibe die geographische Lage der Stadt. Wo in der Bibel wird Bethlehem zum ersten Mal erwähnt? Welcher Prophet sagt etwas über den Geburtsort und den Messias voraus? Als wessen Stadt wird Bethlehem bezeichnet?
- Wenn du die Möglichkeit hättest in Bethlehem einen Tag zu verbringen, was würdest du dort machen?
- Kann es sein, dass Maria und Josef gerne Nazaret verließen und die Geburt im fernen Bethlehem ihnen eigentlich willkommen war? Wie war Marias Situation in Nazaret?
- Was fällt bei der Geburt von Jesus auf?
- In welcher Weise war die „Fülle der Zeit“ gekommen, als Jesus in Bethlehem geboren wurde? Welche politischen, kulturellen und religiösen Faktoren könnten es gewesen sein?
1.8 Gott offenbart sich den Hirten
(Bibeltexte: Lk 2,8-20; 2Kön 7,9)
1.8.1 Die Frohe Botschaft der Engel an die Hirten
Nicht an den Palästen der Herrscher und Großen dieser Welt offenbart sich Gott, sondern bei den Geringen, bei den Unbeachteten. Die Geschichte mit den Hirten berichtet uns nur der Evangelist Lukas.

Abbildung 14 Die sogenannten Hirtenfelder in der Umgebung von Bethlehem. Die Tafel weist auf Überreste einer byzantinischen Kirche hin (Foto: April 1986).
,„Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde.“ (Lk 2,8 Elf.).
Hirten finden in Gottes Heilsgeschichte eine besondere Beachtung. Abel, die Patriarchen Abraham, Isaak, Jakob mit seinen Söhnen, Mose, David, Amos waren Hirten. Ja, selbst Jesus bezeichnet sich als den „guten Hirten“ (Joh 10,1). Gott scheint eine besondere Beziehung zu den Hirten zu haben.
In Palästina mussten Hirten besonders in der Nacht Wache halten, denn es gab in dieser Region wilde, reißende Tiere: Wölfe, Hyänen, Leoparden, Löwen und sogar Bären. Entweder trieb man die Schafe für die Nacht in die Gehege (Pferche) oder auch in die Höhlen, wo sie leichter zu bewachen und zu beschützen waren. Dass die Herde und die Hirten nachts draußen auf freiem Felde waren, deutet evtl. darauf hin, dass keine winterlichen Temperaturen herrschten. Der Evangelist Lukas schreibt: „Und ein Engel des Herrn stellte sich zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie.“ Es fällt hier gleich auf, dass der Engel des Herrn sich zu ihnen stellt. Paul Schüle: „Meine frühere Vorstellung, dass er über ihnen schwebte, ist damit verflogen!“ Die Reaktion der ansonsten furchtlosen Hirten ist große Furcht. Die Herrlichkeit des Herrn ist oft mit Licht, Feuer und wunderschönen Farben verbunden (siehe 2Mose 24,17; Mt 17,2; Offb 4,2ff). Durch die Botschaft des Engels werden uns ewige Wahrheiten von Gott offenbart.
Die Einleitung des Engels: „Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird“, ist zweiteilig. Die Hirten sollen aus ihrer Furcht heraus und in die Freude hinein geführt werden. Den Hirten wird „gute Nachricht” verkündigt (Jes 52,7). Höchstwahrscheinlich sprach der Engel mit den Hirten Hebräisch. Im Griechischen verband man damals mit dem Verb euangeli, zomai – euangelizomai die Verkündigung guter Nachricht; im griechisch-römischen Kontext auch die Bekanntgabe der Feiern des Kaiserkults – besonders an dessen Geburtstag.
Der Inhalt der Freude ist dreiteilig und wird am Ende auch noch lokalisiert.
- „Denn euch ist heute der Retter (swth,r –söt¢r) geboren (1Mose 3,15),
- welcher ist (der) Gesalbte (cristo,j – christos) (Jes 61,1),
- (der) Herr (ku,rioj – kyrios) (2Sam 7,12-14; Ps 110,1; Mt 22,42-44) in der Stadt Davids.“
Man sollte die Bildung bzw. Kenntnis der sonst einfachen Hirten-Menschen über Gott und seine Geschichte in Israel nicht unterschätzen. Wir werden in dem Zusammenhang an all die Hirten in der Geschichte Israels erinnert. Gerade diese standen Gott oft näher als die typischen Stadtbewohner. So ist es nicht verwunderlich, dass der Engel ihnen solche theologischen Inhalte vermitteln kann und sie diese sofort begreifen.
Die Botschaft des Engels lautete: „Und das ist für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind (einen Säugling) finden in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.“ (Lk 2,12) Begriff `βρέφος – brefos` bezeichnet entweder ein Neugeborenes oder auch ein noch nicht geborenes Kind im Mutterleib (1Petr 2,2; Lk 1,41.44).
-

Abbildung 15 Das Zeichen der Krippe bekamen die Hirten vom Engel, damit sie das Kind Identifizieren konnten. Anscheinend war es bis dahin nicht übliche Praxis, Neugeborene in Futterkrippen zu legen. Doch die Idee ist genial – das Leben der Welt liegt in einer Futterkrippe.
Der Engel macht die Hirten auf zwei Äußerlichkeiten aufmerksam: das Kind ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Windeln werden im Alten Testament nur zwei Mal erwähnt (Hiob 38,9: im übertragenen Sinne auf die Wolken des Himmels bezogen und in Hesekiel 16,4-5 wird indirekt die gewöhnliche Praxis im Umgang mit Neugeborenen nach der Geburt beschrieben).
Das Zeichen der Krippe zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich. Die Krippe selbst wird in der Bibel nur selten erwähnt (hebr. ¢büs, gr. φάτνη – fatn¢). Im Alten Testament wird die Krippe nur vier Mal genannt (Hiob 6,5: LXX; 39,9; Spr 14,4; Jes 1,3). Die bekannteste Stelle ist in Jesaja 1,3: „Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, (…).“ Dies ist der einzige sehr indirekte Hinweis aus dem Alten Testament, aufgrund dessen angenommen wird, dass bei der Geburt von Jesus Ochsen und Esel anwesend waren. Im NT finden wir keinen Hinweis auf die so beliebten Figuren in Weihnachtsanspielen. Im Neuen Testament ist Lukas der Einzige, der außer bei der Geburt von Jesus (drei Mal: 2,7.12.16) noch in Kapitel 13,15 eine futterkrippe erwähnt. Maria und Josef legen das neugeborene Jesus-Kind in eine Futterkrippe. Dies war eventuell nicht die gängigste und beliebteste Praxis gewesen. Mit Nachdruck betont der Engel, dass die Krippe „das Zeichen“ sei (gr. σημείον s¢meion),
m den Retter zu identifizieren. Ein Zeichen steht nicht für sich da, sondern weist auf etwas Höheres oder jemand Höheren hin. Anhand dieses (besonderen) Zeichens konnten die Hirten, nachdem sie das Kind in einem der Häuser Bethlehems fanden, genau identifizieren.
Ludwig Schneller merkt an, dass er diese Praxis in Bethlehem viel später bei den Arabern Ende des 19. Jahrhunderts oft beobachtete – so mag sie eine Fortsetzung dessen sein, was damals mit Jesus noch etwas Besonderes war.
Der Hinweis des Engels auf die Windeln dagegen, könnte nicht als Zeichen (etwas Ungewöhnliches) bezeichnet werden, denn diese werden als gewöhnlicher Bestandteil bei Neugeborenen in Hesekiel 16,4 beschrieben (siehe weiter oben). Die Futterkrippe wird im Gegensatz zu den Windeln immer nur als Versorgungseinrichtung für das Vieh in Verbindung gebracht. Hier in der Krippe also liegt das Leben der Welt. Das „Lamm” beginnt seinen Weg in der Krippe aus Holz und beendet ihn am Holz-Kreuz auf Golgatha. Was für ein Zeichen!
Und nun kommt eine weitere Überraschung. Plötzlich ist bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen (πλήθος στρατας – pl¢thos stratias), die lobsingen Gott: „Herrlichkeit Gott in den Höhen und Frieden auf Erden bei den Menschen des (seines) Wohlgefallens.“ (Lk 2,14). Nach welcher Melodie und in welcher Stimmlage sie wohl singen und so ganz ohne Instrumentalbegleitung? Doch eines verstehen wir sofort: Hier begegnet uns Lobpreis auf höchstem Niveau. Was für eine Anbetung angesichts solcher schlichter Umstände! Die Engel selbst waren wohl zu keinem Zeitpunkt der Weltgeschichte so gespannt und erstaunt.
- Zu beachten ist in diesem Satz der Genitiv (des Wohlgefallens), welcher im Griechischen untypisch ist und darum in einigen Handschriften nicht überliefert wurde. Hier geht es um ein kleines „s” = also ob hier ευδοκία eudokia oder ευδοκίας eudokias zu lesen ist. Dieses „s” macht den Unterschied bei den Übersetzungen und führt zu verschiedenen Interpretationen.
Hier die Versionen der Übersetzer des Textes in Lukas 2,14:
Griechisch ALTE LUTHER
LUTHER 1984/2017
ALTE ELBERFELDER
ELBERFELDER 1987
EINHEITSÜBERSETZUNG
SCHLACHTER 2000
NGÜ
HfA
Gute Nachricht
„δόξα έν υψίστοις θεώ καί έπί γής είρήνη έν άνθρώποις εύδοκίας.“ „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“
„Herrlichkeit Gott in der Höhe, und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen!“
„Herrlichkeit Gott in der Höhe, und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens!“
„Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.“
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen!“
»Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe, und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht.«
»Ehre sei Gott im Himme! Denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu.«
»Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel; denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt!«
Dieses Beispiel macht deutlich, wie wichtig es für das sorgfältige Bibelstudium sein kann, verschiedene Übersetzungen heranzuziehen und nach Möglichkeit auch den griechischen Text beachten.
Die ältere Lutherübersetzung formuliert: „Frieden auf Erden und an den Menschen ein Wohlgefallen.“ Doch es gab schon damals keinen Frieden auf Erden. Der Friede Gottes kann sich nur auf die Menschen beziehen, die seines (Gottes) Wohlgefallens sind. Es geht um den Frieden, den Jesus persönlich verkörpert und den er seinen Jüngern später gegeben, bzw. gelassen hatte (Eph 2,14; Joh 14,27) und es ist auch der Friede, der nur auf die Menschen kommt, welche die Botschaft Gottes annehmen und durch Vergebung ihrer Sünden mit Gott versöhnt werden (Mk 5,34; Lk 7,50; 10,5-6; siehe auch Röm 5,1.2; 2Kor 5,18-21). Trotz aller bedenklicher Gemeindeerfahrungen: je mehr Menschen mit Jesus Frieden vor Gott und Mitmenschen finden, desto mehr haben wir auch Frieden in den Strukturen dieser Welt.1.8.2 Der Besuch der Hirten in Bethlehem
Der Evangelist Lukas schreibt weiter:
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte (gr. τήμα –r¢ma – den Ausspruch, das Gesagte) sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind (βρέφος – brefos – Säugling) in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort (ρήματος –r¢matos – den Ausspruch, das Gesagte) aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. (Lk 2,15-18).
Dies ist immer ein kritischer Moment. Was die Hirten tun sollen ist klar – Gottes Auftrag ist oft zu klar! Doch jetzt kommt die Umsetzung, die Disziplin, der Gehorsam! Wie nach einer Predigt kommt nach dem Hören das Tun! Lukas drückt durch den Gebrauch einer griechischen Verbform die Spannung aus: `ευρήσετε –eur¢sete – ihr werdet finden`. Die Hirten können gar nicht anders als alles liegen zu lassen, um das Gehörte zu prüfen. Schnell machen sie sich auf nach Bethlehem um nach einem Neugeborenen zu suchen und sie finden alles so vor, wie ihnen der Engel gesagt hatte. Das kleine Städtchen Bethlehem kommt in dieser Nacht in freudige Bewegung. Diese Männer haben sich vor nichts zurückschrecken lassen – weder vor fragenden Blicken der einwohner Bethlehems, noch vor der vermeintlichen Ruhestörung bei einer jungen Frau kurz nach der Entbindung.
Auch Maria wird durch den Besuch und die gute Nachricht der Hirten erneut in Staunen versetzt. Von ihr heißt: „Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.“ (Lk 2,19). Sie sammelt sozusagen alle Informationen und bekommt immer mehr Einblick in den Heilsplan Gottes mit seinem Sohn. Wir wissen wenig von dem Glaubensleben Marias. Doch nach Johannes 2,5; Apostelgeschichte 1,14 können wir erkennen, dass sie von der Mutter zur Gläubigen heranwuchs. Wenn Maria hier auch an erster Stelle noch vor ihrem Mann genannt wird, so ist es auch für Josef eine weitere Bestätigung dass Gott seine Verheißung erfüllt hat (Mt 1,20-21). Und er bekommt auch die Anerkennung für seine treue Fürsorge und disziplinierte Zurückhaltung in der Ehe (Mt 1,24-25).
Es wird schon deutlich, dass sich diese Ereignisse damals in jener Gegend rasch herumgesprochen haben. Der Text erweckt den Eindruck, dass die Hirten noch in der Nacht mit der Ausbreitung dieser `Frohen Botschaft` begannen. Die Reaktionen der Menschen waren: Staunen und Verwunderung.
Die Hirten – kräftige, mutige, gestandene Männer reden begeistert von Engeln, von einem himmlischen Chor und einem Säugling in der Krippe. Sie lobpreisen Gott, das ist wahre Anbetung, die angemessene Antwort auf die Kundgebung und das Reden Gottes.
Fragen /Aufgaben:
1. Siehst du einen Grund, warum Gott die Geburt seines Sohnes zuerst den Hirten verkündigt hat?
- 2Kön 7,9 wird von der guten Nachricht zweier Leprakranker berichtet. Sie können nicht anders (…), sie müssen die Botschaft verkünden! Gibt es diese Dringlichkeit auch heute noch?
- Wie nimmst du den Lobpreis der Engel auf? Was könnte daraus für deinen Alltag folgen?
- Lerne den Lobeshymnus der Engel aus Lk 2,14 auswendig und zwar nach der revidierten Lutherübersetzung.
- Was fällt uns bei Maria besonders auf?
- Was ist mit Josef? Wie oder was konnte er in all diesem Geschehen empfunden haben?
- Was können wir aus der Reaktion der Hirten lernen (Lk 2,16-20)?
1.9 Die Beschneidung und Namensgebung
1.9.1 Die Beschneidung von Jesus am achten Tag
Der Evangelist Lukas schreibt: „Und als acht Tage um waren und er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war.“ (Lk 2,21). Für Jesus gab es keine Sonderbehandlung, er wurde unter das Gesetz gestellt, wie es im Judentum seit etwa 2 Jahrtausende Tradition war. Dies bestätigt später auch der Apostel Paulus: (…) als aber die Fülle der Zeit (το πλήρωμα του χρόνου – to pl¢röma tou chronou) kam, sandte Gott seinen Sohn aus, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. (Gal 4,4).
Damit hatte Jesus alle Pflichten des mosaischen Gesetzes zu erfüllen. Hierzu gehörte die rituelle Beschneidung als Zeichen der Zugehörigkeit zum Bund Gottes mit Abraham. Dies war zugleich ein unterscheidbares körperliches Merkmal aller männlichen Glieder des Volkes Israel. Im Nahen Osten ist die männliche Beschneidung bei Juden (am 8.Tag), Christen (kurz nach der Geburt) und Muslimen – ohne koranisches Gebot – (im Alter von 7-10 Jahren) verbreitet.
Die Beschneidung am achten Tag hat ihren Ursprung in Abrahams Handlungen nach dem Bundesschluss (1Mose 17,11) und wurde im Gesetz am Sinai verankert (3Mose 12,3). Bei der Beschneidung wird die Vorhaut des männlichen Gliedes entfernt.
Wenn der entsprechende achte Tag auf einen Sabbat fiel, dann stand Gebot gegen Gebot (Joh 7,21-23). In diesem Fall stand das Gebot “am achten Tag soll alles Männliche beschnitten werden”, dem Gebot “am Sabbattag sollst du keinerlei Arbeit tun”, entgegen. Bei Einhaltung des Beschneidungsgebotes übertraten die Juden das Sabbatgebot (natürlich nur dem Buchstaben nach).
Im Neuen Testament bekommt die Beschneidung eine tiefe, geistliche Bedeutung. Denn in Christus Jesus ist die natürliche Beschneidung belanglos und nutzlos geworden (Gal 6,15), Es geht nun
- um die Beschneidung des Herzens (Röm 2,29),
- oder die Beschneidung durch Christus (Kol 2,11).
Nach dem Beschluss der Apostel und Ältesten in Jerusalem im Jahre 48 n.Chr., werden die Heidenchristen befreit von der alttestamentlichen Beschneidungsvorschrift und somit auch von allen anderen rituellen Vorschriften (Apg 15,1-6; 19f). Zur Beschneidung heute siehe Anhänge.
1.9.2 Die Namensgebung von Jesus
In alttestamentlicher Zeit und auch zur Zeit von Jesus fiel die Namensgebung bei Knaben mit der Beschneidung am achten Tag zusammen (Lk 1,59; 2,21; 1Mose 21,1ff). Die Namen hatten in der Regel eine Bedeutung. Deshalb wird er auch schon in der himmlischen Geburtsankündigung erwähnt. In Lukas 1,26 erscheint der Engel Gabriel der Maria und verkündet ihr die Geburt eines Sohnes an, den sie ‚Jesus‘ nennen soll.
Die Herkunft des Namens Jehoschua und der abgeleiteten Form Jeschua ist nicht endgültig geklärt. Ältere Lexika der hebräischen Sprache weisen auf eine mögliche Abstammung aus der Zusammensetzung von J H W (Kurzform von JHWH, dem Gottesnamen der hebräischen Bibel) und schua΄ („edel“, „freigiebig“, „vornehm sein“) hin oder erkennen eine Ableitung aus dem Verb jascha΄ („retten“) wie in dem Namen Hosche΄a. Für eine Herleitung aus der Wurzel „retten, befreien“ spricht auch eine Aussage des Matthäusevangeliums zur Bedeutung des Namens: Jesus. Dort heißt es in Mt 1,21 ELB: „und Du sollst seinen Namen Jesus nennen; denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden.“
Hier eine Aufstellung der verschiedenen Variationen dieses Namens
| Sprache | Schreibweise(n) |
| Masoretischer Text | יְהוֹשׁוּעַ; יְהוֹשֻׁעַ (lehöschü ±a); יֵשׁוּעַ (l¢schü΄a) |
| Syrische Versionen | Jeschua |
| Septuaginta und Neues Testament griechisch (russisch) | Ιησους – I¢sous (I¢süs); Ωσηε (Ös¢e);[1] Ιασων (Iasön) Иисус |
| Vulgata | Iosue; Iesus |
| Deutsche Übersetzungen | Josua; Jesua; Jesus |
| Englische Übersetzungen | Joshua; Jehoshua; Jesus |
Gottes Auftrag für Jesus war die Rettung der Menschheit von ihren Sünden. In diesem Fall wurden sowohl Maria als auch Josef beauftragt, ihrem Sohn diesen Namen zu geben. Der Evangelist Lukas unterstreicht außerdem die Tatsache, dass der Name gegeben wurde, bevor Jesus im Mutterleib empfangen wurde (Lk 2,21).
Der Name Jesus kommt schon im Alten Testament vor und mehrere Menschen tragen ihn auch zur Zeit des Neuen Testamentes (Jesus – Barabbas Mt 27,16-17, Bar Jesus Apg 13,6-12, Jesus – Justus Kol 4,11).
Eine Namensgebung hatte immer weit reichende Bedeutung. Wir erinnern uns, dass Jesus selbst seinen Jüngern Zunamen oder Beinamen gegeben hat. Er legte damit in deren Leben ein bestimmtes Konzept hinein (Joh 1,40ff; Mk 3,16). An diese Praxis lehnten sich auch die Apostel an (Apg 4,36).
Jesus spricht nicht nur von den Namen derer, die im Himmel angeschrieben werden (Lk 10,20), sondern auch davon, dass diese einen neuen Namen bekommen werden (Offb 2,17; 3,12). Es entsteht der Eindruck, dass im Himmel jeder einen individuellen Namen tragen wird, der in völliger Übereinstimmung mit der jeweiligen Person sein wird.
Fragen / Aufgaben:
- Auf welche Anordnung geht das Ritual der Beschneidung am achten Tag zurück? Welchen geistlichen Sinn wird der Beschneidung im Neuen Testament zugemessen? Siehe: Kol 2,11; Phil 3,3; Gal 5,6; Gal 6,15; 1Kor 7,19; Röm 2,25-29.
- Was bedeutet der Name ‚Jesus‘? In welcher Weise war er wirklich das Programm Gottes?
- Legst du Wert auf die Bedeutung der Namen, deines Namens, heute? Warum gibt man den Menschen oft noch einen Beinamen?
- Weißt du, dass dein Name im Himmel bekannt ist und es für dich einen neuen Namen gibt im Himmel? Siehe Offb 2,17 und 3,5.
1.10 Darstellung von Jesus im Tempel
(Bibeltexte: Lk 2,22-40; 2Mose 13,1-8. 12-16; 4Mose 3,39-51; 18,5-7)
1.10.1 Reinigungsopfer der Maria
Jüdische Familien hatten drei Pflichten nach der Geburt des Erstgeborenen zu beachten:
- Beschneidung und die damit verbundene Namensgebung
- Darstellung / Auslösung im Tempel
- Reinigungsopfer der Mutter (nach 40 Tagen für Söhne und 80 Tagen für Mädchen).
Der Evangelist Lukas schreibt dazu: „Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen,
wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn (2. Mose 13,2; 13,15): »Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen«, und um das Opfer arzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn: »ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben« (3. Mose 12,6-8). Josef erfüllt alle drei Pflichten und bringt mit Maria 40 Tage nach der Geburt das Kind Jesus in den Tempel. Hier stellen sie ihren Erstgeborenen dem Herrn dar und bringen das Brandopfer und Sündopfer, wie es Gott im Gesetz durch Mose angeordnet hatte (3Mose 12,1-8)..

Abbildung 16 Modell des Herodianischen Tempels in Jerusalem zur Zeit Jesu (Foto: April 1986).
Diese Vorschrift hatte ihre Wurzel zunächst in der wunderbaren Befreiung Israels aus der ägyptischen Knechtschaft (2Mose 13,1-8). Dort wurde die männliche Erstgeburt bei den Israeliten durch das Blut eines Lammes, mit dem die Türpfosten angestrichen wurden, vom Tod bewahrt, während alle Erstgeborenen der Ägypter starben. Später in der Wüste Sinai hatte Gott anstelle aller Erstgeborener in Israel den gesamten Stamm Levi für sich ausgesondert. Dabei wurde bei der Zählung der Erstgeburten unter den elf Stämmen Israels 22273 männliche Erstgeburten (ab einem Monat) gezählt. Dies ergab einen Überhang von 273 männliche Personen im Vergleich zur Zahl der Leviten welche 22000 (ab einem Monat) zählten. Die restlichen 273 mussten nun mit einer Zahlung von 5 Schekeln ausgelöst werden. Gott sagte, dass alle Erstgeburt sein Eigentum ist. Dieser Anspruch gründete sich auf Jakobs Erstgeburtsrecht, nachdem Esau seine Erstgeburt verkaufte. So wurde Jakob der von Gott begnadete und geliebte Stammvater und mit ihm wurde das gesamte Volk Israel gesegnet. Vor Pharao bekennt und bezeichnet Gott das gesamte Volk Israel als seinen erstgeborenen Sohn: „Israel ist mein erstgeborener Sohn.” (2Mose 4,22; Hos 11,1; Mt 2,14). Im Neuen Bund sind alle an Christus Gläubigen Erstgeborene, wobei Christus selbst der Erstgeborene und auch Einziggeborene vom Vater ist (Joh 1,18; Hebr 1,6; 12,23). Weitere Hinweise zum Recht des Erstgeborenen finden wir in 5Mose 21,16ff.
Zum Brandopfer benötigten Maria und Josef ein Lamm oder wenn sie nicht genug Geld hatten auch eine Taube oder Turteltaube (3Mose 12,6-8) und für das Sündopfer eine Taube. Die Turteltaube ist ein Zugvogel (Jer 8,7). Opfertauben konnten im Tempel gekauft werden (Mt 21,12). Der Evangelist Lukas schreibt nicht, was für ein Opfer Josef und Maria dem Herrn dargebracht haben. Auch hier wird wieder unterstrichen, dass Jesus unter das Gesetz gestellt wurde (Gal 4,4). Weiter fällt auf, dass Josef alle seine Vaterpflichten vorbildlich erfüllt (wohl wissend, dass er nur der Adoptivvater ist).
Der Erlöser der Welt wird „ausgelöst”!
1.10.2 Lobpreis Simeons „Nunc dimittis”
(Bibeltexte: Lk 2,25-35; Jes 40,1; 39,13)
Simeon war gerecht, gottesfürchtig und er wartete auf den Trost für Israel. Der Name Simeon hat mit dem hebr. „hören” zu tun. Auffällig dann, dass er die Stimme des Heiligen Geistes gehört und verstanden hatte, der sagte:
Du wirst den Tod nicht schmecken, bevor du den Christus des Herrn gesehen hast (Lk 2,26).
Er als „Laie” hatte gelernt auf die Stimme des Geistes zu hören. Dieser Geist Gottes regt ihn an, in den Tempel zu gehen und gerade in dieser Zeit befinden sich Josef und Maria mit dem Jesuskind im Tempel. Nachdem er Jesus auf die Arme nahm, spricht er, bzw. lobpreist er Gott:
Nun entlässt du, Herr, deinen Diener (Sklaven) gemäß deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, (…). (Lk 2,29).
In der Prophetie Simeons wird die Dimension und das Konzept des Dienstes von Jesus verdeutlicht: alle Völker sind in diese Rettung eingeschlossen.
(…) das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. (Lk 2,31.32).
An dieser Stelle darf die alttestamentliche Universalität des Heilsangebots Gottes beleuchtet werden. So lesen wir im Jesajabuch:
Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. (Jes 49,6).
Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst; und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen um des HERRN willen, deines Gottes, und wegen des Heiligen Israels. Denn er hat dich herrlich gemacht. (Jes 55,5).
So spricht der HERR: Wahret das Recht und übt Gerechtigkeit! Denn mein Heil ist nahe, dass es kommt, und meine Gerechtigkeit, dass sie geoffenbart wird.
Glücklich der Mensch, der dies tut, und das Menschenkind, das daran festhält: der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und seine Hand davor bewahrt, irgend etwas Böses zu tun!
Und der Sohn der Fremde, der sich dem HERRN angeschlossen hat, soll nicht sagen: Der HERR wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene sage nicht: Siehe, ich bin ein dürrer Baum!
Denn so spricht der HERR: Den Verschnittenen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich Gefallen habe, und festhalten an meinem Bund,
denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen, besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll.
Und die Söhne der Fremde, die sich dem HERRN angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des HERRN zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und alle, die an meinem Bund festhalten:
die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. (Jes 56,1-7).
Ich aber, ich kenne ihre Taten und ihre Gedanken, und ich bin gekommen, alle Nationen und Sprachen zu versammeln. Und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen.
Ich richte unter ihnen ein Zeichen auf und sende Entkommene von ihnen zu den Nationen, nach Tarsis, Put und Lud, zu denen, die den Bogen spannen, nach Tubal und Jawan, zu den fernen Inseln, die die Kunde von mir nicht gehört und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie verkünden meine Herrlichkeit unter den Nationen. (Jes 66,18-19).
Im Alten Testament sehen wir also neben Fluchworten über die Fremdvölker auch folgendes Bild: Völker ziehen nach Jerusalem, werden dort aber von Jahwe nicht unterworfen, sondern bekehren sich zu ihm und dürfen sogar am Gottesdienst teilnehmen. Am deutlichsten findet sich diese Vorstellung von der Bekehrung der Völker bei Jesaja. Durch Jahwes Handeln an Israel werden die Völker zu der Erkenntnis kommen, dass Jahwe ein machtvoll handelnder Gott ist (Jes 45,14; 42,10-12; 56,3-8; 66,18-22). Auffällig ist, dass Jesaja 66,18-22 mit der Ankündigung der Pilger nach Zion Jesaja 2,2-5 entspricht und mit diesem Text eine Klammer um das ganze Jesajabuch legt. Das Jesaja-Buch hat somit einen fremdenfreundlichen Rahmen und darf deswegen trotz anderer Aussagen in Jesaja 13-27 als ein äußerst fremdenfreundliches Buch gelten.
Nach Jesaja 56,3-8 wird Jahwe selbst Ausländer, die ihm dienen und die Gebote beachten, zum Tempel führen, der ein Bethaus für alle Völker sein soll. Anders als in der Aufnahme dieser Zusage in der neutestamentlichen Erzählung von der Vertreibung der Händler aus dem Tempel (Mt 21,13; Mk 11,17; Lk 19,46), liegt der Akzent hier nicht darauf, dass der Tempel ein Bethaus ist, sondern dass er ein Bethaus für alle Völker sein wird. Nach Jesaja 66,18ff wird Jahwe auch Ausländer zu Priestern machen. Micha 4,3-4a beschreibt ein umfassendes Friedensreich. Jahwe wird die Konflikte zwischen den Völkern schlichten und allen zu ihrem Recht verhelfen. Dann werden die Völker nicht mehr den Krieg, sondern die Tora erlernen und ihre Waffen zu Werkzeugen schmieden, Schwerter zu Pflugscharen und Speere zu Winzermessern. Jesaja 19,18-25 kündigt Ägypten und Assur (gemeint sind die Weltmächte) das Heil an.
An jenem Tag werden fünf Städte im Land Ägypten sein, die die Sprache Kanaans reden und dem HERRN der Heerscharen schwören werden. Eine wird Ir-Heres heißen.
An jenem Tag wird mitten im Land Ägypten dem HERRN ein Altar geweiht sein und ein Gedenkstein für den HERRN nahe an seiner Grenze.
Und er wird zu einem Zeichen und zu einem Zeugnis für den HERRN der Heerscharen im Land Ägypten werden: Wenn sie zum HERRN schreien werden wegen der Unterdrücker, dann wird er ihnen einen Retter senden; der wird den Streit führen und sie erretten.
Und der HERR wird sich den Ägyptern zu erkennen geben, und die Ägypter werden an jenem Tag den HERRN erkennen. Dann werden sie dienen mit Schlachtopfern und Speisopfern und werden dem HERRN Gelübde tun und sie erfüllen.
Und der HERR wird die Ägypter schlagen, schlagen und heilen. Und sie werden sich zum HERRN wenden, und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen.
An jenem Tag wird es eine Straße von Ägypten nach Assur geben. Assur wird nach Ägypten und die Ägypter nach Assur kommen, und die Ägypter werden mit Assur dem HERRN dienen.
An jenem Tag wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und mit Assur, ein Segen inmitten der Erde.
Denn der HERR der Heerscharen segnet es und spricht: Gesegnet sei Ägypten, mein Volk, und Assur, meiner Hände Werk, und Israel, mein Erbteil. (Jes 19,18-25)!
Sie werden also Jahwe verehren, aber nicht am Zion, sondern – das ist neu – in ihren Heimatländern. Von der zentralen Bedeutung Jerusalems ist hier nichts zu spüren. Dieser Zukunftsentwurf war so provozierend, dass schon die griechische (Septuaginta) und die aramäische Übersetzung (Peschitta) den Text nicht wörtlich wiedergegeben haben. Die Septuaginta überträgt in Jesaja 19,25 die Segnung Ägyptens und Assurs auf die dort lebenden Israeliten: „Gesegnet ist mein Volk, das in Ägypten weilt und unter den Assyrern.“
Ferner sagt Simeon die paradoxe Reaktion des Volkes Israel auf diesen Retter voraus: Einige werden sich an Jesus stoßen und fallen, andere werden durch ihn auferstehen. Ähnlich klingt es dann im Johannesevangelium:
Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. (Joh 1,11-12).
Bis heute entscheiden sich Menschen für oder gegen Jesus. Jesus ist bis heute das Zeichen, dem widersprochen wird. Sollte es uns als seinen Nachfolgern anders ergehen?
Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird – aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen – damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. (Lk 2,34-35).
Auch Maria muss wie viele andere Mütter den ganzen Schmerz einer Mutter, die ihren Erstgeborenen liebt und doch verliert, erfahren. Schon hier finden wir einen Hinweis auf die schweren Stunden/Tage, die sie zwischen der Verhaftung Jesu im Garten Gethsemane und der Auferstehung am ersten Tag der Woche durchlitten hat. Es ist auch ein Hinweis auf die unterschiedlichen Gedanken und Überlegungen der Schriftgelehrten, der Ältesten, der Jünger, des römischen Offiziers, der Mitverurteilten, des Volkes, weil diese gerade im Hinblick auf die Person von Jesus ins wahre Gotteslicht gerückt werden.
1.10.3 Das Zeugnis der Prophetin Hanna
Hanna, eine Prophetin, Tochter Penuels, aus dem Stamm Asser, ist eine Witwe. Asser war der Sohn Jakobs von Leas Leibmagd Silpa (1Mose 30,13). Sein Name bedeutet: Glück. Dieser Stamm gehört zu den verlorenen 10 Stämmen des Nordreiches die 722 v. Chr. unwiderruflich zerstreut wurden. Dies ist einer der sehr wenigen Hinweise, dass Menschen ihre Herkunft auf einen dieser Stämme noch nachweisen konnten. Nur sieben Jahre lebte Hanna mit ihrem Mann, doch jetzt ist sie in einem hohen Alter. Entweder war sie 84 Jahre alt oder seit 84 Jahre eine Witwe (damit mindestens: 14+7+84=105 Jahre alt). Bei Simeon wissen wir das Alter nicht! Doch bei Hanna ist das hohe Alter in der damaligen Kultur der Grund für besonderen Respekt. Ihr Dienst und ihre Worte haben somit ein besonderes Gewicht. Fasten und Beten ist ihre tägliche Aufgabe. Sie verlässt den Tempel nicht … dies kann buchstäblich oder auch im übertragenen Sinne gemeint sein – sie ist also zumeist im Tempel anzutreffen. Man bedenke, dass es bei dem häufig nur noch formalen Gottesdienst zu jener Zeit, doch Menschen gibt, die Gott ergeben einen wahren Gottesdienst „leben.” Gott beschenkt Hanna mit der besondern Gabe der Prophetie. Die prophetische Gabe bei Frauen und der damit verbundene prophetische Dienst war zur Zeit des Alten Testaments nicht selten und wird im Neuen Testament bestätigt (siehe Apg 21,9). Dies geschieht in einer Zeit, die wir meist als eine Zeit des Schweigens betrachten, da Gott keine Propheten mehr berief. Doch Hanna hält die Hoffnung Israels auf den Messias wach. Sie spricht zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warten. Es gibt deutliche Parallelen zu den Aussagen Simeons (Lk 2,25). Zur rechten Zeit ist sie (wahrscheinlich im Vorhof der Frauen) an der Stelle, wo auch Josef und Maria zum Gottesdienst kommen. Wahrscheinlich sieht und hört auch sie die Handlung und die Worte Simeons. Sie schließt sich diesen Worten an und lobt Gott! So dienen Simeon und Hanna Gott zu ihrer Zeit – als Teil des gottesfürchtigen Überrestes im Volk Gottes. Gott bereitet sie zu ihrer Hauptaufgabe zu, die dann nur wenige Minuten dauert. Doch Gott bringt alles sehr präzise zur richtigen Zeit am richtigen Ort zusammen.
Wohl uns, wenn wir zur rechten Zeit an der richtigen Stelle das Richtige tun.
1.10.4 Βerichtslücke bei Lukas
Der Evangelist Lukas lässt die Geschichten mit den Weisen und der damit verbundenen Flucht nach Ägypten völlig aus. Diese sogenannten Lücken bemerken wir bei allen Evangelisten, da jeder von ihnen sein eigenes Ziel mit jeweils unterschiedlichem literarischem Stil verfolgt. Keiner der Evangelisten erhebt den Anspruch auf lückenlose Berichterstattung. Nicht einmal alle vier Evangelien zusammengenommen ergeben eine lückenlose Beschreibung des Lebens von Jesus. Auch diese Bibelstudienreihe ist nur ein Versuch aufgrund der uns vorliegenden Berichte eine vermutete Chronologie herzustellen, die sich nicht widerspricht und in der alle wichtigen inhaltlichen Details ihren Platz einnehmen.
Fragen / Aufgaben:
- Beschreibe die alttestamentliche Verordnung in Bezug auf den Erstgeborenen Sohn. Womit war die Darstellung verbunden? Lies auch: 3Mose 12,4-8: 2Mose 13,2.12. 15; 4Mose 3,40ff; 18,5f.
- Was ist mit dem Trost Israels gemeint (Lk 2,25; Jes 40,1f)?
- Suche nach Beispielen aus den Evangelien, wo der Fall und das Auferstehen in Israel deutlich werden (siehe auch Joh 1,11-12).
- Die Witwe Hanna, aus dem Stamm Asser versieht besondere Dienste in schwierigen Zeiten. Was können wir von ihr lernen?
- Kannst du dir vorstellen, dass Gott für dich eine besondere Aufgabe vorgesehen hat?
- Warum ist es wichtig, dass wir die Evangelienberichte miteinander vergleichen?
- Beschreibe den Lobpreis des Simeon. Was fällt im Vergleich mit dem Lobpreis der Elisabeth, Maria und des Zacharias auf?
1.11 Besuch der Weisen aus dem Morgenland
1.11.1 Wer sind sie, wann und woher kamen sie?
Die Geschichte vom Besuch der Weisen in Bethlehem berichtet uns nur der Evangelist Matthäus. Er schreibt: „Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem (…).“ (Mt 2,1). Der griechische Begriff `μάγοι – magoi ` mit dem die Weisen (im Plural) bezeichnet werden, wirft dem aufmerksamen Bibelleser einige Fragen auf. Von einem Magos berichtet auch der Evangelist Lukas in der Apostelgeschichte 13,8ff, doch dort ist der Begriff eindeutig negativ besetzt: Elymas ist „Zauberer.” So hat der Begriff zwar einen negativen Sinn, doch ursprünglich hatte er auch die Bedeutung von „weiser” Mensch, z.B. als Ratgeber für einen Herrscher. Auffallend ist, dass diese Begriffsbezeichnung in 5Mose 18,10-14 nicht vorkommt. In Jesaja 47,13 (LXX) werden die Sterngucker/Sternseher `αστρόλογοι – astrologoi ` genannt. Für unser Verständnis ist es eher unwahrscheinlich, dass Gott Sterndeuter im Sinne von Astrologen, berufen hätte, seinem Sohn zu huldigen. Im Gesetz und den Propheten geht Gott mit jeglicher Art der Sterndeuterei und ähnlichen abgöttischen Praktiken ins Gericht (Jes 47,13; 5Mose 18,10-14). Die Weisen aus dem Osten (Morgenland) sind auf jeden Fall auch sternkundige Menschen.
Thiede verweist auf ein berühmtes Sternobservatorium in Sippar bei Babylon (Thiede 2006, 74). Dort wurden Tontafeln mit Keilschrift gefunden, auf denen Sternberechnungen verzeichnet sind.
Das griechische Wort `ανατολών – anatolön` steht im Plural, ist also ein geographischer Terminus und meint das Morgenland, oder den Osten allgemein (1Mose 25,6). Es wird angenommen, dass es sich dabei um das Gebiet im Zweistromland (heute Irak/Iran) handelt. Hinweis: den Osten der Türkei bezeichnen wir bis heute als „Anatolien.” Der Evangelist Matthäus nennt allerdings nicht die Zahl der Weisen.
„Da die Weisen in Jerusalem großes Aufsehen erregten, wird allgemein angenommen, es sei eine Gruppe gewesen. Fresken in den Katakomben in Rom zeigen 4 Könige. Johannes Chrysostomos nimmt in seinem Kommentar zum Matthäusevangelium an, dass es 14 Magier waren. Andere Varianten sind, zwölf oder acht Magier. Einer der ersten, der von drei Magiern sprach, war Origenes – vielleicht aufgrund der drei genannten sehr kostbaren Gaben“ (Papke 1995,127.128). Die westliche Kirche hat fälschlicherweise das Fest der Erscheinung von Jesus, welches in der Ostkirche am 6. Januar gefeiert wurde, zum Fest der Erscheinung des Sterns von Bethlehem, bzw. zum Dreikönigstag gemacht. „Das Fest der Erscheinung „Epiphanie”, am 6. Januar, wurde nachweislich schon 311 als Tag der Geburt von Jesus gefeiert. Als dann seit 354 der Geburtstag von Jesus nach und nach auf den 25, Dezember vorverlegt wurde, musste der 6. Januar zwangsläufig als der Tag, an dem die Magier nach Bethlehem gekommen waren, umgedeutet werden (Papke Werner 1995, 125).
Natürlich stimmen dann die zeitlichen Einordnungen nicht. Denn wäre Jesus gemäß der Auffassung der Westkirche am 24/25. Dezember geboren worden, könnten die Weisen nicht schon zwölf Tage später in Bethlehem angekommen sein. Der Besuch der Weisen ist deshalb nach unserer Auffassung keine Weihnachstlektüre im engeren Sinne. Ausgehend von den Zeitangaben des Textes kommen die Weisen mindestens mehrere Monate nach der Geburt von Jesus in Jerusalem bzw. Bethlehem an. Wir geben zu bedenken: die Darstellung im Tempel erfolgte 40 Tage nach der Geburt, danach kehrten Josef und Maria wieder (nicht nach Nazaret, wie Lukas in seiner Kurzfassung sagt-Lk 2,39) sondern nach Bethlehem zurück. Die Weisen kommen wohl erst danach nach Jerusalem bzw. Bethlehem. Zur Feststellung der Reisegeschwindigkeit kann die Reisezeit der jüdischen Rückwanderer unter Esra dienen. Das Volk benötigte fast vier Monate von Babylon nach Jerusalem (Vgl. Esra 7,9 mit 8,31)
1.11.2 Die Weisen bei Herodes in Jerusalem
Die Weisen planen wie selbstverständlich als Reiseziel Jerusalem. Dort angekommen fragen sie: „Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem,“ (Mt 2,2-3). Uns würde interessieren wie die Weisen auf den Gedanken kommen, dass im Volk der Juden ein neuer, ja ein besonderer König geboren wurde? Welche mündliche oder sogar schriftliche Informationen lagen ihnen vor? Gab es noch von der Zeit des Exils (Daniel, Nehemia) Aufzeichnungen in den Staatsarchiven über die besondere Geschichte des Volkes Israels? Jerusalem war sowohl der Sitz der politischen Verwaltung (Regierungssitz des Königs Herodes und des römischen Prokurators Pilatus) als auch der wesentlichsten religiösen Institutionen des Judentums: des Tempels mit allen bedeutenden Gelehrten und Priestern. Die Frage der Weisen „Wo ist der (neu)geborene König der Juden?“ versetzt jedoch die Einwohner Jerusalems und besonders Herodes in Schrecken. Jerusalem hatte damals ca. 35.000 Einwohner (Malina 2003,7). Herodes ist zu der Zeit ängstlich bemüht seine begrenzte Macht zu sichern und schreckt auch nicht vor der Ermordung seiner Söhne zurück. Seine argwöhnische Reaktion passt also gut in das Bild, welches uns außerbiblische Berichte überliefern. So beginnt Herodes ein weiteres Doppelspiel. Äußerlich lässt er sich nichts anmerken – wohl wissend auf wen die Frage nach einem neugeborenen König der Juden aus königlichem Geschlecht sich beziehen muss. Außerdem fürchteten viele Herrscher der Antike astronomische Sondererscheinungen als astrologische Vorzeichen ihres Untergangs. Matthäus schreibt über Herodes: „und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa; denn so steht geschrieben durch den Propheten (Micha 5,1): »Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas; denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll.« (Mt 2,4-6). Die Hohenpriester und Schriftgelehrten sind bestens informiert über die Herkunft und den Ort, aus dem der Christus hervorgehen soll und können darüber dem König genaue Auskunft geben. Damals gab es so gut wie kein Privatleben – fast alles geschah öffentlich. Heimlichkeiten waren an sich schon wenig ehrenhafte Angelegenheiten. Anhand der Frage des Herodes lässt sich seine relativ gute Kenntnis des Themenkreises: „Jüdische Messiaserwartung” erkennen. Aus eigenem Interesse hat er sich Detailkenntnisse über diese brodelnden Messiaserwartungen des jüdischen Volkes verschafft. Dieser Retter war die Hoffnung Israels im Gegensatz zum Haus des Herodes. Der König kann dieser „Messias-Gefahr” nur mit einem hinterlistigen Doppelspiel begegnen. Der Evangelist Matthäus arbeitet durch die Schilderung seiner Fragen den unehrlichen und bösen Charakter des Königs deutlich heraus.
Die Frage der Weisen wird mit dem Aufgehen des besonderen Sterns in Verbindung gebracht. „Wir haben seinen Stern beim Aufgehen gesehen”. Der griechische Begriff `ανατολή, – anatol¢` (im Singular) ist ein astronomischer Terminus und bedeutet soviel wie `aufgehen, aufleuchten, aufstrahlen, erscheinen`, wie auch 2Petrus 1,19 nahe legt – „und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht“. Deswegen lautet die Begründung der Weisen nicht: „Wir haben seinen Stern im Osten gesehen”, sondern genauer: „wir haben seinen Stern beim Aufgehen gesehen” – also bei der Ersterscheinung. Deutlich wird hier auch die Bezeichnung Stern `τον αστέρα – ton astera` (Akk.) im Gegensatz zu Planeten `αστέρες πλανήται – asteres plan¢tai` hervorgehoben (Judas 13). Planeten sind irrende Sterne, die ständig in Bewegung sind und so nie auf einem Platz sich befinden. Die vielfach vertretene Theorie, dass die Planetenkonjunktion von Jupiter und Saturn im Sternbild der ‚Fische’ im Jahre 7 v. Chr., der Stern des Messias sein muss, entspricht nicht dem biblischen Befund. Gleiches kann auch von anderen Planetenkonjuktionen, die um die Zeitenwende beobachtet wurden, gesagt werden. Gerne wollen wir dem gebildeten Zöllner und späterem Evangelisten Matthäus die Fachkompetenz bei der richtigen Wortwahl in diesem Zusammenhang zubilligen. Die genaue Erklärung für diese Himmelserscheinung bleibt jedoch offen. Gott, der Schöpfer des Universums war durchaus imstande einen einmaligen Stern zu schaffen, der die einmalige Geburt seines menschgewordenen Sohnes zeichenhaft ankündigte (1Mose 1,14-16).
Die Schriftgelehrten können auf das Nachforschen des Herodes antworten und anhand von Micha 5,1 den Hinweis auf den Geburtsort des Messias geben. Zwar können die Gelehrten hier mit ihrem Wissen glänzen, doch sie selber wollen daraus keine klaren Konsequenzen ziehen. Im Text deutet nichts daraufhin, dass sie sich öffentlich oder heimlich selbst nach dem verheißenen Kind erkundigen. Sie reagieren äußerlich neutral – weder positiv noch negativ. Doch streng genommen, gibt es keine neutrale Haltung zu Gott. Hier verpassen sie schon ihre dritte Chance.
- Die erste hatten sie, als die Kunde über die Geburt von Jesus von den Hirten überall erzählt wurde. Es wäre eher unwahrscheinlich, dass diese Botschaft, welche in der gesamten Umgebung verbreitet wurde, nicht auch das nur 8 Kilometer entfernte Jerusalem erreicht hätte (Lk 2,17-18).
- Die zweite, als Jesus im Tempel dargestellt wurde und sowohl Simeon, als auch die allen bekannte und anerkannte Prophetin Hanna über das Jesuskind öffentlich Zeugnis gaben (Lk 2,21-38).
- Und nun auch hier, als sie durch die Fremden auf ihren Messias aufmerksam gemacht werden (Mt 2,1-5).
Indirekt lehnen sie ihn, den Messias schon gleich zu Beginn durch ihr Verhalten ab. Wider besseres Wissen und wohl auch aus Furcht vor Herodes, bringen sie nicht die erforderliche Huldigung ihrem Messias entgegen. Es bleibt also den weisen Heiden aus dem Osten überlassen, dem neugeborenen König der Juden zu huldigen. Übrigens spricht die Huldigung dem Messias/König durch die Repräsentanten aus den Heiden für die Universalität des Heilsangebotes Gottes.
Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein; und wenn ihr’s findet, so sagt mir’s wieder, dass auch ich komme und es anbete. (Mt 2,7-8).
Folgende Reihenfolge der Ereignisse ist laut dem Textinhalt erkennbar:
- Die Weisen haben eine öffentliche (wahrscheinlich mit einem Dolmetscher) Audienz beim König Herodes. Nach dem Treffen werden sie entsprechend dem Gastrecht untergebracht.
- Danach ruft Herodes die Oberen aus dem Volk zu sich und erkundigt sich bei ihnen über den Geburtsort des Christus.
- Nachdem diese wieder weg sind, ruft er erneut die Weisen zu sich, diesmal zu einer heimlichen Unterredung.
- Anschließend schickt er die Weisen nach Bethlehem mit dem heimtückischen Auftrag.
Der Evangelist Matthäus setzt seinen Bericht fort mit den Worten: „Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin.“ (Mt 2,9a).
Aus dem späteren Bericht des Evangelisten erfahren wir, dass Herodes sich sehr genau (gr. ακριβώς – akribös) nach der Ersterscheinung des Sterns erkundigt hatte (Mt 2,16). Schon jetzt hegt er einen heimtückischen Plan in seinem Herzen. Womit er nicht rechnet ist: – »Der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind.« (Ps 84,11; 1Kor 3,20).
Sicher hätte Gott die Weisen durch den Lauf des Sterns auch direkt nach Bethlehem führen können, doch dann wäre ihr Zeugnis in Jerusalem sehr wahrscheinlich nicht bekannt geworden. So bindet Gott sie mit ein, um die Führung Israels zu einer Stellungnahme herauszufordern. Auf diese Weise werden Gedanken und Motive der Menschen offenbar.
1.11.3 Die Weisen in Bethlehem
Der Evangelist Matthäus berichtet weiter:
Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. (Mt 2,9-11).
Als die Weisen sich auf ihren Kamelen (wahrscheinlich) frühmorgens auf den Weg nach dem nur zwei Stunden entfernten Bethlehem machen, sehen sie wieder den Stern, den sie bereits beim Aufgehen/Erscheinen gesehen hatten. Im Text heißt es, dass der Stern ihnen voranging. Nun haben sie zwei Wegweiser – die Schriftaussage und den Stern. Für den letzten Wegabschnitt sind sie auf den Stern angewiesen, da dieser exakt über dem (Ort/Stelle/Haus) stehen bleibt, wo das Kind war (Mt 2,9). Die Pilger erfüllt eine überaus große Freude – endlich haben sie das Ziel ihrer Reise erreicht. Sie gehen in das Haus und sehen das Kind mit Maria seiner Mutter. Dies ist eine beachtliche Reihenfolge in der orientalischen Kultur, in der eher Männer zuerst genannt werden, seltener Frauen und Kinder. Die Weisen bringen ihre Huldigung zum Ausdruck, indem sie vor dem Kind Jesus knien oder niederfallen. Danach öffnen sie ihre Schätze und beschenken das Kind. Drei verschiedene Geschenkarten werden genannt. Gold, Weihrauch und Myrrhe (χρυςόν, λίβανον, σμύρναν – chyson, libanon, smyrnan). Origenes deutete die Geschenke so: Gold für den König; Myrrhe für den Sterblichen und Weihrauch für Gott. Was auch immer die Weisen zu diesen Gaben bewog – unwissend werden hier Eigenschaften des Kindes verehrt. Im Orient kennt man diese Huldigungsform nur für Götter oder Könige. Beides trifft auf den Gottessohn und König Jesus von Nazaret zu. Man kann sich weiter vorstellen, dass die Weisen zwar Heiden waren, aber im Gegensatz zu den meisten Mittelmeervölkern keine Anhänger des Polytheismus, sondern möglicherweise waren sie Anhänger der altiranischen Religion Zoroasters (Zarathustras). Weihrauch und Myrrhe waren typische orientalische Kostbarkeiten, die weit in den Mittelmeerraum hinein exportiert wurden.
Wir können uns das Staunen von Josef und Maria über diesen besonderen Besuch und die Huldigung vorstellen, denn auch bei den vorhergehenden Begegnungen und Bekundungen über ihr Kind hat Maria alles sorgfältig aufgenommen und in ihrem Herzen bewegt.

Abbildung 17 Dromedare im Jordantal nordöstlich des Toten Meeres. Höchstwahrscheinlich benutzten die Weisen aus dem Morgenland für ihre Überlandreise solche Dromedare (Foto: 9. November 2014).
Die Weisen bekommen von Gott im Traum die Anweisung, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Daher ziehen sie auf einem anderen Weg wieder zurück in ihr Land (Mt 2,12). Die Hauptstraße in Richtung Norden führt von Bethlehem direkt nach Jerusalem und dann über Syrien weiter nach Osten. Angesichts ihres umfangreichen Reisetrosses können die Weisen sich Jerusalem nicht unbemerkt nähern.
Es gibt überhaupt keine größere Straße, auf der sie hätten nach Hause reisen können, ohne die relative Nähe von Jerusalem zu passieren. Deshalb ziehen sie wahrscheinlich zunächst nach Hebron und dann auf der sehr schlechten Straße an der Küste nach Gaza, von wo aus sie eine andere Route nach Norden nehmen können. (Craig 1998, Bd. 1; 58). Eine Alternativroute wäre über die Aravasenke nach Petra und dann weiter nach Nordosten durch die Syrische Wüste. Der Ausdruck „in ihr Land”, weist eher darauf hin, dass sie aus einem Land kamen und nicht wie in der Tradition über die so genannten „Drei Könige” aus drei verschiedenen Ländern.
Herodes hatte sie zwar bei einem zweiten geheimen Treffen im Detail über Zeitpunkt der Himmelserscheinung befragt und dann in die Pflicht genommen zu ihm zurück zukehren, doch erscheint es ihnen in diesem Fall legitim, für die Rettung oder Erhaltung des Lebens eine solche Verpflichtung zu missachten, zumal sie im Traum von Gott eine klare Anweisung erhielten – zu Herodes nicht mehr zurückzukehren. Hier gilt damals wie heute: man muss dem rettenden Gott mehr gehorchen als den offensichtlich unehrlichen Menschen (Apg 5,29). Die meisten Könige reagierten extrem feindselig auf Gerüchte über etwaige „Thronräuber” und astrologische Weissagungen über ihren Untergang. Der Text sagt jedoch nichts, dass die Weisen Herodes ein Versprechen gaben, lediglich: „als sie den König gehört hatten, zogen sie hin“. Doch wird schon hier deutlich – Matthäus offenbart seine Absicht: Die Darstellung von Jesus als den Retter für Juden und Heiden.
Fragen / Aufgaben:
- Woher haben die Weisen Kenntnis über Israel und den erwarteten König der Juden?
- Wenn Gott die Astrologie und andere abgöttische Praktiken verboten hat (5Mose 18; Jes 47,13), warum werden die Weisen (Magier) von Matthäus so positiv dargestellt? Oder sind die Weisen gar keine Astrologen?
- Charakterisiere Herodes, nenne und begründe mindestens vier Charakterzüge des Herrschers.
- Herodes berief die Schriftgelehrten und Ältesten, um von ihnen den Geburtsort des Christus zu erfahren. Haben sie den Test bestanden?
- Information (Wissen) berpflichtet. Was haben die drei Gruppen (Herodes, Schriftgelehrte, Weise) mit diesen Erkenntnissen gemacht?
- Was für eine Bedeutung hat für dich die Schrift im Vergleich mit Zeichen/Wundern, persönlichen oder gehörten Erfahrungen?
- Was tun wir, wenn sich Gottes Gebot zur Barmherzigkeit/Rettung Unschuldiger mit den Anliegen hinterlistiger Menschen nicht vereinbaren lassen?
1.12 Flucht nach Ägypten
(Bibeltext: Mt 2,13-15)
Die Weisen aus dem Morgenland sind sicher von der „himmlischen Anweisung”, nicht den Rückweg über Jerusalem zu nehmen, überrascht. Wir können annehmen, dass sie auch Josef und Maria diese Anweisung mitteilen. Ob sie etwas von den heimtückischen Gedanken des Herodes ahnen und damit auch, dass ihr Besuch nicht ohne Folgen für das Neugeborene Kind in Bethlehem bleiben wird? Wir können weiter annehmen, dass auch Josef und Maria in dieser Atmosphäre vorsichtiger werden. Sie können von den Weisen die Details der Nachforschungen des Herodes erfahren haben. Schon hier wird etwas Typisches für das weitere Leben von Jesus sichtbar: die Herrlichkeit (königliche Geschenke, besondere Ehrerbietung) und das Leid (die Flucht) liegen so nah beieinander. So gibt Gott Josef im Traum eine deutliche Anweisung:
Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich dir sage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. (Mt 2,13).
Hier beginnt das „Schwert” von dem Simeon in Lukas 2,34.35 sprach, durch Marias Seele zu dringen.
Später wird Jesus an diesen Umstand erinnern (Mt 23,37; Lk 13,34): „Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind (…).” Und noch später stellt der Apostel Paulus in Galater 4,29 fest, dass der nach dem Fleisch gezeugte den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt wurde. Auch Jesus ergeht es so schon in sehr jungen Jahren und erinnert an:
- Abel, der von Kain;
- Isaak, der von Ismael;
- Jakob, der von Esau;
- David, der von Saul und eben
- Jesus, der von Herodes verfolgt wird.
Was Jesus hier trifft, trifft später auch seine Gemeinde. Denn Jesus sagte in Johannes 15,20: „Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen (…).” Jünger von Jesus müssen wie ihr Meister mit Verfolgung rechnen!
Gott offenbart sich Josef in der immer überraschenden Form – durch einen Engel im Traum (Mt 1,20; 2,13; 2,19-20; 2,22). Engel sind „dienstbare Geister, welche Gott ausgesandt hat für den Dienst derer, die die Seligkeit ererben sollen.” (Hebr 1,14). Ein Traum von Gott hat Bedeutung für eine Person, eine Familie oder ein ganzes Volk. Gott redete zu verschiedenen Zeiten durch Träume und verhieß seinem Volk Träume zu bekommen (vgl. Apg 2 mit Joel 3). Doch wir werden auch zur Vorsicht vor undefinierbaren Träumen aufgerufen (Jer 23,28).
Josef ist der Stimme des HERRN gehorsam, die er, trotz aller Überraschung, bereits kennt. Natürlich hat er zu dieser Zeit noch keine Ahnung von der Erfüllung einer alttestamentlichen Prophetie. Eher dachte er an die Erfahrung so mancher Israeliten, die bei Verfolgung im eigenen Land eben nach Ägypten flohen und dort in der Regel Asyl fanden.
Später sagte Jesus seinen Jüngern: „Wenn sie euch verfolgen in dieser Stadt, flieht in die andere.” (Mt 10,23). Wieder sehen wir einen Ausschnitt aus Gottes Heilsplan und finden auch in diesem Detail ein biblisches Prinzip, an dem sich Christen in ähnlichen Situationen orientieren können.
Warum soll Josef nach Ägypten fliehen, in das Land der Knechtschaft? Hat Gott nicht andere Möglichkeiten? Wir hören von der Erfüllung einer Prophetie, die ihre Wurzeln in der Geschichte Israels hat (Vgl. 1Mose 25,29ff mit Hosea 11,1 und 2Mose 4,22 – zur Ergänzung lesen wir noch Jer 31,1-3). Im Kontext der Hoseastelle lesen wir vom Propheten und seiner untreuen Frau, die dennoch umsorgt, geliebt und sogar zurückgekauft wird. In gleicher Weise liebt und umsorgt der HERR sein untreues Volk und befreit es aus dem Land der Sklaverei. Wir wollen jedoch hier bei der Hoseastelle weniger nach dem Kontext fragen… sondern dem inspirierten Evangelisten folgen und fragen, was bedeutete diese alttestamentliche Stelle für das Leben von Jesus? In welcher Weise fand diese Aussage eine Erfüllung?
So wie Jakob und die wenigen Stammväter damals nach Ägypten (in das östliche Nildelta, in eine Art „Brutkasten” mussten, um zu überleben und sich stark zu mehren) und später von Gott als seinem „Erstgeborenem” wieder herausgerufen wurde, so soll Jesus um zu überleben nach Ägypten fliehen. Man kann es auch umgekehrt formulieren: Weil Jesus viel später nach Ägypten muss, um dort zu überleben, musste schon viel früher auch Jakob/Israel nach Ägypten ziehen. So wird Ägypten zuerst Zufluchtstätte für die Nachkommen Jakobs und dann für den Retter Jesus. Für das alttestamentliche Gottesvolk wurde Ägypten später zum Land der Sklaverei und der unerträglichen Unterdrückung. Hier finden wir das widersprüchliche biblische Bild in Bezug auf das Land und Volk der Ägypter:

Abbildung 18 Ismailia – die Stadt liegt am Westufer des Suezkanals. Der Verlauf des Suezkanals vom Mittelmeer bis zum Roten Meer markiert den Übergang von der Wüstenlandschaft des nördlichen Sinai zur fruchtbareren Landschaft des östlichen Nildeltagebietes, wo das Land (Landschaft) Gosen zu suchen ist (Foto: Juli 1985).
Einerseits ist es der Ort des Überlebens, der Zuflucht – doch dann wieder das Land der Sklaverei, der Unterdrückung – Feindesland.
Josef zögert nicht, den Befehl Gottes auszuführen. Auch Maria hat keine Zweifel, Josef zu folgen, hat er doch ihr ganzes Vertrauen gewonnen durch seine Gottesfurcht und seinen Gehorsam gegenüber Gott und seine treue Fürsorge ihr gegenüber. Mit den nötigen Mitteln ausgestattet, müssen sie eine beschwerliche Reise unternehmen. Es bleibt keine Zeit, sie müssen noch bei Nacht aufbrechen.

Abbildung 19 Kairo – die ehemalige Pharaonenstadt am Nil. Dieser Fluß ist seit Jahrtausenden die Lebensader von Ägypten (Foto: Juli 1985).
Die Strecke nach Ägypten, mehr als 500 km, bedeutete viele Gefahren, und war mit einem kleinen Kind ein hohes Risiko.
Der Zufluchtsort in Ägypten ist nicht bekannt, doch nach einer alten Überlieferung fanden sie in der Stadt Heliopolis Zuflucht. Heliopolis,- griechisch `Sonnenstadt`. Zurzeit von Jesus lebten in Ägypten etwa eine Million Juden. Etwa ein Drittel der Einwohner Alexandrias waren Juden – größtenteils wohlhabend und griechisch gebildet. In Elephantine existierte schon seit ca. 650 v. Chr. auf einer Nilinsel im Bereich der heutigen Stadt Assuan eine jüdische Kolonie (Schriftstücke aus der Zeit 495-399 v. Chr. sind erhalten geblieben). Dort gab es zu jener Zeit mehrere jüdische Synagogen, was für ein reges jüdisches Leben in dieser Stadt spricht und eben auch geeignet war für den Aufenthalt Josefs und Marias mit Jesus.
Fragen / Aufgaben:
- Nenne alle Situationen in denen Gott sich Josef offenbarte und beauftragte! War dies typisch oder eher ungewöhnlich? Nenne einige andere Beispiele aus der Schrift.
- Auf welchen geschichtlichen Zusammenhang will uns Matthäus aufmerksam machen, wenn er schreibt: „Damit erfüllt wird (…)”?
- Wodurch wird der Glaube und Gehorsam von Josef unterstrichen?
- Warum schreibt Matthäus immer wieder in folgender Reihenfolge: „Nimm das Kind und dessen Mutter”?
- In einer Nacht eine Auswanderung vorzubereiten und umzusetzen… kann Gott so etwas verlangen? Gibt Gott auch heute noch „seltsame” Aufträge?
1.13 Kindermord in Bethlehem durch Herodes
(Bibeltexte: Mt 2,16-18; Jer 31,15)
Die zornige Reaktion von Herodes ist verständlich, da sein heimtückischer Plan misslungen ist. Wahrscheinlich wollte er das Kind Jesus ohne Aufsehen töten. Doch er hat noch weitere Mittel zur Verfügung. Der Evangelist Matthäus berichtet:
Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht (Jeremia 31,15): »In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen; Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen.«
Mit den Informationen der Weisen, kann er den Geburtstermin und damit auch das Alter des Kindes ermitteln. Allerdings hält der Evangelist Matthäus diese Informationen nicht fest und so ist es für uns schwierig, das Alter von Jesus zu diesem Zeitpunkt zu bestimmen. Damit verbunden ist dann auch die traurige Vielzahl der später getöteten Knaben in Bethlehem.
- Herodes setzt aufgrund der Zeitangaben der Weisen einen Altersstichtag von oben nach unten fest, Die Frage ist hier, wo ist dieser Stichtag zu suchen? Die Altersangabe im Griechischen: από διετούς και κατωτέρω – apo dietous kai katöterö, wird in der Interlinearübersetzung mit „von ab einem Zweijährigen und darunter” übersetzt. Diese Angabe ist typisch orientalisch unklar. Sie kann bedeuten:
- Alle Knaben, die sich bereits im zweiten Lebensjahr befinden und einschließlich die Einjährigen.
- Alle Knaben, die sich unterhalb der Grenze (dem Übergang) zum zweiten Lebensjahr befinden, also nur Einjährige.
Anmerkung: In unserem Sprachgebrauch sind Zweijährige, die sich bereits im dritten Lebensjahr befinden. Diese Zählweise schließen wir auf in diesem Fall (weil nicht orientalisch) aus.
Trotzdem bleibt der Stichtag also verworren offen: „von ab“ dem Übergang vom ersten zum zweiten oder zweiten zum dritten Lebensjahr? Bibelleser haben bemerkt, dass im Alten Testament jedes begonnene Jahr als Ganzes gerechnet wurde (so der Vergleich von 1Kön 15,25 mit 15,33). Ähnlich zählt man auch die Tage, so sagte Jesus: „am dritten Tag oder nach drei Tagen werde ich wieder auferstehen”. Tatsache ist, dass Jesus keine drei volle Tage mit 24 Stunden im Grab blieb, aber jeder noch nicht zu Ende gegangener und schon begonnener Tag wurde als voller Tag gerechnet. Damit wäre nach unserer Zählweise ein Kind im Alter von einem Jahr und einem Monat in der damaligen Zeit bereits zweijährig (bei uns sagt man in diesem Fall – ein Jahr alt). Es ist eher wahrscheinlich, dass die Weisen sich schon bald nach der Erscheinung des Sternes auf den Weg gemacht haben. Warum sollten sie auch warten? War doch dieses Ereignis die größte Erfahrung ihres Lebens. Wenn wir weiter annehmen, dass mit dem Morgenland oder Osten in der Bibel das Gebiet bis einschließlich das Zweistromland bezeichnet wird (4Mose 23,7), würden für die Reise bis Jerusalem etwas mehr als drei Monate benötigt werden (siehe Esra 7,9; 8,31).
Nach den Vorschlägen von Werner Papke (Papke 1995, 125f), ist Jesus im Spätsommer des Jahres 2 vor unserer Zeitrechnung geboren und Herodes im Frühjahr des Jahres 1 vor unserer Zeitrechnung gestorben. So lägen zwischen der Geburt von Jesus und dem Tod des Herodes etwa 7 Monate. Ausreichend Zeit für die Weisen, sich für die Reise vorzubereiten und noch einige Monate vor dem Tod des Herodes in Bethlehem dem neugeborenen König der Juden zu huldigen. Herodes will also sicher gehen und setzt das Alter der infrage kommenden Knaben auf unter zwei Jahren (von ab einem zweijährigen und darunter) fest und meint damit, den neugeborenen König getötet zu haben. Ist Herodes ein besonders grausamer Herrscher?
„Einer der Konkurrenten, ein beim Volk sehr beliebter junger Hoher Priester, erlitt in einem nur einen Meter tiefen Brunnen einen „tödlichen Unfall”; seine Lieblingsfrau ließ er umbringen, weil er sich geärgert hatte; zwei seiner Söhne ließ er auf Grund eines Täuschungsmanövers – unschuldig – hinrichten; einen anderen Sohn der allerdings wirklich schuldig war – ließ er noch vom Sterbebett aus exekutieren.“ (Keener 1998, Bd. 1, 59).
Doch Herodes ist keine Ausnahme, die meisten vor und nach ihm handelten gleichermaßen. Eigentlich müsste Herodes sich wenig Sorgen um seinen Thron machen, doch gerade in dieser Situation wird sein aktiver Unglaube deutlich. Heimtückisch missbraucht er die Heilige Schrift und die arglosen Magier, um seine boshaften Pläne auszuführen. Er zeigt äußerlich keine Gottesfurcht und schreckt nicht davor zurück seine Hand an den Gesalbten Gottes zu legen. Es wird mindestens dreimal im Text festgestellt, dass Herodes „genau” (im Griechischen: `akribisch` Mt 2,7.8.16) erkundete. Dies betont die bewusste, berechnende Schlauheit und Bosheit des Herrschers. In Sachen Kindermord ist er zuverlässig gewissenhaft. Bei den Rabbinern lesen wir zum Tode Herodes:
„(…) das ist der Tag, an welchem Herodes der Hasser der Gelehrten starb; denn es ist Freude vor Gott, wenn die Gottlosen von der Welt scheiden;… Und an demselben Tage, an welchem Herodes starb, machten sie ihn zu einem Festtag… (Strack 1982, 90).
Leider reiht sich auch dieses traurige Ereignis ein in die grausamen Verlustgeschichten Israels. Auch viele Könige, aus den eigenen Reihen des Volkes erwählt, handelten ähnlich.

Abbildung 20 Rahels Grab bei Bethlehem, das sowohl von Juden als auch Muslimen verehrt wird (Foto: April 1986).
Solch eine erste Verlustgeschichte wird uns in 1Mose 35,16-20 erzählt. Rahel die Lieblingsfrau Jakobs/Israels stirbt bei oder nach der Geburt ihres Sohnes Benjamin und wird in Bethlehem, bzw. in dessen Nähe begraben.
Von einer weiteren Verlustgeschichte berichtet uns der Prophet Jeremia (Jer 31,15ff). Dort geht es um das Weinen und Trauern wegen der Kinder Israels, die in die babylonische Gefangenschaft weggeführt wurden. Auch dieses traurige Ereignis ist lokalisiert. Die Stadt Rama, im Grenzgebiet zwischen Benjamin und Ephraim, hatte in alttestamentlicher Zeit eine strategisch wichtige Bedeutung.
| Es ist überhaupt auffallend, wie alttestamentliche Geschichten von Propheten aufgegriffen und als Prophetenwort erweitert werden, um sich dann in einer späteren Phase heilsgeschichtlich zu erfüllen. So wird von der Identifikation des Leidens der Mütter Bethlehems mit Rahel, welche ihrerseits durch den eigenen frühen Tod sozusagen ihre Kinder verlor, berichtet. Rahel, die Lieblingsfrau Jakobs wird so zum Sinnbild für die weinenden Mütter Israels. So wird auch der Verlust der Kinder in Bethlehem sinnbildlich durch Rahel (Mutter Israels) beweint.
Doch sind die Leiden der Schuldlosen bei Gott keineswegs vergessen. Er wird für sie eintreten und die Gewalttäter bestrafen, wenn seine Zeit kommt. Für Irenäus (ca. 135-202 n. Chr.) sind die Kinder eigentlich die ersten Märtyrer, die zwar noch nichts von Christus wussten, und ihn noch nicht durch Worte rühmen konnten, aber die Christus durch ihr stellvertretendes Sterben verherrlichen konnten. Während die griechische Liturgie 14.000 ermordete Knaben nennt und mittelalterliche Autoren bis zu 144.000 Opfer annahmen, sprachen spätere Theologen (Joseph Knabenbauer, August Bisping) auf Grund der anzunehmenden Größe des Ortes Bethlehem (max. 1000 Einwohner) zu biblischen Zeiten immerhin noch von etwa sechs bis zwanzig erschlagenen Kindern.
Bis heute hören wir vom Leiden, Unrecht und der brutalen Gewalt, denen die Kinder `Bethlehems` in Palästina und weltweit ausgesetzt sind. Sind wir über Herodes oder einen der neuzeitlichen Herrscher und Diktatoren wegen ihrer Grausamkeiten erbost? Doch was ist mit den millionen Kindern, die noch vor ihrer Geburt von Müttern (oft unter dem Druck der Väter oder Erzeuger) mit Hilfe von Ärzten, ermordert werden? Wollen wir die Tränen der Kinder und Mütter zur Kenntnis nehmen? Jesus entkam ähnlich wie Mose diesem Schicksal. Die Gründe für das Leid sind damals wie heute vielschichtig und kaum einsichtig. Viele fragen sich nach dem Heil oder Unheil für diese Kinder. Doch die Kinder Bethlehems selbst stehen unter der Gnade Gottes und seinem Rechtsspruch – dieser Rechtsspruch wird gerecht und gut sein. Fragen / Aufgaben:
Gott kommt zu seinem Ziel. Sind wir bereit, den Leidensweg mit Christus zu gehen? |
1.14 Rückkehr aus Ägypten und Niederlassung in Nazaret
(Bibeltexte: Mt 2,19-23; Lk 2,39-40)
Der Evangelist Matthäus leitet einen neuen Abschnitt mit den Worten ein:: „Als aber Herodes gestorben war (…).” (Mt 2,19). Nach dem Tode des Herodes befiehlt Gott Josef im Traum, ins Land Israel zurückzukehren. Das Todesjahr des Herodes, 4 v. Chr. (seit Jahrzehnten allgemein angenommenes Datum) ist nicht eindeutig belegt. Werner Papke (wie bereits erwähnt) kommt aufgrund seiner historischen Forschungen auf das Jahr 1 v. Chr. Dies würde in unseren angenommenen zeitlichen Rahmen passen. Wieder ist es der Engel des Herrn, der Josef im Traum erscheint und ihn auffordert:
Nimm das Kind und seine Mutter und ziehe wieder in das Land Israel, denn sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten. (Mt 2,20).
Archelaus einer der Söhne des Herodes führt zunächst den Titel König (gr. βασιλεύς – basileus). Doch er muss diesen, von seinem Vater Herodes übernommenen Titel zunächst vom Kaiser Augustus gegen die Ansprüche seines Bruders Antipas bestätigen lassen. Nach dem Willen des Vaters sollte er nur den Titel Volksfürst (gr. έθναρχ – ethnarch) führen. Auch Augustus verweigerte ihm den Königstitel und ernannte ihn nur zum `Ethnarchen` über Judäa, Samaria und Idumäa, versprach ihm aber den Königstitel, wenn er gut regiere. Im Jahr 6 n. Chr. wurde Archelaus allerdings nach massiven Beschwerden aus Samaria und Judäa wieder abgesetzt und nach Vienna in Gallien verbannt. Sein Herrschaftsgebiet wurde in eine römische Provinz umgewandelt.
Für Josef war es selbstverständlich, dass seine Rückreise wieder nach Judäa, also nach Bethlehem in die Stadt Davids führen würde. So schreibt der Evangelist Matthäus:
Und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter zu sich, und er kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte anstelle seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen; und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegenden von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt, genannt Nazareth; damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist: „Er wird Nazoräer genannt werden. (Mt 2,21-23).
Josef hat erhebliche Bedenken nach Bethlehem zurückzukehren, herrscht doch über Judäa Archelaus, dem nicht zu trauen ist. Gott kennt seine Bedenken und offenbart ihm, was er zu tun hat. So geht er auf den Befehl Gottes in seine (zweite) Heimatregion zurück und wählt Nazaret als Wohnort. Dies ist nahe liegend, ist es doch seine bzw. ihre gemeinsame Stadt (Lk 2,39). Auch wurde Jesus als Menschensohn vom Heiligen Geist hier in Nazaret empfangen. Nazaret war ein kleines Städtchen, ohne besondere Bedeutung. Und hätte Jesus nicht dort seine Kindheit und Jugendjahre verbracht, wäre dieser Ort nie in die Weltgeschichte eingegangen. Heute liegt Nazaret im palästinensischen Teil und dort leben überwiegend arabischsprechende Menschen, unter ihnen viele Christen.

Abbildung 21 Das Städchen Nazaret liegt in einer Mulde und ist von Hügeln umgeben, die zum Teil an ihren Hängen überbaut sind. Das Strassenbild im heutigen Nazaret. Verschiedene Handwerkstätten und Souvenirläden sind ganz auf Pilger und Touristen ausgerichtet. Neben der alles überragenden Verkündigungsbasilika ist auch das Brunnenhaus eine Atraktion, sowie der vermutete Hügel, von dem die Nazarener Jesus hinabstürzen wollten (Foto: Juli 1994).
In diesem Abschnitt verbindet der Evangelist Matthäus den Städtenamen Nazaret mit einer bestimmten Bedeutung in Bezug auf die Person von Jesus. Im Neuen Testament kommen diese Bezeichnungen 18 mal vor und im Griechischen gibt es dafür zwei Schreibweisen, die hier in einer Tabelle aufgelistet sind und deren Bedeutung untersucht werden soll.
| Ναζωραίος – Nazöraios
– Mt 2,23 – Lk 18,37. – Joh 18,5 . – Joh 18,7. – Mt 26,71 – Joh 19,19. – Apg 2,22 – Apg 3,6 – Apg 4,10 – Apg 6,14 – Apg 22,8 – Apg 26,9 |
Ναζαρήνος – Nazar¢nos
– Mk 1,24 – Lk 4,34 – Mk 10,47 – Mk 14,67. – Mk 16,6 – Lk 24,19
|
Zwölf Mal wird also der Begriff `Ναζωραίος – Nazöraios ` verwendet:
(Matthäus, das Volk, die Wache, die Magd, Pilatus, Petrus, Jesus, Paulus).
Sechs mal wird der Begriff `Ναζαρήνος – Nazar¢nos ` verwendet:
(die Dämonen, das Volk, die Magd, die Engel am Grab, die Emmausjünger).
Beide Begriffe sind Synonyme, wie der Vergleich von Mk 10,47 mit Lk 18, 37 und Mk 14,67 mit Mt 26,71 zeigt. In Johannes 1,45 und Apostelgeschichte 10,38 wird Jesus „der von Nazaret” bezeichnet, also aus Nazaret kommend.
Der bestimmte Artikel betont die Besonderheit der Person von Jesus. Im Laufe seiner Wirksamkeit hat sich dann der Beiname ` Ναζωραίος – Nazöraios bzw. Ναζαρήνος– Nazar¢nos ` mehr und mehr verbreitet. Da Nazaret im Alten Testament nicht erwähnt wird und somit mit keiner Person von Bedeutung in Verbindung gebracht werden konnte, war es schon etwas besonderes, dass gerade aus solch einem verachteten Ort (Joh 1,46) eine solche Persönlichkeit kommt, wie Jesus. Da auch Jesus selbst sich mit diesem Beinamen identifiziert (Apg 22,8), ist es als ob Gott damit einen tieferen Sinn verbindet, als nur eine Herkunftsbezeichnung. Nicht in Jerusalem wächst er auf, ja nicht einmal in Bethlehem, wo man an die Davidstradition so gut anknüpfen konnte (dass hätte ihm mehr Anerkennung eingebracht Joh 7,41f +52). Mit den Galiläern, die einen schlechten Ruf bei denen in Jerusalem hatten, will er sich identifizieren. Nazaret liegt übrigens in Sichtweite zur griechischen Stadt Sephoris.
Der Evangelist Matthäus sieht in der Niederlassung in Nazaret die Erfüllung einer Prophetie, ohne jedoch diese aus dem AT konkret zu nennen. Maier erklärt diesen Begriff:
Mt 2,23 geht zurück auf Jes 11,1 „und es Wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen”. Der “Zweig/Spross” heißt hebräisch “nezer”. Im Hebräischen schreibt man jedoch für gewöhnlich nur die Konsonanten. Lässt man bei „Nazoräer” die Endung weg und schreibt man nur die Konsonanten: n-z-r, dann hat man eben den “Zweig”, den n-z-r von Jes. 11,1. (Vgl. Jes 53,2; Jer 23,5; 33,15; Sach 3,8; 6,12) (Maier 2007, 44).
Keener merkt an:
„Die Schriftsteller seiner Zeit mischten manchmal Texte miteinander, und Juden wie Griechen hatten eine Vorliebe für Wortspiele. Der Ausspruch könnte also ein Wortspiel mit dem hebräischen Wort nezer Spross sein – das ist ein Messiastitel (Jer 23,5; Sach 3,8; 6,12; vgl. Jes 11,1)” (Keener 1998, Bd. 1, 61).
Der Evangelist Lukas fügt noch hinzu: „Aber das Kind wuchs und wurde stark, erfüllt mit Weisheit und die Gnade Gottes war über ihm.“ (Lk 2,40). Er betont, dass Jesus in diesem Kindesalter an Weisheit zunahm. In ähnlicher Weise wird in der Bibel von Samuel und Johannes dem Täufer gesprochen. Der Umstand, dass Jesus als Kind überdurchschnittlich gute Fortschritte machte, wird durch die anderen Beispiele nur noch unterstrichen.
Fragen / Aufgaben:
- Woraus können wir schließen, dass Josef davon ausging nach Bethlehem zurückkehren zu müssen/wollen? Stelle daher den Zusammenhang zu Lk 2,3 her, wo von “seiner Stadt” die Rede ist.
- Nazaret wird zum Wohnort mit Bedeutung. Jesus identifizierte sich gerne mit den „Verachteten”! Nenne Beispiele! Wie können wir heute unsere Solidarität mit ihnen zeigen?
- Bist du schon öfters umgezogen? Was für eine Bedeutung hat der Wohnort für dein Leben?
Was heißt es zu „wachsen“, „mit Weisheit erfüllt zu sein“ und „die Gnade Gottes“ über sich zu wissen?
Veröffentlicht unter UNTERWEGS MIT JESUS
Verschlagwortet mit Die Geburt Jesu, Jesus
Kommentare deaktiviert für UNTERWEGS MIT JESUS
Exodus – Auszug des Volkes Israel aus Ägypten
Exodus – Auszug
des Volkes Israel aus Ägypten

Abbildung 1: Sand, Felsen und Berge – Gott bahnte dem Volk Israel einen für sie unbekannten neuen Weg durch die weite Wüste. Das Bild zeigt eine typische Wüstenlandschaft im Wadi Rum (Foto: P. Schüle 6. November 2014).
Bibelstudie über den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten
von Paul Schüle
Einleitung
Wer sich mit dem Auszug Israels aus Ägypten beschäftigt, wird bald mit mehreren Fragen konfrontiert:
- Wo lag das Land Goschen, das Aufenthaltsgebiet der Israeliten im ägyptischen Pharaonenreich?
- Wie lange waren die Israeliten in Ägypten?
- Wie groß (zahlenmäßig) waren die Israeliten in Ägypten?
- Wo lag das Land Midian, wohin Mose vor dem Pharao floh?
- Wo ist der Berg Gottes – Sinai/Horeb zu suchen?
- Wo befand sich der wichtige Lagerplatz der Israeliten – Kadesch Barnea?
- Welches Gewässer ist unter der Bezeichnung Schilfmeer oder Rotes Meer gemeint?
- Wo verliefen die Wanderrouten der Israeliten von Goschen bis Horeb, vom Horeb bis Kadesch Barnea und von Kadesch Barnea bis zum Jordantal gegenüber Jericho?
Anhand biblischer Texte wollen wir die Fragen aufgreifen und nach möglichen Antworten suchen. Bis heute sind einige dieser Fragen nicht eindeutig beantwortet. Diese Bibelarbeit ist keine wissenschaftliche Studie, sondern lediglich eine Beschäftigung mit vorhandenen Texten zu den oben gestellten Fragen. Trotzdem fließen Erkenntnisse aus verschiedenen Quellen der Forschung, Bibellexika, Publikationen im Internet, biblischen Karten und Google Earth in diese bibelstudie mit ein.
Reisen nach Ägypten, auf die Sinaihalbinsel, Israel, Syrien und Jordanien motivieren zusätzlich zu diesen Studien. Es wird vorausgesetzt, dass der Auszug tatsächlich stattgefunden hat. Diese Geschichte nimmt wie keine andere einen breiten Platz in den alttestamentlichen Schriften ein und auch Jesus und die Apostel setzen sie, als zentrales Ereignis in der Frühgeschichte Israels, voraus.
1. Wo lag Goschen – Wohngebiet der Israeliten in Ägypten?
Bei der Ankunft in Ägypten machten die Israeliten im Lande Goschen Halt. Dieses Gebiet lag also auf dem Weg zur Residenzstadt des Pharao.
Da kam Josef und sagte es dem Pharao an und sprach: Mein Vater und meine Brüder, ihr Kleinvieh und Großvieh und alles, was sie haben, sind gekommen aus dem Lande Kanaan, und siehe, sie sind im Lande Goschen. (1Mose 47,1).
Jakob zog also nach Ägypten hinab mit seinem ganzen Hause – 70/75 Seelen, die Dienerschaft (Knechte und Mägde) nicht mitgerechnet.
Die meisten Bibelübersetzungen geben in 2Mose 1,1 die Zahl ‚siebzig’ an. Sie stützen sich dabei auf die Hebräische Fassung des Alten Testamentes. Die Hebräische Fassung des Alten Testamentes, die sich nach 70 n. Chr. (Fall Jerusalems) durch die Pharisäer im Judentum durchgesetzt hatte und die auch M. Luther für seine Übersetzung benutzte, gibt die Zahl `siebzig Seelen` an (2Mose 1,1). Die Septuaginta (LXX – griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testamentes) gibt die Zahl ‚fünfundsiebzig’ an. Warum gibt es diese Unterschiede? Die in Qumran gefundene Schriftrolle aus dem 2Buch Mose gibt ebenfalls wie die LXX die Zahl ‚fünfundsiebzig Seelen` an. Der Grund liegt darin, dass es zur Zeit Jesu und der ersten Christen verschiedene Varianten des Hebräischen Alten Testamentes gab. Bemerkenswert jedoch ist, dass weder Jesus noch die Apostel sich daran störten. Zahlen werden uns auch noch im weiteren Verlauf beschäftigen und dabei so manches Rätzel aufwerfen.
Das war die Familie, aus der in den folgenden Jahrhunderten ein großes Volk wurde.
Dieser Text macht zudem auch recht deutlich, dass Josef ein geschickter Staatsmann war, der als Berater des Pharao dafür Sorge trug, dass im Land Ägypten der soziale Friede gewahrt blieb, indem er die unterschiedlichen Wirtschaftszweige an den für sie geeigneten Plätzen im Land ansiedelte. Und der Pharao sprach zu Josef:
Das Land Ägypten steht dir offen, lass sie am besten Ort des Landes wohnen, lass sie im Lande Goschen wohnen, und wenn du weißt, dass Leute unter ihnen sind, die tüchtig sind, so setze sie über mein Vieh. (1Mose 47,6).
Josef überließ nichts dem Zufall, sondern bereitete ganz konkret seine Brüder auf die Begegnung mit dem Pharao vor, indem er ihnen einschärfte:
So sollt ihr (zu Pharao) sagen: Deine Knechte sind Leute, die Vieh haben, von unserer Jugend an bis jetzt, wir und unsere Väter -, damit ihr wohnen dürft im Lande Goschen. Denn alle Viehhirten sind den Ägyptern ein Gräuel. (1Mose 46,34).
Aus dem Text geht weiter auch hervor, dass Viehzucht in Ägypten ein vernachlässigter Landwirtschaftszweig war, weil der Hirtenberuf verachtet wurde. Die Israeliten konnten ihrerseits gerade diesen Schwachpunkt in der heimischen Wirtschaft der Ägypter ausfüllen. Und als die Brüder Josefs vor den Pharao traten und von ihrer Tätigkeit erzählten, wies ihnen Pharao das Land (das Wohngebiet) Goschen als Wohnsitz zu.
Sehr wahrscheinlich ist, dass Josef die Aufforderung Pharaos, tüchtige Leute aus Israel über sein Vieh zu setzen, zu gegebener Zeit auch umsetzte. Und so wird es wohl schon in der Frühzeit des Ägyptenaufenthaltes zur Förderung dieses so verachteten Wirtschaftszweiges durch die Israeliten gekommen sein. Dies könnte mit dazu beigetragen haben, dass es längere Zeit eine friedliche Koexistenz zwischen Ägyptern und Israeliten gegeben hat.
Die von Josef ausgesuchte und von Pharao zugewiesene Wohngegend für die Israeliten war also sehr gutes Weideland.
Aus dem Text 1Mose 45,10 geht auch hervor, dass sich der Wohnbereich der Israeliten bis in die Nähe von Josefs Regierungssitz erstreckte.
Du (Vater Jakob) sollst im Lande Goschen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, dein Kleinvieh und Großvieh und alles, was du hast. (1Mose 45,10).
`Im Lande Goschen’ heißt hier ein bestimmter Ort oder Gebiet von Ägypten. Das Gebiet oder Land Goschen lag nicht direkt im Nahbereich des zentralen Nil oder gar im Nildelta, wo Landwirtschaft als Hauptwirtschaftszweig betrieben wurde, sondern eher östlich und nordöstlich[1] davon und bildete so den Übergang von landwirtschaftlich genutzter Region hin zur Steppe (Weideland). So konnten die Israeliten in der Nähe der ägyptischen Wohnsiedlungen ihre Zelte aufschlagen, während die Hirten mit den Herden im weiter ostwärts anschließenden Weideland Viehzucht betreiben konnten. Später wohnten viele Israeliten ebenfalls in festen Lehmhäusern, zum Teil in nächster Nachbarschaft zu den Ägyptern (2Mose 3,22; 11,2).
Hier in Goschen lebten die Israeliten etwa 400[2] Jahre, so dass ihre Zahl sehr wuchs.
So wohnte Israel in Ägypten im Lande Goschen, und sie hatten es inne und wuchsen und mehrten sich sehr. (1Mose 47,27).
Auch folgender Text betont die starke Vermehrung der Israeliten in Ägypten:
(…) wuchsen die Nachkommen Israels und zeugten Kinder und mehrten sich und wurden überaus stark, sodass von ihnen das Land voll ward. (2Mose 1,7; vgl. auch die Verse 8-12).
Gemeint ist hier das Land Goschen (nicht ganz Ägypten), welches nun von den Israeliten voll besiedelt wurde.Nach den Worten des neuen Königs waren die Israeliten zu diesem Zeitpunkt zahlenmäßig stärker als die Ägypter. Es erfüllte sich also, was Gott dem Jakob als Verheißung auf den Weg nach Ägypten mitgegeben hatte: „Und er sprach: Ich bin Gott, der Gott deines Vaters; fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen; denn daselbst will ich dich zum großen Volk machen“ (1Mose 46,3; Vgl. 1Mose 22,17; 26,4; 32,13).
Auch wenn der Pharao mit seinem Vergleich aus politischen Überlegungen deutlich übertrieben hatte, bleibt doch der Eindruck, dass die Israeliten keineswegs mehr eine überschaubare Volksgruppe waren, empfanden doch die Ägypter sie als echte Bedrohung. Zum Vergleich – um 1900 v. Chr. wird die Einwohnerzahl Ägyptens auf ca. 12,5 Millionen geschätzt (Ägypten – Wickipedia).
Wie sollman denn die zahlenmäßige Schätzung aus 5Mose1,10 erklären: „denn der HERR, euer Gott, hat euch so zahlreich werden lassen, dass ihr heute seid wie die Menge der Sterne am Himmel“ (Ist dies nicht die Erfüllung der Verheißung an Abraham aus 1Mose 15,5)? Und bereits am Sinai (5Mose 10,22) zieht Gott einen Vergleich: „Deine Väter zogen hinab nach Ägypten mit siebzig Seelen; aber nun hat dich der HERR, dein Gott, zahlreich gemacht wie die Sterne am Himmel“.
Es kann auch in Betracht gezogen werden, dass zum Volk Israel ebenso die vielen Bediensteten dazugezählt wurden, die schon zu Abrahams und Isaaks Zeiten mit zu deren Haushalt gehörten und durch Beschneidung (aller männlichen Bediensteten) einen Status der Zugehörigkeit zum Volk innehatten (1Mose 17,12-13. Schon in der Anfangszeit in Kanaan zälten zu Abrahams Haushalt mindestens 318 Knechte (1Mose 14,14). Weitere Hinweise zu dem zahlenmäßig großen Haushalt der Patriarchen finden wir in1Mose 20,14 „Da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und gab sie Abraham“. Und in 1Mose 25,5 lesen wir „Und Abraham gab all sein Gut Isaak“; In Haran brachte es Jakob zu nicht geringem Reichtung: „Daher wurde der Mann über die Maßen reich, sodass er viele Schafe, Mägde und Knechte, Kamele und Esel hatte“ (1Mose 30,43). Zu dem eigens erworbenem kam noch das gesamte Erbe seines Vaters Isaak hinzu (1Mose 35,27-28) und später ging das Ganze Hab und Gut auf die 12 Stämme über. So dass sich Israels Gesamthaushalt bei der Ankunft in Goschen möglicherweise auf viele Hundert Personen belief.
Solange nun Josef lebte und eine geraume Zeit danach ging es den Israeliten gut. Doch nach einem Dynastiewechsel veränderte sich die Beziehung der ägyptischen Verwaltung zu den Israeliten zum schlechteren hin und es kam zu deren Unterdrückung (2Mose 1,8). Dies ist der Beginn des Leidensweges für Israel in Ägypten.
Nun stellt sich die Frage nach dem Gesamtzeitraum des Ägyptenaufenthaltes? Dazu gibt es zwei unterschiedliche Zahlenvarianten sowohl im Alten als auch im Neuen Testament.
- In 1Mose 15,13.16 gibt Gott den Aufenthalt in Ägypten mit ´400 Jahren oder vier Mannesaltern´ an. Auch Stefanus gibt die Zeit des Aufenthaltes der Israeliten in Ägypten mit vierhundert (400) Jahren an (Apg 7,6).
- In 2Mose 12,40 gibt Mose den Aufenthaltszeitraum der Jsraeliten jedoch mit vierhundertdreißig (430) Jahren an. Auch Paulus gibt in Gal 3,17 einen Zeitraum von vierhundertdreißig (430) Jahren an: „Dies aber sage ich: Einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das vierhundertdreißig Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, so dass die Verheißung unwirksam geworden wäre“. Den Beginn dieses Zeitraumes setzt er (so hier die Vermutung) vom Zeitpunkt der Bestätigung der Verheißung an Jakob (1Mose 35,9-15) bis zur Gesetzgebung am Sinai (2Mose 24,7). Die Bestätigung der Verheißung, von der Paulus in Gal 3,17 spricht wurde dem Jakob in El-Beth-El gegeben (1Mose 35,9-15). Zu diesem Zeitpunkt war Josef ca. neun (9) Jahre alt (zum Vergleich dazu 1Mose 29,27 mit 30,22-25 und 1Mose 37,2 mit 41,46; 41,29; 45,6). Die Israeliten kamen also nach Ägypten als Josef genau 39 Jahre alt war. So könnten diese 430 Jahre ihre Erklärung finden. So bleibt eine gewisse Unklarheit bezüglich der Differenz von dreißig Jahren.
Paulus liefert uns in der Apostelgeschichte 13,20 noch eine weitere Zahlenangabe von etwa vierhundertfünfzig (ca. 450) Jahren: „Das geschah in etwa vierhundertfünfzig Jahren. Danach gab er ihnen Richter bis zur Zeit des Propheten Samuel“. Diese ungefähre Angabe kann zu dem Ägyptenaufenthalt (400) Jahre der Wüstenwanderung (40) und sogar die Jahre der Landnahme, vielleicht bis zum Tod Josuas einschließen. Wir müssen also erkennen, dass es in Bezug auf die Berechnung für den Aufenthalt der Israeliten in Ägypten wahrscheinlich verschiedene Berechnungsansätze gab und beide (Paulus und Lukas) keinen Anlass sahen sie zu harmnisiern.
Zeittafel von Sem über Abraham bis zum König Salomo
| Name/Ereignis | Alter/Zeitraum | Jahr |
| Sem war 100 Jahre alt und zeugte Arpachschad zwei Jahre nach der Sintflut | 600 Jahre alt | |
| Arpachschad war 35 Jahre alt und zeugte Schelach | 438 Jahre alt | |
| Schelach war 30 Jahre alt und zeugte Eber | 433 Jahre alt | |
| Eber war 34 Jahre alt und zeugte Peleg | 464 Jahre alt | |
| Peleg war 30 Jahre alt und zeugte Regu | 239 Jahre alt | |
| Regu war 32 Jahre alt und zeugte Serug | 239 Jahre alt | |
| Serug war 30 Jahre alt und zeugte Nahor | 230 Jahre alt | |
| Nahor war 29 Jahre alt und zeugte Terach | 148 Jahre alt | |
| Terach war 70 Jahre alt und zeugte Abram, Nahor und Haran | 205 Jahre alt | |
| Abrahams Geburt in Ur (Chaldäa) | 2136 | |
| Terach stirbt | ||
| Abraham kommt mit 75 Jahren in Kanaan an | 2061 | |
| Geburt Isaaks (Abraham ist 100 Jahre alt) | 2036 | |
| Geburt Jakobs (Isaak ist 60 Jahre alt) | 1976 | |
| Tod Abrahams (Isaak ist 75 Jahre alt) | 175 Jahre alt | 1961 |
| Tod Isaaks | 180 Jahre alt | 1856 |
| Geburt Josefs (Jakob ist 91 Jahr alt) | 1865 | |
| Verheißung an die Väter (Gal 3,16-17) | 1876 ? | |
| Ankuft in Ägypten | 1846 | |
| Tod Jakobs in Ägypten | 147 Jahre alt | 1829 |
| Tod Josefs | 110 Jahre alt | 1775 |
| Aufenthalt der Israeliten in Ägypten | 400 (430) | |
| Auszug aus Ägypten | 1446 (1416) | |
| Gesetzgebung am Sinai | 1 Jahr | 1446 (1416) |
| Wüstenwanderung | 40 Jahre | 1406 (1376) |
| Einzug nach Kanaan | 1406 (1376) | |
| Vom Verlassen Kanaans bis zur Landnahme | 450 Jahre | 1396 (1366) |
| Richterzeit | 346 (316) | |
| Saul regiert 40 Jahre über Israel (!pg 13,21) | 1050 | |
| David regiert 40 Jahre lang | 1010 | |
| „Im vierhundertundachtzigsten Jahr nach dem Auszug Israels aus Ägyptenland, im vierten Jahr der Herrschaft Salomos über Israel, im Monat Siw, das ist der zweite Monat, wurde das Haus dem HERRN gebaut“ (1Kön 6,1). | 966 |
2. Wo lag Midian, wohin Mose vor dem Pharao floh?
Diese Frage ist wichtig, weil von der Lokalisierung dieses Landes oder wenigstens der Region in gewissem Sinne auch die nähere Ortsbestimmung des Berges Sinai (Horeb) abhängt. Ebenso würde die Reiseroute der Israeliten vom Auszug aus Ägypten bis zur Ankunft am Sinai leichter zu bestimmen sein.
Gelegentlich sieht man auf biblischen Karten ´Midian´ im Bereich der Sinaihalbinsel eingetragen. Doch auch das Gebiet im Nordwesten von Saudi Arabien wird als das Midian der Bibel angesehen.
Die erste Erwähnung des Landes Midian finden wir in 2Mose 2,15:
- „Und es kam vor den Pharao; der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian. Und er setzte sich nieder bei einem Brunnen“ (vgl. auch Apg 7,29).
- „Der Priester aber in Midian hatte sieben Töchter; die kamen, Wasser zu schöpfen, und füllten die Rinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hirten und stießen sie weg. Mose aber stand auf und half ihnen und tränkte ihre Schafe.Und als sie zu ihrem Vater Reguël kamen, sprach er: Warum seid ihr heute so bald gekommen? Sie sprachen: Ein ägyptischer Mann stand uns bei gegen die Hirten und schöpfte für uns und tränkte die Schafe. Er sprach zu seinen Töchtern: Wo ist er? Warum habt ihr den Mann draußen gelassen? Ladet ihn doch ein, mit uns zu essen. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und er gab Mose seine Tochter Zippora zur Frau. Die gebar einen Sohn und er nannte ihn Gerschom; denn, sprach er, ich bin ein Fremdling geworden im fremden Lande“ (2Mose 2,16-22).
Die Lokalisierung „im Lande Midian“ und das Vorhandensein eines Priesters scheinen auf den ersten Blick auf ein mehr oder weniger klar umrissenes Wohngebiet hinzuweisen. Doch damals waren die Grenzen der verschiedenen Stämme oft sehr fließend.
Dass die Priesterfamilie Schafzucht betrieb, sowie die Bemerkung über die Anwesenheit anderer Hirten, lässt zudem erkennen, dass der Wohnbereich von Reguel (Jetro) weniger Agrarland als vielmehr Weideland war, zumindest jedoch in dessen Umland. Weiter wird indirekt bemerkt, dass die dortigen Hirten vor der Priesterfamilie nicht allzu viel Respekt hatten. Reguel gehörte zum Stamm der Keniter. Die Schikanen seitens der Hirten an den Töchtern Jetros waren, wie der Kontext vermuten lässt, deren tägliche Erfahrungen.
Dort heiratete Mose Zippora, eine Tochter Jetros des Priesters. Der Name seines erstgeborenen Sohnes ‚Gerschom’ unterstreicht ebenfalls, dass er nun als Fremdling weit weg von Ägypten war, in einem fremden Lande.
Dieses Midian muss sich also deutlich außerhalb der Grenzen und des Einflussbereiches von Ägypten befunden haben, damit Mose seines Lebens absolut sicher sein konnte. Denn als Prinz am Hof des Pharao muss er jedem Ägypter bekannt gewesen sein und wäre im nahen Grenzbereich des Landes (Südsinai) recht bald aufgefallen und verraten worden. Die Sinaihalbinsel mit dem traditionellen Mosesberg, gehörte schon seit der frühdynastischen Zeit zum Einfluss,- oder gar Machtbereich des Alten Ägypten. Dazu kann auch das Gebiet des heutigen Nordwestsinai gerechnet werden, da dort die 12 Ismaelitischen Stämme wohnten, die ebenfalls Ägypten verwandschaftlich nahe standen.
Der Name des Landes Midian geht auf einen der sechs Söhne Abrahams zurück, die ihm Ketura nach dem Tod von Sara gebar. In 1Mose 25,2 lesen wir:
- „Die (Ketura) gebar ihm Simran und Jokschan, Medan und Midian, Jischbak und Schuach.“
Wir erfahren weiter, dass Abraham die Söhne seiner Nebenfrauen mit Geschenken versah und sie nach Osten schickte.
- „Aber den Söhnen[3], die er von den Nebenfrauen hatte, gab er Geschenke und schickte sie noch zu seinen Lebzeiten fort von seinem Sohn Isaak, nach Osten hin ins Morgenland“ (1Mose 25,6). „πρὸς ἀνατολὰς εἰς γῆν ἀνατολῶν“ (LXX).
Die Bezeichnung Morgenland oder Land des Ostens (Sonnenaufgang) ist sehr weit gefasst und schließt geographisch einen weiten Raum ein, der sich östlich des Toten Meeres ausdehnte. In dieser Zeit wohnte Abraham bei Hebron, oder zwischen Hebron und Beer Scheba. Isaak wohnte in dieser Zeit im Südland (1Mose 24,62). Das Gebiet östlich des Toten Meeres war damals auch schon besiedelt, dort wohnten bereits die Emiter, Amoriter und weiter südlich die Horiter. Die Nachkommen Lots waren zur Zeit der Patriarchen zahlenmäßig noch klein.
Jokschan, der Bruder von Midian, hatte zwei Söhne, Saba und Dedan, beide sind uns bekannt aus der späteren Israelgeschichte und deren Nachkommen befanden sich in Arabien (Jes 21,13); Saba im Süden (Lk 11,31), Dedan vermutlich im Nordwesten Arabiens. In Jesaja 60,6 werden Midian und Saba nebeneinander genannt, deren Bewohner aus einer Richtung, nämlich aus Arabien, nach Jerusalem kommen.
Meistens wurden Personennamen zu Städtenamen oder sogar Landesnamen, so auch im Falle von Midian. Zur Zeit des Auszugs hatten sich die Nachkommen Lots, nämlich Ammon (Ammoniter) und Moab (Moabiter) im Nordosten und Osten des Toten Meeres ausgebreitet. Das Kernland der Moabiter erstreckte sich zwischen den Bächen Sered im Süden und dem Arnon im Norden und breitete sich nach Osten hin aus bis zur Wüste. Auch das Gebiet nördlich des Arnonflusses war zeitweise von den Moabitern bewohnt.
Weitere Hinweise auf die Siedlungsgebiete der Nachkommen Abrahams finden wir in 1Mose 25,18, dort wird der Wohnsitz Ismaels des ältesten Sohnes von Abraham beschrieben. Auch diese Beobachtung und Studie über den Wohnsitz Ismaels ist wichtig, weil dadurch eine bessere Differenzierung und Eingrenzung des Landes Midian möglich wird.
- „Und sie (die Ismaeliten) wohnten von Hawila an bis nach Schur östlich von Ägypten nach Assyrien hin. So ließ er sich nieder all seinen Brüdern zum Trotz.“
Die Wüste Schur lag östlich von Ägypten (zwischen Ägypten und Kanaan), also im Bereich des heutigen Nordwestsinai.
Da sie aber ein Nomadenleben führten, dehnte sich ihr Einzugsgebiet bis weit nach Osten hin aus. Weitere Details über die Nachkommen Ismaels und ihre Wohngebiete werden in 1Mose 21,13-21 beschrieben:
- „Aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Da stand Abraham früh am Morgen auf und nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es Hagar auf ihre Schulter, dazu den Knaben, und schickte sie fort. Da zog sie hin und irrte in der Wüste umher bei Beerscheba. Als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und ging hin und setzte sich gegenüber von ferne, einen Bogenschuss weit; denn sie sprach: Ich kann nicht ansehen des Knaben Sterben. Und sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr: Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht; denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner Hand; denn ich will ihn zum großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und tränkte den Knaben. Und Gott war mit dem Knaben. Der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein guter Schütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägyptenland.“
Folgende geographische Details werden aus diesem Text erkennbar.
Hagar zog mit Ismael von der Gegend von Hebron aus in Richtung Süden und irrte bei dem (späteren) Beer Scheba umher.
Dann heißt es, dass Ismael in der Wüste wohnte, das ist das Gebiet des heutigen Negev, südlich von Beer Scheba. Er wuchs heran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägypten. Dies ist verständlich, da auch sie selbst Ägypterin war, bestand ein Verwandtschaftsbezug zu Ägypten.
Als nächstes wird für Ismael die Wüste Paran als konkretes Wohngebiet genannt. In 1Mo 14,6 wird Paran zum ersten Mal erwähnt als ‚El Paran’, das an die Wüste stößt. Gemeint ist dort der Beginn der großen Negev-Wüste, welche sich vom Westen des Gebirges Seir bis zum Bach Ägyptens. Die Wüste Paran dehnte sich auch nach Westen zur Wüste Schur hin, die sich wiederum östlich von Ägypten ausdehnte, so ist der Verwandtschaftsbezug auch durch die Nachbarschaft unterstrichen. Da er aber zwölf Fürsten zeugte, dehnte er sein Wohngebiet sogar bis nach Osten in Richtung Assyrien aus (1Mose 25,18). Hier kann man also feststellen, dass die Ismaeliten hauptsächlich südlich von Kanaan Land in Besitz nahmen, teilweise sogar auch östlich der Aravasenke, vielleicht wegen Verwanschaftsbindungen zu seinem Neffen Edom (Esau). Nach 1Mose 28,9 und 36,3 heiratete Esau zwei der Töchter von Ismael, so ergibt sich auch eine weitere verwandtschaftliche Nähe (vgl. auch 1Chr 27,30, wo die Nähe von Esaus und Ismaels Nachkommen unterstrichen wird). Auffallend ist auch, dass es zwischen Ismaeliten und Israeliten keine Streitigkeiten gab im Gegensatz zu den Edomitern, Moabitern, Ammonitern, Amalekitern und Midianitern. Anscheinend wachte Gott über seiner Verheißung, Ismael zu segnen. So ist das Gebiet der Sinaihalbinsel von Israel nie beansprucht oder bekämpft worden. Erst im 20. Jh. besetzten israelische Truppen die Sinaihalbinsel, welche jedoch schon nach 15 Jahren wieder an Ägypten zurückgegeben wurde.
Die Wohngebiete Midians und seiner Nachkommen sind dementsprechend nicht im gleichen Gebiet zu suchen, sondern eher noch weiter östlich der Aravasenke.
Einige Hinweise zu der Wüste Paran, dem frühen Wohngebiet Ismaels.
Von Kadesch Barnea aus, das an die Wüste Paran grenzte, sandte Mose zwölf Kundschafter aus, um das Land Kanaan zu erkunden. Später zur Zeit Davids (1Kön 11,15-18) lag die Wüste Paran auf dem Weg von Midian nach Ägypten, also im Negev. Zu Davids Zeit war Midian in Nachbarschaft zu Edom, wie folgender Text deutlich macht.
- „Und sie (der Edomiter Hadad und seine Leute) machten sich auf von Midian und kamen nach Paran und nahmen Leute mit sich aus Paran und kamen nach Ägypten zum Pharao, dem König von Ägypten. Der gab ihm ein Haus und Nahrung und wies ihm Land an.“
Der Prophet Habakuk erwähnt das Gebirge Paran (Hab 3,3) und heute noch wird dieses Gebiet im Negev ‚Paran’ genannt.
In 1Mose 17,20 verspricht Gott dem Abraham Ismael zu segnen:
- „Und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. Zwölf Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zum großen Volk machen.“
Kein Wunder also, dass die Ismaeliten ein sehr weites Gebiet besiedelten, ein Gebiet, das von der Ostgrenze Ägyptens über die Sinaiwüste (heute at Tih) in Richtung Osten und südöstlich, also in Richtung nördliches Ende des Roten Meeres (Golf von Agaba) und sogar weiter ostwärts reichte. Aus 1Mose 25,14 erfahren wir, dass einer der Söhne Ismaels Duma genannt wird. Später findet sich ein Ort im Gebiet östlich der Aravasenke und auch östlich von Edom mit dem Namen Duma, was auf die Verwandtschafts- und Wohnnähe von Esaus und Ismaels Nachkommen schließen lässt (Vgl. auch Jes 21,11).
Demnach muss das Siedlungsgebiet der midianitischen Stämme östlich von Ismael gelegen haben. Wenn also die Nachkommen Abrahams von der Ketura (Midian) nach Osten gingen, die Nachkommen Abrahams von Hagar (Ismael) nach Süden, dann ist es sehr unwahrscheinlich, das Siedlungsgebiet der Midianiter auf der heutigen Sinaihalbinsel zu suchen. Sollte sich bestätigen, dass Midian niemals in der Mitte oder auf der Südhälfte der Sinaihalbinsel lag, dann wäre die christliche Tradition der Lokalisierung des Horeb (aus dem 4.Jh.) in jener Gegend, hinfällig.
Ein weiterer Beleg für diese Annahme geht aus dem Zusammenhang von 4Mose 22,4 hervor. Dort lesen wir, dass die Moabiter und Midianiter miteinander kooperierten, weil sie in unmittelbarer Nachbarschaft wohnten, nänlich östlich des Toten Meeres. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf die Zeit kurz vor der Landnahme durch die Israeliten. 40 Jahre zuvor war Mose im Lande Midian, in dieser Zeit wird sich das Wohngebiet der Midianiter nicht verändert haben.
- „Und sie (die Ältesten der Moabiter) sprachen zu den Ältesten der Midianiter: Nun wird dieser Haufe auffressen, was um uns herum ist, wie ein Rind das Gras auf dem Felde abfrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu der Zeit König der Moabiter.“
Diese Aussage macht deutlich, dass diese beiden Volksgruppen um den Verlust ihres gesamtes Territoriums, welches in der Nachbarschaft östlich des Toten Meeres lag, bangten,
Und sie kooperierten miteinander gegen die Israeliten, wie folgender Hinweis in 4Mose 22,7 deutlich macht.
- „Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter und hatten den Lohn für das Wahrsagen in ihren Händen und kamen zu Bileam und sagten ihm die Worte Balaks.“
Auch dieser Zusammenhang lässt die Vermutung zu, dass Midian in unmittelbarer Nachbarschaft zu Moab lag. Denn die Moabiter gingen zu den Midianitern und dann weiter in Richtung Osten an den Euphrat, wo Bileam wohnte. Im Rückblick schreibt Josua die Anwesenheit der midianitischen Fürsten im Herrschaftsbereich des mächtigen Amoriterkönigs Sihon aus Heschbon, welcher mit seinem ganzen Volk von Israel geschlagen wurde:. „ … und alle Städte der Ebene und das ganze Reich Sihons, des Königs der Amoriter, der in Heschbon herrschte und den Mose schlug samt den Fürsten Midians – Ewi, Rekem, Zur, Hur und Reba -, den Gewaltigen des Königs Sihon, die im Lande wohnten“ (Josua 13,21). Diese Stelle ist sehr aufschlussreich, da aus ihr hervorgeht, dass die Midianiter im Gebiet der Amoriter wohnten. Belegt ist auch der Wohnbereich eines der Stämme der Amoriter, der auf dem Gebirge westlich des Toten Meeres wohnten (1Mose 14,13; 4Mose 13,29). Weitere Stellen, welche über die unmittelbare Nähe der Midianiter zu Israels Wanderrouten und deren Aufenthalten Aufschluss geben, finden wir in 4Mose 25,6. 15. 17-18; 31,2-3. 7-9.
So kann man vorläufig festhalten, dass Midian sich als eigenständiges Land in seinen Grenzen nicht genau lokalisieren lässt, doch ihre Wohngebiete befanden sich im großen und mächtigen Amoriterreich, östlich des Toten Meeres in Nachbarschaft der Moabiter und auch in Nachbarschaft Edoms, deren Landesgrenzen recht gut gesichert zu sein scheinen.
Nach der entscheidenden Niederlage der midianitischen Stämme auf dem Gefilde der Moabiter durch Israel werden die Midianiter in diesem Bereich später noch einmal erwähnt und zwar, dass sie von einem edomitischen Fürsten besiegt wurden (dies war in der Richterzeit und lässt ihr Wohngebiet in unmittelbaren Nachbarschaft zu Edom vermuten).
- „Als Huscham starb, wurde König an seiner statt Hadad, ein Sohn Bedads, der die Midianiter schlug auf dem Felde der Moabiter; und seine Stadt hieß Awit“ (1Mose 36,35).
Dies macht auch deutlich, dass bei kriegerischen Auseinandersetzungen keineswegs die gesamte Stammesbevölkerung ums Leben kam. Und so treffen wir etwas später im Osten (Gilead) auf einen midianitischen Stamm. Nach Richter 6,33 kamen diese Midianiter, Amalekiter und andere Stämme aus östlicher Richtung und lagerten sich in der Jesreel Ebene (später Südostgaliläa). Wieder kann man erkennen, dass die midianitische Streitmacht aus der Gegend kam in der sie schon zur Zeit der Landnahme erwähnt werden.
Und bereits zur Zeit Jakobs kamen Midianitische Kaufleute aus Gilead (Gegend in der der Fluß Arnon entspringt), durchzogen Kanaan in Richtung Ägypten (1Mose 37,26-28). Die biblischen Texte lassen erkennen, dass die Nachkommen Midians seit der Patriarchenzeit bis zur Richterzeit (also mindestens 500 Jahre) im besagten Gebiet östlich oder südöstlich von Moab siedelten.
Es ist aber unklar, in welcher Beziehung die Keniter (in 1Mose 15,19 erstmals erwähnter Stamm zu dem Reguel und seine Familie gehörten) zu den Midianitern standen. Die wenigen Anmerkungen zu diesem Stamm geben aber einigen Aufschluss. Die Keniter sind in der zahlreichen Stammesliste aufgeführt, deren Land Gott Abram und seinen Nachkommen versprochen hatte (1Mose 15,19). In 4Mose 24,21 beschreibt Bileam in poetischer Form den Wohnsitz der Keniter:
- „Und als er die Keniter sah, hob er an mit seinem Spruch und sprach: Fest ist deine Wohnung, und du hast dein Nest in einen Fels gebaut.“
Diese Beschreibung erinnert uns lebhaft an Felsbewohner. Südöstlich des Toten Meeres gibt es Gegenden, auf die eine solche Beschreibung zutrifft. Die bekannte Nabatäerstadt Petra wäre ein Beispiel für solchen Wohnstil. Hobab der Keniter, Moses Schwager, nahm doch letztlich die Einladung des Mose an, mit Israel nach Kanaan zu ziehen (4Mose 10,29ff), wie folgender Text deutlich macht:
- „Und die Nachkommen des Keniters Hobab, mit dem Mose verschwägert war, zogen herauf aus der Palmenstadt mit den Männern von Juda in die Wüste Juda, die im Süden von Arad liegt, und gingen hin und wohnten mitten unter dem Volk“ (Ri 1,16).
Weitere positive Informationen über das Geschlecht Hobabs im Zusammenhang der Geschichte Israels finden wir in den Texten: Ri 5,24 (Jael) 1Sam 15,6 (Saul verschont die Keniter) 1Sam 27,10; 30,29.
Diese Texte geben Anlass zur Annahme, dass Jetro und sein Haus zwar in dem Gebiet (Land) von Midian wohnten, doch wahrscheinlich gar keine Midianiter waren und dass ihre Gotteserkenntnis und Gottesbeziehung der von Israel nahe stand (2Mose 18,1-12). Geben doch auch diese Textzusammenhänge Anlass zur Annahme, dass der Berg Horeb eher östlich der Aravasenke zu suchen ist und nicht auf dem heutigen Südsinai.
Die Frage ist nun, wohnte der Priester Reguel aus dem Stamm der Keniter, mit seiner Familie in diesem Land Midian, oder gab es einen weiteren midianitischen Stamm, der weiter südlich im heutigen NW von Saudi Arabien siedelte?
Viele Jahrhunderte nach der Landnahme erwähnt Jesaja in einer Prophetie Saba und Midian, die in friedlicher Absicht nach Israel pilgern:
- „Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Efa. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des HERRN Lob verkündigen“ (Jes 60,6).
Wahrscheinlich ist dies eine Anspielung auf das geschichtliche Ereignis zur Zeit Salomos (2Chr 9,1-9) und vielleicht sogar eine zukunftsgerichtete Aussage, welche nach den Worten von Jesus sich auf das Ende der Zeit bezieht (Mt 12,42; Lk 11,31).
3. Wo liegt der Berg Horeb oder Sinai?
Warum interessiert uns der Ort und die Lage des Berges Sinai oder Horeb so sehr?
- Am Fuß des Berges begegnete Gott dem Mose durch Vermittlung eines Engels im Brennenden Busch; 2Mose 3,2-6; Mt 22,32
- Ebenfalls am Fuß des Berges Horeb ließ Gott Wasser aus dem Felsen sprudeln; 2Mose 17,6.
- Am Fuß des Berges lagerte Israel knapp ein Jahr lang und baute dort die Hütte der Begegnung; 2Mose 25-40.
- Die Herrlichkeit Gottes erschien auf dem Berg und Mose empfing dort die Zehn Gebote; 2Mose 19,19; 20,1-21: Apg 7,38.
- In der Königszeit wanderte der Prophet Elia zu diesem Berg. Damals wusste man noch genau, wo dieser sich befand; 1Kön 19,8.
Durch die lokalisierung des Berges ließe sich leichter die tatsächliche Route des Volkes Israel beim Auszug aus Ägypten bestimmen, ebenso die Lokalisierung des Durchzugs durch das Schilfmeer (Rotes Meer).
3.1 Merkmale des Berges Horeb und seiner Umgebung
- Vor dem Berg oder Gebirge erstreckt sich eine Wüste, die Wüste Sinai (2Mose 19,2; 1Kön 19,15).
- Der Berg weist oben eine Spitze (Gipfel 2Mose 19,20) und unten eine Art Fuß auf („am Fuße des Berges“), also einen deutlichen Übergang vom Flachland zum Bergsockel, damit er umzäunt werden konnte (2Mose 19,10-23).
- 2Mose 19,18.
- Das Vorhandensein einer Höhle kann sogar mit ein Kriterium sein (1Kön 19,9).
- Vom Berg floß ein Bach herab 5Mose 9,21. Dies weist auf ein fruchtbares Bergtal hin.
- Auch im Umfeld muss es genug Wasser gegeben haben, damit so eine große Anzahl von Menschen (einschließlich ihrer zahlreichen Herden 2Mose 12,38) die Versorgung über ein ganzes Jahr hindurch gesichert war. Denn in dem Jahr des Aufenthaltes am Berg Sinai wird nichts von Wassermangel geschrieben.
- Es muss keineswegs ein schwer zugänglicher Berg sein, denn Mose stieg immer wieder innerhalb kürzerer Zeit den Berg hinauf und hinunter, einmal auch mit den Ältesten Israels (2Mose 34,4; 19,24; 2Mose 32,30; 2Mose 24,9-11).
Für diesen besonderen Berg gibt es zwei deutliche Namen: ‚Horeb’ und ‚Sinai’. Oft wird er einfach auch ‚Berg Gottes’ und ‚Berg des Herrn’ genannt. Die Bezeichnung ‚Horeb’ hat die Bedeutung von ‚Ödland’ oder ‚Wüstengebiet’ und ist eher hebräisch, vielleicht weil Gott ihn so nannte (2Mose 17,6).
- „Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe (Wüste) hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb“ (2Mose 3,1).
Dort gab Gott Mose ein Zeichen in prophetischer Voraussage:
- „Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe: Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge“ (2Mose 3,12).
Der genannte Berg ist also in unmittelbarer Nähe der Gottesoffenbarungsstelle am Brennenden Busch. Sogar Jesus nimmt Bezug auf diese besondere
Offenbarung Gottes in der Wüste Sinai und zwar in der Diskussion mit den Sadduzäern über die Realität der Totenauferstehung:
- „Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht (2.Mose 3,6): „Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs“? Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden“ (Mt 2,31-32). Und Lukas ergänzt:„Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden; denn ihm leben sie alle“ (Lk 20,38). Auch Markus hat eine wichtige Ergänzug: „Habt ihr nicht im Buch Moses gelesen, wie Gott beim Dornbusch zu ihm redete und sprach“ (Mk 12,36).
Damit bestätigt Jesus, wenn auch indirekt, die Historizität der Gottesbegegnung des Mose beim Dornbusch am Berg Horeb.
3.2 Hinweise zur Lage des Berges Horeb
Der Berg Horeb müsste sich irgendwo auf dem Weg, bzw unweit der Route von Midian nach Ägypten befunden haben, wie folgender Text indirekt nahelegt:
- „Und der HERR sprach zu Aaron: Geh hin Mose entgegen in die Wüste. Und er ging hin und begegnete ihm am Berge Gottes und küsste ihn“ (2Mose 4,27).
Zu diesem Zeitpunkt wäre es unlogisch gewesen, wenn Mose nicht auf dem direktesten Wege (Karawanenroute) von Midian nach Ägypten gegangen wäre. Dem Aaron dagegen muss wohl der Herr selber den Weg gewiesen haben, damit er Mose an dieser Stelle (Berg Gottes) treffen konnte.
Es besteht auch ein geographischer Zusammenhang zwischen dem Lande Midian und dem Berg Sinai. In der Aussage: „(Mose) trieb die Schafe über die Steppe hinaus[4] und kam an den Berg Gottes, den Horeb“, könnte ein Hinweis darauf enthalten sein, dass Mose die Grenze des eigentlichen Territoriums der Midianiter überschritten hatte und somit der Berg Gottes Horeb, streng genommen, sich außerhalb der Grenzen des Landes[5] Midian befand. Diese Annahme wird auch durch folgenden Text gestützt:
- „Und Mose ließ seinen Schwiegervater wieder in sein Land ziehen“ (2Mose 18,27; vgl. 4Mose 10,30).
Jetro, der die Lage des Berges Horeb kannte, kam aus seinem Land (Midian). Der Berg Sinai und die vorgelagerte gleichnamige Wüste könnten demnach sozusagen Niemandsland[6] gewesen sein:
- „Als nun Jitro, Moses Schwiegervater, und seine Söhne und seine Frau zu ihm in die Wüste kamen, an den Berg Gottes, wo er sich gelagert hatte…“ (2Mose 18,5).
Dass Jetro zu Mose in die Wüste hinausging, unterstreicht noch einmal, dass der Priester in einer bewohnten Gegend lebte. Aufschlussreich könnte auch die Wendung: „er trieb die Schafe über die Wüste hinaus …“. Hier stellt sich die Frage der Grnzenmarkierungen im Altertum. So wie Meere, Bergketten und Flüsse natürliche Grenzen zwischen Stämmen und sogar ganzen Völkern bildeten, so bildeten auch Wüsten natürliche Grenzen zwischen den einzelnen Stammesverbänden. Mose überquerte also eine bestimmte Wüste, in der Hoffnung, am anderen Ende, das sichtbar von gegenüberliegenden Bergen flankiert war, neue oder bessere Weideplätze für die Schafe zu finden. Diese Wüste erstreckte sich zwischen dem Wohngebiet des Jetro (Midian) und der Bergregion Sinai[7].
In Galater 4,21-25 spricht Paulus vom Berg Sinai und lokalisiert ihn in Arabien:
- „Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, den einen von der Magd, den andern von der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von der Freien aber kraft der Verheißung.Diese Worte haben tiefere Bedeutung. Denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse: einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar; denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien (τὸ δὲ Ἁγὰρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ) und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt“ (Vgl. dazu Joh 8,33-34).
Hier stellt sich also die Frage, bis wohin sich zur Zeit von Paulus Arabien nach Norden hin erstreckte. Seit Jahrhunderten war Petra Hauptstadt des Nabatäerreiches, welches sich zeitweise nach Norden hin bis Damaskus erstreckte. König Aretas IV herrschte von 8 v. bis 40 n. Chr. Auch über Damaskus. Die Nabatäer kamen aus Zentralarabien, verdrängten mehr oder weniger die Edomiter und erweiterten sozusagen den arabischen Einfluss und Territorium nach Norden hin. Somit könnte der Berg Sinai auch in diesem Bereich gesucht werden.
Gut möglich, dass Paulus selber am Berg Horeb war, denn im gleichen Brief schreibt er über einen Rückzug nach Arabien von Damaskus aus:
- „(Ich) ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus“ (Gal 1,17).
Was liegt da näher, als anzunehmen, dass er nicht einfach irgendwohin nach Arabien ging, sondern in Anlehnung an Mose und den Propheten Elia eben zum Berg Sinai. Und anscheinend war es für ihn wichtig, am Ort des ersten Bundes Gottes mit Israel durch Mose gewesen zu sein, um von nun an im Neuen Bund mit Gott durch Jesus Christus seine Zukunft zu gestalten. Auf jeden Fall machen die beiden Aussagen des Apostels deutlich, dass er sich in Geographie gut auskannte und es zu jener Zeit keine Zweifel über die Lage dieses Berges gab. Daher wäre es hier an der Reihe, die Zeitgenossen des Paulus in Bezug auf die Lage des Berges Sinai zu fragen. Josephus, der jüdische Historiker, der den Auszug der Israeliten sehr bunt beschreibt, macht zum Standort von Sinai keine Angaben. Dagegen berichtet der jüdische Philosoph Philon davon, dass der Berg Gottes östlich der Sinai-Halbinsel und südlich von Palästina lag (Philon aus Alexandrien, der jüdische Philosoph lebte von 15/10 v. bis 40 n. Chr). Aus der römischen Geschichte ist bekannt, dass im Jahre 64 des ersten vorchristlichen Jahrhunderts die Nabatäer (Petra) durch römische Legionäre besiegt wurden, doch erst im Jahr 106 n. Chr. wurde auch der heutige Sinai in die römische Provinz ‚Arabica-Petrae’ eingegliedert. Dieses Detail ist im Zusammenhang der Bemerkung des Paulus wichtig, dass der Berg Sinai sich in Arabien befindet. In der Zeit der Wirksamkeit des Paulus (ca. 34 – 65 n. Chr.) konnte Petra und Umgebung seit langem zu Arabien gezählt werden, jedoch noch nicht die gesamte Sinaihalbinsel. Ist also der Berg Horeb tatsächlich östlich der Aravasenke im nördlichen Arabien zu suchen?
3.3 Wo lag Kadesch Barnea?
Die Lokalisierung von Kadesch Barnea ist aus folgenden Gründen wichtig:
- Vn Kadesch Barnea sandte Mose die zwölf Kundschafter aus, um das Land Kanaan zu erkunden;
- Das Volk Israel lagerte dort eine lange Zeit;
- Wichtig ist die Lokalisierung auch, weil es von dort aus zeitliche Entfernungsangaben zum Berg Horeb hin gibt.
Die erste Erwähnung von Kadesch finden wir in 1Mose 14,7 im Zusammenhang einer kriegerischen Auseinandersetzung:
- „Danach wandten sie um und kamen nach En[8]-Mischpat, das ist Kadesch, und schlugen das ganze Land der Amalekiter, dazu die Amoriter, die zu Hazezon-Tamar wohnten.“
Kadesch wurde früher auch En Mischpat genannt, das heißt Quelle Mischpat. Eine erste Orientierung der Lage von Kadesch bekommen wir durch die Angabe der besiegten Volksgruppen, nämlich der Amalekiter und Amoriter. Das Wohngebiet von beiden lag im Süden Kanaans[9].
Einen weiteren wichtigen Hinweis zu diesem Ort finden wir in den südöstlichen und südlichen Grenzmarkierungen des Gebietes, welches Gott dem Volk Israel zugedacht hatte.
- „Der Südzipfel eures Gebietes soll sich erstrecken von der Wüste Zin an Edom entlang. Eure Grenze im Süden soll ausgehen vom Ende des Salzmeers, das im Osten liegt. Und sie soll südlich vom Skorpionensteig sich hinaufziehen und hinübergehen nach Zin und weitergehen südlich von Kadesch-Barnea und gelangen nach Hazar-Addar und hinübergehen nach Azmon und sich von Azmon ziehen an den Bach Ägyptens und ihr Ende sei an dem Meer“ (4Mose 34,3-5).
Ähnlich, aber auch etwas ergänzend beschreibt Josua die Südgrenze des Stammes Juda:
- „Das Los des Stammes „Juda“ für seine Geschlechter lag gegen die Grenze Edoms hin, nach der Wüste Zin zu im äußersten Süden. Seine Südgrenze ging vom Ende des Salzmeers[10], von seiner südlichen Spitze,und geht dann südwärts vom Skorpionensteig und geht weiter nach Zin[11] und führt hinauf südlich von Kadesch-Barnea bis hinüber nach Hezron und führt hinauf nach Addar und biegt um nach Karka und berührt Azmon und läuft aus am Bach Ägyptens[12], sodass das Ende der Grenze das Meer wird“ (Josua 15,1-4).
Der Vergleich mit dem Text aus 4Mose 20,16 ergibt den Anhaltspunkt, dass Kadesch Barnea an der Süd, bzw. Südostgrenze des Stammes Juda und des Landes Israel lag und eine gemeinsame Grenze im Südosten mit Edom[13] hatte.
- „Und siehe, wir sind in Kadesch, einer Stadt an deiner (Edoms) Grenze.“
Es bleibt festzustellen, wo heute der Ort Kadesch Barnea[14] zu suchen ist. Denn von hier aus versuchen wir erneut an den Berg Horeb zu gelangen. In 5Mose 1,2 lesen wir:
- „Elf Tagereisen weit ist es vom Horeb bis Kadesch-Barnea auf dem Wege zum Gebirge Seïr.“ „ἕνδεκα ἡμερῶν ἐν χωρηβ ὁδὸς ἐπ‘ ὄρος σηιρ ἕως καδης βαρνη.“
Es fällt auf, dass das Volk Israel vom Horeb her kommend, das Gebirge Seir überqueren, wahrscheinlicher jedoch südlich davon umgehen musste. Die Wendung: „Auf dem Wege über das Gebirge Seir“ könnte auch verstanden werden, dass zwischen Horeb und Kadesch das Edomgebirge lag.
Diese Strecke jedoch in elf Tagen zu Fuß zu bewältigen, ist keineswegs einfach und in der Tat benötigten die Israeliten dafür nicht elf Tage, sondern etwa zwei
Monate, eingeschlossen sind natürlich alle für das große Volk notwendigen Aufenthalte (siehe Abschnitt „Wanderung der Israeliten vom Horeb bis Kadesch Barnea“).
- „Da brachen wir auf vom Horeb und zogen durch die ganze Wüste, die groß und furchtbar ist, wie ihr gesehen habt, auf der Straße zum Gebirge der Amoriter[15], wie uns der HERR, unser Gott, geboten hatte, und kamen bis nach Kadesch-Barnea“ (5Mose 1,19).
Diese Wanderung vom Horeb bis Kadesch Barnea erfolgte im zweiten Jahr nach dem Auszug aus Ägypten (5Mose 1,22). Auch wird hier vermerkt, dass die Wüste, welche zwischen Horeb und Kadesch Barnea lag, „groß und furchtbar war“. Hier wäre also die Topographie von Kadesch Barnea aus in Richtung Ost bis Süd zu erkunden. Denn es gibt hauptsächlich zwei Gegenden, welche den Anspruch erheben, den Berg Horeb zu beheimaten, das ist die Region des Süd-Sinai (christliche Tradition) und die Region in Nordwestarabien.
In 1Kön 9,7-9 lesen wir von Elia, der aus der Gegend südlich von Beerscheba in Richtung Horeb aufbrach.
- „Und der Engel des HERRN kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir.Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht“ (1Kön 19,7-9).
Auf den ersten Blick scheint es, dass Elia nur bis zum Horeb 40 Tage und Nächte zu Fuß unterwegs war, doch im Text ist nicht die Distanz von Beerscheba bis zum Horeb betont, sondern, dass Elia durch die Kraft dieser Speise (insgesamt) 40 Tag/Nächte, ohne eine weitere Mahlzeit zu sich zu nehmen, unterwegs war. Dies wird auch noch durch die Tatsache unterstrichen, dass gerade bei besonderen Personen wie Mose, Elia und ebenso bei Jesus die vierzig Tage und Nächte ohne zu essen besonders betont werden (2Mose 34,28; Mt 4,1ff). Das heißt, dass Elia für den Weg bis zum Horeb und dann weiter bis Abel Mehola (dem Geburtsort Elisas (1Kön 19,16), welches in Gilead auf dem Weg nach Damaskus lag, wohin Elia nun gehen sollte) 40 Tage benötigte, und zwar ohne zu essen (1Kön 19,15ff).
Daher kann diese Zeitangabe nicht als Bemessungsgrundlage für die Entfernung Horeb – Kadesch Barnea[16] genutzt werden, wohl aber die Zeitangabe in 5Mose 1,2 wo es heißt: „Elf Tagereisen sind es vom Horeb bis Kadesch Barnea“ und wahrscheinlich im gewöhnlichen Karawanentempo und auf der Karawanenroute durch das Gebirge Seir.
Es bleibt festzustellen, wie viele Kilometer zum Beispiel Kaufleute damals in der Wüste an einem Tag gehen oder reiten konnten. Eine vorsichtige und vorläufige Schätzung ergäbe hier bei 25/30 km/Tag, mal 11 Tage 275 – 330 km Entfernung.
3.4 Das Wohngebiet Seir/Edom
Edom oder Esau siedelte auf dem Gebirge Seir. Die erste Erwähnung dieser Gebirgsregion ist in 1Mose 14,6-7:
- „Darum kamen Kedor-Laomer und die Könige, die mit ihm waren, im vierzehnten Jahr und schlugen die Refaïter zu Aschterot-Karnajim und die Susiter zu Ham und die Emiter in der Ebene Kirjatajim und die Horiter auf ihrem Gebirge Seïr bis El-Paran, das an die Wüste stößt.Danach wandten sie um und kamen nach En-Mischpat, das ist Kadesch, und schlugen das ganze Land der Amalekiter, dazu die Amoriter, die zu Hazezon-Tamar wohnten.“
Dies ereignete sich zur Zeit Abrahams, als er noch keine Kinder hatte. Das Gebirge Seir wurde also noch vor der Patriarchenzeit von den Horitern bewohnt. Doch weit nicht alle Horiter fielen in diesem Kampf, die meisten lebten dort weiter und vermehrten sich wieder. In 1Mose 36,20-21 lesen wir:
- „Die Söhne aber von Seïr, dem Horiter, die im Lande wohnten, sind diese: Lotan, Schobal, Zibon, Ana. Dischon, Ezer und Dischan. Das sind die Stammesfürsten der Horiter, Söhne des Seïr, im Lande Edom.“
So erkennen wir, dass dieses Gebirge den Namen von einem bekannten Horiter-Fürsten ‚Seir’ bekommen hatte. Später wurde es nach Esau/Edom Edomgebirge genannt.
Weiter geht aus dem Text hervor, dass einer der Enkel von Seir Ana[17] hieß.
- „Esau nahm sich Frauen von den Töchtern Kanaans: Ada, die Tochter Elons, des Hetiters, und Oholibama, die Tochter des Ana, des Sohnes Zibons, des Horiters“ (1Mose 36,2).
Auf diese Weise lässt sich auch erklären, warum sich Esau nach seinem Wegzug von Isaak in Seir niedergelassen hatte (1Mose 36,6). Auch wird dieser Stamm der Horiter geographisch indirekt zu Kanaan gerechnet.
Im Rückblick (5Mose 2,12) hebt Mose hervor, dass die Nachkommen Esaus die Horiter vertrieben, ja sogar vertilgten und an ihrer Statt auf dem Gebirge Seir wohnten.
Zur Zeit Davids erstreckte sich Edoms[18] Gebiet sogar bis an das Nordende des Schilfmeeres (Golf von Agaba).
- „Und Salomo baute auch Schiffe in Ezjon-Geber, das bei Elat liegt am Ufer des Schilfmeers im Lande der Edomiter“ (1Kön 9,26).
Doch zur Zeit des Auszuges war das Gebiet von Edom noch nicht so weit ausgedehnt. Auf manchen Bibelkarten wird das Gebirge Edom östlich der Arawasenke verzeichnet. Die Stadt Sela und Bozra gehen auf die Edomiter zurück.
Doch in der Patriarchenzeit waren diese Stämme zahlenmäßig noch recht überschaubar[19] (1Mose 32,7) und sie waren nicht die einzigen Stämme, die in jenen Gegenden siedelten. Darum kam es auch schon in jener Zeit zu Streit, Wohngebietswechsel oder auch Grenzverschiebungen.
Unter Esaus Nachkommen werden 12 Fürsten genannt (1Mose 36), daher verwundert es nicht, dass sie sich sehr rasch vermehrten und ihr Siedlungsgebiet nach Süden und Osten hin ausdehnten.
3.5 Das Volk der Amalekiter
Amalek war ein Enkel Esaus, so in 1Mose 36,12:
- „Und Timna war eine Nebenfrau des Elifas, des Sohnes Esaus; die gebar ihm Amalek.“
Die Amalekiter sind also Nachkommen von Esau und waren einer von den 12 bedeutenden edomitischen Stämme. Ihr Wohngebiet war zur Zeit der Wüstenwanderung Israels nördlich von Kadesch Barnea.
Die Amalekiter griffen die Nachhut Israels auf dem Weg zum Horeb an, und zwar in Refidim. Refidim war jedoch in der Nähe des Horeb, wahrscheinlich an der Westseite des Gebirges. Dies war auch der Ort, in dessen Nähe Mose auf Gottes Geheiß den Felsen schlug, so dass Wasser herauskam und das Volk und ihr Vieh trinken konnten (2Mose 16, 22ff).
Die erste Erwähnung der Amalekiter finden wir in 1Mose 14,7:
- „Danach wandten sie um und kamen nach En-Mischpat, das ist Kadesch[20], und schlugen das ganze Land der Amalekiter, dazu die Amoriter, die zu Hazezon-Tamar wohnten.“
Zur Patriarchenzeit gab es die Amalekiter natürlich noch nicht[21], doch in seinem schriftlichen Rückblick nennt Mose dieses Land so, wie es dann zur Zeit der Niederschrift besiedelt war.
Ihr Wohngebiet wird im folgenden Text ziemlich genau beschrieben, obwohl sie als Nomadenvolk auch sehr beweglich waren.
- „Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hetiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan“ (4Mose 13,29; 1Sam 15,5: 27,8).
Seit ihrer Frühzeit also und auch noch zur Zeit Davids und Sauls wohnten und operierten die Amalekiter im Südland (Negev). Zur Zeit des Aufenthaltes der Israeliten in Kadesch Barnea wohnten Amalekiter auch nördlich davon, nämlich auf dem Weg hinauf ins Bergland von Kanaan (4Mose 14,43).
Vom Südland aus greift dieser kriegerische Nomadenstamm Israels Nachhut an, als diese noch auf dem Weg zum Horeb sind. Im Rückblick erinnert Mose seinen Nachfolger Josua und das Volk Israel daran, wie heimtückisch Amalek vorging.
- „Denke daran, was dir die Amalekiter taten auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zogt: wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler erschlugen, alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst, und wie sie Gott nicht fürchteten“ (5Mose 25,17-18).
- „Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Refidim“ (2Mose 17,8).
Die erste Aussage wirft Licht auf die tückische und listige Taktik, welche die Amalekiter auf dem Wegabschnitt vom Schilfmeer bis Refidim angewandt hatten. Die zweite Aussage spricht von einem konkreten Kriegsüberfall der Amalekiter, als Israel in Refidim, kurz vor seinem Ziel, lagerte.
Geographisch gesehen kamen die Amalekiter von ihrem Stammesgebiet im sogenannten Südland, und von dort aus unternahmen sie ihre Raubzüge hinter den Israeliten her, die durch die Wüste weiter südlich in Richtung Osten zogen.
Nach geographischen Gesichtspunkten wäre es eher unwahrscheinlich, dass die Amalekiter weit in den südlichen Teil des Sinai vorgedrungen wären (die wasserreichste Oase des Südsinai ´Feiran´, 40 km nw vom Katharinenkloster, wird von einigen Forschern für das biblische Refidim gehalten). Von der Entfernung her für solche Angriffe wäre eher der Bereich im Osten der Sinaiwüste. Auch unter diesem Gesichtspunkt müßte der Berg Horeb eher östlich der Aravasenke gesucht werden.
4. Welches Gewässer ist mit dem Schilfmeer gemeint?
Der Hebräische Begriff `Yam Suph` wird in den deutschen Bibeln häufig mit Schilfmeer` oder ´Rotes Meer´übersetzt. Wie folgende Texte deutlich machen, bezieht sich diese Bezeichnung mal auf den Golf von Suez, mal auf den Golf von Agaba. Diese Tatsache erleichtert nicht gerade die Suche nach der Stelle des Durchzugs. Zunächst listen wir die Texte auf, die direkt und eindeutig mit der Bezeichnung Schilfmeer den Golf von Agaba meinen.
Die Israeliten mussten von Kadesch Barnea wegen ihres Ungehorsams und Unglaubens zurückkehren auf dem Weg, auf dem sie nach Kadesch gekommen waren.
- „Morgen wendet euch und zieht in die Wüste auf dem Wege zum Schilfmeer“ (4Mose 14,25).
Hier ist der Golf von Agaba gemeint, ebenso in den folgenden Paralelltexten:
- „Ihr aber, wendet euch und zieht wieder in die Wüste den Weg zum Schilfmeer“ (5Mose 1,40).
- „Dann wandten wir uns und zogen wieder in die Wüste auf der Straße zum Schilfmeer, wie der HERR zu mir gesagt hatte, und umzogen das Gebirge Seïr eine lange Zeit“ (5Mo 2,1).
Aus dem Kontext ist ersichtlich, dass das Volk Israel von Kadesch aus in Richtung Schilfmeer zog und zwar, dem Schilfmeer, welches sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gebirge Seir (Edom) befand, also dem Golf von Agaba.
- „Und ich will deine Grenze festsetzen von dem Schilfmeer bis an das Philistermeer und von der Wüste bis an den Euphratstrom. Denn ich will dir in deine Hand geben die Bewohner des Landes, dass du sie ausstoßen sollst vor dir her“ (2Mose 23,31).
Die Angaben dieser Außengrenzen für Israel geben einen Hinweiß, dass mit dem Schilfmeer in diesem Zusammenhang ebenfalls der Golf von Agaba gemeint ist. Die Südgrenze des Landes wird vom Nordwestende des Schilfmeeres[1] bis zum Philistermeer (Mittelmeer) am biblischen `Bach Ägypten` oder El Arisch markiert. Somit wird auch deutlich, dass die Sinaihalbinsel mit dem Golf von Suez nicht zum späteren Territorium Israels gehörte (vgl. dazu auch Josua 15,1-5).
Unvorstellbar, dass Gott das Volk Israel wieder zurück Richtung Ägypten zum Schilfmeer-Golf von Suez geschickt hätte, oder zu einem der Seen im Gebiet des heutigen Suezkanals. Dies wäre ja direkt in der Grenznähe der Ägypter gewesen. Nein, vielmehr ist hier der Golf von Agaba gemeint, der weit weg von dem ägyptischen Kernland liegt.
Jeftah erinnert den König der Ammoniter an die Zeit der Landnahme und erwähnt ebenfalls die Station am Schilfmeer bevor Israel zum Abschluß seiner Wanderung nach Kadesch kam. Auch in diesem Textzusammenhang ist der Golf von Agaba gemeint.
- „Denn als sie aus Ägypten heraufkamen, zog Israel durch die Wüste bis ans Schilfmeer und kam nach Kadesch“ (Ri 11,16).
Die wohl deutlichste Textstelle in Bezug auf das Schilfmeer, gleich Golf von Agaba, finden wir in 1Kön 9,26:
- „Und Salomo baute auch Schiffe in Ezjon-Geber, das bei Elat liegt am Ufer des Schilfmeers im Lande der Edomiter.“
Durch diese Texte wird sehr deutlich, dass mit dem hebr. Yam Suph – Schilfmeer, oder dem gr. erythra thalassa – Rotes Meer, sehr oft der Golf von Agaba gemeint ist.
Nun kommen wir zu den Texten, die mehr oder weniger offensichtlich den Golf von Suez meinen.
- „… und was er an der Heeresmacht der Ägypter getan hat, an ihren Rossen und Wagen, wie er das Wasser des Schilfmeers über sie brachte, als sie euch nachjagten und sie der HERR umkommen ließ, bis auf diesen Tag“ (5Mose 11,4).
Diese Stelle gibt zwar keinen eindeutigen Anhaltspunkt, dass hier der (verlängerte?) Golf von Suez gemeint ist, doch er ist das nächste Gewässer, das nach dem Auszug erwähnt wird. Ähnlich auch die folgende Stelle:
- „Danach führte ich euch und eure Väter aus Ägypten. Und als ihr ans Meer kamt und die Ägypter euren Vätern nachjagten mit Wagen und Gespannen ans Schilfmeer“ (Jos 24,6).
In all diesen Texten wird auch deutlich, dass es sich nicht um einen See (limni), sondern um ein Meer (thalassa) handelt. Die Annahme, dass die Seen nördlich des Suez damals mit dem Roten Meer verbunden waren hat etwas in sich.
Auch im Neuen Testament wird einige male auf die Geschichte vom Durchzug durchs Rote Meer Bezug genommen und an zwei Stellen wird in Anlehnung an die LXX dieses Meer (gr. ἐρυθρὰν θάλασσαν) `Rotes Meer` genannt.
- Apg 7,36 „οὗτοςἐξήγαγεναὐτοὺςποιήσαςτέρατακαὶσημεῖαἐνγῇΑἰγύπτῳκαὶἐνἐρυθρᾷ θαλάσσῃ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσεράκοντα. „Dieser (Mose) führte sie heraus und tat Wunder und Zeichen im Land Ägypten, am Roten Meer und in der Wüste vierzig Jahre.“
- Hebr 11,29 „Πίστειδιέβησαντὴνἐρυθρὰν θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς γῆς, ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι κατεπόθησαν.“ „Duch den Glauben durchzogen sie das Rote Meer wie durch trockenes Land, was die Ägypter auch versuchten und ertranken.“
Im Korintherbrief nimmt Paulus Bezug auf den Durchzug durchs (Rote) Meer:
- „Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer (thalassa) hindurchgegangen sind.und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden“ (1Kor 10,1-2).
Sowohl Stefanus als auch Paulus und der Hebräerbriefschreiber sprechen mit einer Selbstverständlichkeit von dem Durchzug Israels durch das Meer (Rotes Meer), jedoch ohne irgendwelchen Hinweiss zur Lokalität des Durchzuges zu machen.
In 2Mose 10,19 lesen wir: „καὶ μετέβαλεν κύριος ἄνεμον ἀπὸ θαλάσσης σφοδρόν καὶ ἀνέλαβεν τὴν ἀκρίδα καὶ ἐνέβαλεν αὐτὴν εἰς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν καὶ οὐχ ὑπελείφθη ἀκρὶς μία ἐν πάσῃ γῇ αἰγύπτου“- „Da wendete der HERR den Wind, sodass er sehr stark aus Westen kam; der hob die Heuschrecken auf und warf sie ins Schilfmeer, dass nicht eine übrig blieb in ganz Ägypten.“
Hier wird beschrieben wie der Herr einen starken Wind vom Meer kommen ließ (gemeint ist in der LXX wahrscheinlich das Mittelmeer) der alle Heuschrecken aufhob und ins Rote Meer warf. Es kann sich also um einen sehr starken NW Wind gehandelt haben.der die Heuschrecken in Richtung Südost wegblies, also in den Golf von Suez.
Die Einwohner von Jericho haben es damals auch mitbekommen „wie der HERR das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt“ (Josua 2,10).
Weitere Stellen, die vom Schilfmeer (Golf von Suez?) sprechen: Nehemia 9,9; Ps 106,7; Ps 106,9; Ps 106,22; Ps 136,13; Ps 136,15.
Damit kann festgehalten werden, dass beide Arme des Roten Meeres (Golf von Suez und Golf von Agaba) in der Bibel die gleiche Bezeichnung haben und daher lässt sich nur im Kontext feststellen, ob es sich um den Golf von Agaba oder den Golf von Suez handelt.
5. Die Reiserouten der Istaeliten
Die gesamte Route der Israeliten von Ägypten bis Kanaan kann in sechs unterschiedliche Etappen eingeteilt werden:
- Von Goschen bis zum Schilfmeer (diese Etappe dauerte nur enige Tage).
- Vom Schilfmeer bis zum Berg Sinai (diese Etappe dauerte etwa 44/45 Tage).
- Vom Berg Sinai bis Kadesch Barnea (diese Etappe dauerte etwa zweieinhalb Monate).
- Von Kadesch Barnea bis Kadesch Barnea (diese Etappe dauerte etwa achtunddreißig Jahre).
- Von Kadesch Barnea bis zum Jordantal (diese Etappe dauerte etwa acht Monate).
- Vom Jordfantal der Moabiter bis Gilgal bei Jerico (diese letzte Etappe dauerte knapp eine Woche).
Der Herr selbst befahl Mose die Wanderrouten der Israeliten nach deren Lagerplätzen aufzuschreiben.
- „Und Mose schrieb auf nach dem Befehl des HERRN ihre Wanderungen nach ihren Lagerplätzen. Dies sind ihre Lagerplätze auf ihren Wanderungen“ (4Mose 33,2ff).
5.1. Erste Etappe: Goschen (Ägypten) – Schilfmeer
Der Auszug geschah am 15. Abib/Nisan (das jüdische Kalenderjahr beginnt mit dem 1. Monat Abib. Dies entspricht in etwa unserem Ende März/Anfang April).
- „Sie zogen aus von Ramses am fünfzehnten Tag des ersten Monats, dem zweiten Tage des Passa, durch eine starke Hand, dass es alle Ägypter sahen“ (2Mose 12,2).
Der Auszug der Israeliten erfolgte aus der Stadt Ramses ´Pi Ramese´ – Stadt des Ramses. Diese Stadt war eine der Vorratsstädten, welche die Kinder Israel dem Pharao ausbauten. Sie lag, so die vorläufigen Ergebnisse der Forschung, im süd/östlichen Nildelta und geht auf das Jahr 1278 v. u. Z. zurück (Wikipedia). Von hier aus startete Mose mit den Israeliten, die im Stadtgebiet und Umgebung wohnten. Weil auch in 2Mose 13,20 als Ausgangort ´Sukkot´ erwähnt wird, könnte man annehmen, dass die Israeliten, welche in der Gegend oder Stadt Sukkot wohnten und arbeiteten, sich hier dem Hauptzug der von Ramses kommenden Israeliten anschlossen und somit ab hier das gesamte Volk aufbrach.
- „Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der nächste war. Denn Gott sagte: Damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen, und sie nicht nach Ägypten zurückkehren (gr. αποατρεψη)“ (2Mose 13,17 Elbf Üs).
Die sogenannte Via Maris führte von Unterägypten in Richtung NO entlang des Mittelmeeres durch das Gebiet der Philister. Dies wäre auch die kürzeste Strecke gewesen – 350-400 km bis Hebron.
Als die Israeliten von Ramses auszogen, lagerten sie sich in Sukkot (2Mose 12,37) und sie machten hier Halt. Dann zogen sie aus „von Sukkot und lagerten sich in Etam, das am Rande der Wüste liegt. „ἐξάραντες δὲ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ Σοκχωθ ἐστρατοπέδευσαν ἐν Οθομ παρὰ τὴν ἐρημον“ (2Mose 13,20). Bis Etam war wohl noch mehr oder weniger bewohntes Gebiet (wahrscheinlich Weideland), denn erst von hier an begann der Übergang zur Wüste. Ein neuer Wanderabschnitt für die Israeliten, der Vertrauen erforderte.
- „Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer“ – „καὶ ἐκύκλωσεν ὁ θεὸς τὸν λαὸν ὁδὸν τὴν εἰς τὴν ἐρημον εἰς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν“ (2Mose 13,18 LXX).
Die gr. Bezeichnung der Routenänderung (ἐκύκλωσεν) kann folgende Bedeutungen haben: ´umgehen´, ´umrunden´, ´um (ein Gebiet) herumziehen´, ´einen Umweg machen´, ´von der Route abzweigen´ (vgl. 4Mose 21,4; 5Mose 2,1; Ri 11,18). Die kürzere Route über das Philisterland kam auch deswegen nicht in Frage, weil Gott dem Mose am Dornbusch zugesagt hatte: „… Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe: Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge.“ Und dieser Berg (Horeb) befand sich nicht auf dem Weg durch das Philisterland, sondern wie schon im Abschnitt B dargelegt, im näheren Umfeld des Landes Midian, welches im Osten der Arawasenke lag. Gott führte das Volk auch nicht den direkten Weg (übliche Karawanenroute) nach Osten, sondern einen nicht gebahnten Weg durch die Wüste (Ps 107,4-9; eh 9,19). Die Karawanenroute nach Midian kannte Mose. Bei dieser Routenvariante hätte das Volk keine Wolken- und Feuersäule benötigt. Gott wollte das Volk einen Umweg nehmen lassen, damit sie ihre Abhängigkeit von ihm lernten und ihm durch die sichtbare Gegenwart (Wolken- und Feuersäule) folgten. Gott wollte Israel also einen für sie unbekannten Weg führen, damit sie lernten Gottes Führung zu vertrauen und Mose zu gehorchen (2Mose 14,31). Die Vormulierung „Gott führte das Volk einen Umweg“ bezieht sich zunächst auf die erste Etappe, aber auch auf die gesamte Wanderroute. Aus dem Text geht hervor, dass die Routenänderung bei Etam angeordnet wurde. Etam lag am westlichen Rande der gleichnamigen Wüste, welche sich östlich des Schilfmeeres erstreckte (4Mose 33,8).
Als Gott dem Mose am brennenden Busch erschien (2Mose 3,18) gab er ihm Anweisung an Pharao in Bezug auf die Mindestentfernung vom Ausgangsort: „Danach sollst du mit den Ältesten Israels hineingehen zum König von Ägypten und zu ihm sagen: Der HERR, der Gott der Hebräer, ist uns erschienen. So lass uns nun gehen drei Tagereisen weit in die Wüste, dass wir opfern dem HERRN, unserm Gott.“ Mose hält sich an diese zeitliche Bemessung der Distanz, die unbedingt notwendig war, um nicht die Ägypter in ihrem eigenen Land durch einen Hebräischen Opferritus zu provozieren (2Mose 5,3; 8,22-23). Gut möglich, dass die Entfernung von ´drei Tagesreisen´ ausreichte, um von Goschen aus die östliche Landesgrenze Ägyptens zu überqueren.
Gott kennt das Herz des Pharao, er kennt dessen geographische und topographische Kenntnisse ebenso gut wie sein strategisches Denken. Darum sagte der Herr zu Mose: „Rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren (ἀποστρέψαντες) und sich lagern bei Pi-Hahirot zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal-Zefon; diesem gegenüber sollt ihr euch lagern. Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten: Sie haben sich verirrt im Lande; die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage, und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, und die Ägypter sollen innewerden, dass ich der HERR bin. – Und sie taten so.“ „λάλησον τοι̃ς υἱοι̃ς Ισραηλ καὶ ἀποστρέψαντες στρατοπεδευσάτωσαν ἀπέναντι τη̃ς ἐπαύλεως ἀνὰ μέσον Μαγδώλου καὶ ἀνὰ μέσον τη̃ς θαλάσσης ἐξ ἐναντίας Βεελσεπφων ἐνώπιον αὐτω̃ν στρατοπεδεύσεις ἐπὶ τη̃ς θαλάσσης“ (2Mose 14,1-2 – LXX). Der gr, Begriff ´ἀποστρέψαντες´ wird in der Regel mit ´umkehren´ übersetzt (2Mose 13,17), allerdings ist in diesem Textzusammenhang nicht gemeint zum Ausgangspunkt (nach Ägypten) zurückzukehren, wie auch die Stelle aus 1Mose 18,22 deutlich macht „καὶ ἀποστρέψαντες ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες ἦλθον εἰς σοδομα“ – und die Männer (Engel) kehrten um von dort und kamen nach Sodom“. Wahrscheinlich sind die Israeliten schon eine Wegstrecke in Richtung Osten auf der Karawanenroute nach Arabien unterwegs gewesen, eben am Beginn der Wüste Etam/Schur, als Gott ihnen die Umkehr befahl. Da jedoch die Richtungsänderung mit einem klaren Ziel verbunden war (Pi Hachirot am Schilfmeer) deshalb ging es hier nicht einfach um ein Umkehren in Richtung Ausgangspunkt, sondern den bereits beschrittenen Weg verlassen und in Richtung Süden ausweichen zum Westufer des damaligen Schilfmeeres.
Trotz oder gerade wegen der Staatstrauer (Tod aller Erstgeborener) ließ Pharao sich über den Verlauf der Wanderung der Israeliten auf dem Laufenden halten (2Mose 14,5). Und nicht nur dies, sondern er erfährt, dass das Volk geflohen war. Dies konnte man erkennen an:
- dem Verhalten der Israeliten, die alles mitnahmen, was ihnen gehörte an beweglicher Habe;
- Und darüber hinaus noch Wertgegenstände von ihren ägyptischen Nachbarn gefordert hatten.
- Möglich ist auch, dass die eigentliche Zielsetzung der Israeliten – auszuwandern (nicht mehr zurückzukehren) – auch bis zu ihm kam. So lesen wir in 2Mose 14,5: „Als es dem König von Ägypten angesagt wurde, dass das Volk geflohen war, wurde sein Herz verwandelt und das Herz seiner Großen gegen das Volk und sie sprachen: Warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen?“
Während am Hof des Pharao über das weitere Vorgehen beratschlagt wird, bringen seine Späher ungewöhnliche Informationen über die oben beschriebene Routenänderung der Israeliten. Diese überraschende Änderung der Route hat beim Pharao die Schlußfolgerung ausgelöst: „Sie haben sich im Lande verirrt“ und weil sie in eine Art Sackgasse gerieten, sagte er: „Die Wüste hat sie eingeschlossen“. Zu beachten ist auch, dass die Israeliten sich noch oder wieder auf ägyptischem Territorium befanden. Die Routenänderung (Umkehr mit neuer Zielangabe) muss also bei Etam erfolgt sein (2Mose 14,1-4).
- „Von Etam zogen sie aus und blieben in Pi-Hahirot[2], das vor Baal-Zefon[3] liegt, und lagerten sich vor Migdol“ (4Mose 33,7; vgl. 2Mose 14,2).
Obwohl es bis heute noch keine übereinstimmende Erkenntnis gibt, wo genau der Durchzug der Israeliten stattfand, spricht doch einiges für den Bereich des heutigen Bittersee oder Timsahsee, welche aller wahrscheinlichkeit nach im Altertum mit dem heutigen Golf von Suez verbunden waren (Heinrich Graetz). „Die Söhne Israel aber waren auf trockenem Land mitten durch das Meer gegangen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken gewesen. So rettete der HERR an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen“ (2Mose 14,29-30).
Es ist hier nicht das Anliegen, die Details des Durchzugs zu kommentieren. Am östlichen Ufer des Schilfmeeres lagerte sich Israel. Es konnte durchaus zwei bis drei Tage gedauert haben, bis sie weiterzogen, denn nun hatten sie keine Eile mehr. Freude und Dankbarkeit erfüllte das Lager und es wurden zu Gottes Ehren Loblieder gesungen.
Tabelle der Lagerplätze während der ersten Etappe
| Zeitangabe | Ortsangabe | Ortsangabe | Textstelle |
| 15. Abib/Nisan | Goschen/Ramses | Goschen/Ramses | 2Mose 12,2 |
| Sukkot | Sukkot | 2Mose 12,37 | |
| Etam | Etam am Rande der Wüste | 2Mose 13,20 | |
| Zug durch die Wüste zum Meer | 2Mose 13,18 | ||
| Pi-Hahirot bei Migdol gegenüber von Baal Zephon | Pi-Hahirot bei Migdol gegenüber von Baal Zephon | 2Mose 14,2; 4Mose 33,7 | |
| Schilfmeer | Schilfmeer | 2Mose 14,14ff |
5.2 Zweite Etappe: Schilfmeer – Horeb/Sinai
Auf der Ostseite des Schilfmeeres lagerten die Israeliten, dankten Gott, lobten ihn für die wunderbare Errettung, die Frauen sangen unter der Führung von Miriam im Reigentanz zu seiner Ehre. „Als nun Israel die große Macht sah, die der HERR an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den HERRN, und sie glaubten an den HERRN und an seinen Knecht Mose“ (2Mose 14,31). In 4Mose 33,8 lesen wir die Kurzfassung des Durchzugs:
- „Von Pi-Hahirot zogen sie aus und gingen mitten durchs Meer in die Wüste und zogen drei Tagereisen in der Wüste (Etam/Schur) und lagerten sich in Mara“ (bitteres Wasser) vgl. mit 2Mose 14,22). „καὶ διέβησαν μέσον τῆς θαλάσσης εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν διὰ τῆς ἐρήμου αὐτοὶ καὶ παρενέβαλον ἐν πικρίαις“ (4Mose 33,8 LXX).
Hier muss vermerkt werden, dass nach 4Mose 33,8 (Elf. Üs) östlich des Schilfmeeres die Wüste Etam begann, in 2Mose 15,22 (Elf. Üs und LXX) steht „Wüste Schur“. Es kann also sein, dass beide Bezeichnungen für die gleiche Wüste verwendet wurden, denn aus ägyptischer Perspektive konnte diese Wüste Etam heißen, aus kanaanitischer Perspektive jedoch Schur wie folgender Text nahe legt: „Und sie (die Ismaeliten) wohnten von Hawila an bis nach Schur östlich von Ägypten“ (1Mose 25,18; vgl. dazu auch 1Mose 16,7; 20,1). Die Wüste Schur erstreckte sich also östlich des heutigen Suezkanals und zog sich vermutlich bis zum Bach Ägypten (El Arisch), dort schloss sich die Wüste Paran an. In 4Mose 33,9 wird dieser Dreitagewegabschnitt mit folgenden Worten beschrieben: „Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Schur. Und sie wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser“ (4Mose 33,9; vgl. 2Mose 15,22). Der Text legt nahe, dass die Israeliten nicht am Schilfmeer entlang Richtung Süden zogen, sondern „hinaus in die Wüste, oder hinein in die Wüste“ also in Richtung Osten. Mara war kein Ort, sondern diese Bezeichnung bekam der Lagerplatz wegen der bitteren Wasserquelle (2Mose 15,23). Mara lag also in der Wüste Schur. Nach dem Durchzug durchs Schilfmeer zogen die Israeliten hochmotiviert in die Wüste hinein, immer der Wolken,- und Feuersäule nach – es war also keine bekannte Karawanenstrasse, die sie in diesem Abschnitt zogen. Auf dieser Seite des Meeres brauchten sie sich auch nicht mehr zu fürchten, denn keiner jagte ihnen mehr nach. Es heißt im Text, dass das Volk in Mara lagerte, doch die Wasserquelle war ungenießbar, sehr bitter. „Da murrte das Volk wider Mose und sprach: Was sollen wir trinken“ (2Mose 15,24)? Zum zweitenmal murrt das Volk und diese Art ihre Unzufriedenheit auszudrücken werden sie noch öfters wiederholen. Diese Reaktion auf die ungünstigen Umstände drückt ihren Unglauben, ja Misstrauen gegen Gott aus. Nachdem Mose durch göttliche Anweisung die Quelle mit Hilfe eines bestimmten Holzes, das Gott ihm gezeigt hatte, trinkbar gemacht hatte, konnten die Israeliten dort ausruhen, ihre Wasservorräte auffüllen und schließlich weiterziehen. „Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte (prüfte) sie und sprach: Wirst du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe; denn ich bin der HERR, dein Arzt“ (2Mose 15,25b-27).
- „Von Mara zogen sie aus und kamen nach Elim; da waren zwölf Wasserquellen und siebzig Palmen und sie lagerten sich dort“ (4Mose 33,9; vgl. mit 2Mose 15,27)
Auch die Oase Elim lag in der Wüste. Für die Etappe Mara – Elim können wir ebenfalls drei Tagereisen ansetzen. Die zwölf Wasserquellen und siebzig Palmbäume können auch als symbolische Hinweise auf die zwölf Stämme Israels und ihre siebzig späteren Ältesten bezogen werden. Die Lage dieser Oase ist nicht leicht zu ermitteln, doch eine Wüstenoase wird immer in einer Niederung, einer Senke gebildet, oder sie ist von Bergen umgeben unterhalb derer sich Wasserguellen bilden. Eine Oase kann auch in einem Wadi entstehen, in dem nach den winterlichen Regenfällen genug Grundwasser gespeichert wird. In Elim handelte es sich nämlich um naturquellen (gr. πηγαι – pegai), nicht um von Menschen gegrabene Brunnen gr. φρέατα – freata). In dieser natürlichen Oase machten die Israeliten Rast, erholten sich von den Strapazen der mehrtätigen Wanderung, füllten ihre Wasservorräte auf und zogen weiter.
- „Von Elim zogen sie aus und lagerten sich am Schilfmeer“ (4Mose 33,10).
Entsprechend dieser Alternativroute, die weiter nach Osten verlief, kamen sie nun nach weiteren Tagereisen am Schilfmeer (Golf von Agaba) an. Im Abschnitt ´D´ konnte festgestellt werden, dass mit der Bezeichnung ´Schilfmeer´ häufig der heutige Golf von Agaba gemeint ist. Der Lagerplatz könnte demnach am Nordufer des Golfes bei Elat (Ezion Geber 1Kön 9,26) gesucht werden (auf ihren Wanderungen werden sie noch einige Male in dieser Gegend vorbeikommen, bzw. lagern – 4Mose 14,25; 5Mose 2,8). Auch diese Etappe könnte mit drei Tagereisen bemessen werden. Es sei denn, dass es zwischen Elim und dem Schilfmeer eine weitere, im Text nicht genannte, Station gab. Die Distanz vom Ostufer der südlichen Seen (Bittersee und Timsahsee) am heutigen Suezkanal bis zum Nordende des Golfes von Agaba beträgt etwa 220 km Luftlinie. Da angenommenwerden muss, dass die Israeliten nicht immer auf einer geraden Strecke wandern konnten, erhöht sich diese Distanz noch mehr. Entweder gab es auf dieser Wegstrecke
- noch weitere nicht genannte Rastplätze,
- oder die Tagesetappen waren größer als 70 km,
- oder sie gingen auch nachts, was durch die Aussage in Nehenia 9,19 als reale Möglichkeit angenommen werden kann, denn dort heißt es:
- „… Verließest du sie doch nicht in der Wüste nach deiner großen Barmherzigkeit, und die Wolkensäule wich nicht von ihnen am Tage, um sie auf dem Wege zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen auf dem Wege zu leuchten, den sie zogen.“ Der nächtliche Durchzug durch das Schilfmeer (2Mose 13,22) und der Text in 4Mose 14,14b „und dass du, HERR, vor ihnen hergehst in der Wolkensäule am Tage und in der Feuersäule bei Nacht“, bestätigen die Variante der Wanderung auch bei Nacht. So konnten sie durchaus die weite Distanz durch den mittleren Sinai in drei Dreitag/nacht-Etappen geschafft haben.
Hier am Nord und Ostufer des Golfes von Agaba konnten die Israeliten Rast machen, da es ausreichend Süßwasserquellen gab. Wenn sie bis jetzt auf ungebahntem Weg durch die weite Wüste gegangen waren, so mussten sie hier auf eine Karawanenkreuzung gekommen sein.
- „Vom Schilfmeer zogen sie aus und lagerten sich in der Wüste Sin“ (4Mose 33,11).
Der Parallelbericht in 2Mose 16 nennt die Station am Schilfmeer nicht, macht aber die Bemerkung, dass die Wüste Sin zwischen Elim und Sinai sich erstreckt, dort lesen wir: „Von Elim zogen sie aus und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am fünfzehnten Tage des zweiten Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren“ (2Mose 16,1). Seit dem Auszug ist ein Monat vergangen. Hier in der Wüste Sin gingen den Israeliten die letzten Vorräte an Brot aus, denn nach ihrem Murren gab Gott ihnen das Manna und dazu auch noch Fleisch (2Mose 16,1ff). Dieser Ort oder Rastplatz in der „Wüste Sin“ bekommt keinen Namen, dafür jedoch sowohl eine inhaltliche (Massa und Meriba) als auch eine zeitliche Markierung.
Der inhaltliche Aspekt:
„Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des HERRN Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Da sprach der HERR zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich’s prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht“ (2Mose 16,2-4). Wir stellen hier fest, dass die Israeliten schon zum dritten Mal ihre Unzufriedenheit durch Murren ausdrücken – es drückt ihren Mangel an Glauben und Gottvertrauen aus. Aber Gott kannte ihren Bedürfnisse und gab ihnen das Manna (Brot vom Himmel) vierzig Jahre lang. Erst in Gilgal (Kanaan) hörte das Manna auf (Josua 5,12). Wieder wird im Text betont, dass Gott das Volk Israel durch diese Situation prüft. Die Zugabe an Fleisch durch die Wachteln sollte sich im darauffolgenden Jahr wiederholen (4Mose 11,31). Es handelte sich dabei um Zugvögel, die um diese Frühlingszeit (Ende April/Anfang Mai) von Afrika aus in den nördlichen Sommer unterwegs waren. „Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag’s in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander: Man hu1? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der HERR zu essen gegeben hat“ (2Mose 16,13-15). Im Zusammenhang der sogenannten Brotrede in der Synagoge von Kapernaum bestätigt Jesus dieses dieses Wüstenerlebnis und deutet es auf sich, das wahre Brot vom Himmel (Joh 6,32).
Der zeitliche und räumliche Aspekt:
Wie weit konnten also die Israeliten in einem Monat (29-30 Tage) gekommen sein? Die Wüste Sin (nicht zu verwechseln mit der Wüste Zin (die in der LXX die gleiche Schreibweise hat) lag also zwischen Elim und der Wüste Sinai. Sie lag hinter (nach) dem Rastplatz am Schilfmeer. Ausgehend von dieser Alternativroute könnte sie in nordöstlicher, östlicher oder südöstlicher Richtung von Agaba gesucht werden. Östlich von Agaba auf einem Hochplateau (800 Meter über dem Meeresspiegel) erstreckt sich die Sandwüste des Wadi Rum (100×60 km), die von zahlreichen Felsen und Bergen durchsetzt ist und hier gibt es genug Wasserquellen. Beachten wir, dass sich die Israeliten in der Wüste Sin nicht über Wassermangel beklagen, sondern über den Mangel an Brot. Wir wissen, dass zum überleben Wasser wichtiger ist als Brot. Also muss es in dieser Wüste Wasser gegeben haben. Und diese Wüste muss sich in Reichweite der Zugvögel-Route (Rotes Meer-Araba-Jordantal) befunden haben, was laut dem Kontext der Fall war. Auch in Richtung Südosten von Agaba erstreckt sich auf einer Hochebene eine weite Wüstenlandschaft, die sich im heutigen Grenzgebiet zwischen Jordanien und Saudiarabien erstreckt.
Vom Auszug aus Ägypten am 15. Tag des ersten Monats bis zum Rastplatz in der Wüste Sin (15. Tag des zweiten Monats) ist ein Monat (29-30 Tage) vergangen. Nach vorläufiger und vorsichtiger Schätzung haben sie sich etwa 400 km von ihrem Ausgangsort entfernt.
- „Von der Wüste Sin zogen sie aus und lagerten sich in Dofka“ (4Mose 33,12). Zum Lagerplatz Dofka gibt es keine weiteren Hinweise im biblischen Text.
- „Von Dofka zogen sie aus und lagerten sich in Alusch“ (4Mose 33,13). Auch über diesen Ort geben uns biblische Texte keine weiteren Auskünfte.
- „Von Alusch zogen sie aus und lagerten sich in Refidim; dort hatte das Volk kein Wasser zu trinken“ (4Mose 33,14). Der Paralellbericht aus 2Mose 17,1-3 ergänzt:
„Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter ihre Tagereisen, wie ihnen der HERR befahl, und sie lagerten sich in Refidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie haderten mit Mose und sprachen: Gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen: Was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den HERRN? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wider Mose und sprachen: Warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt“ (2Mose 17,1-4)? Es ist nun das vierte Mal, dass das Volk gegen Gott murrt. Dieser Ort wird daher Massa und Meriba genannt, weil das Volk dort gemurrt hatte.
Der Durst ist eine schreckliche körperliche Entbehrung. Erst hier in Refidim wird also ausdrücklich hervorgehoben, dass es kein Wasser zum Trinken gab, dagegen muss es an den vorherigen Rastplätzen (Dofka, Alusch) genügend Wasser gegeben haben.
Der Südroute (Wanderung der Israeliten über den Südsinai) entsprechend wird Refidim mit dem heutigen Wadi Feiran in Verbindung gebracht und betont, dass diese Oase damals besiedelt war und zwar von den Amalekitern. Doch im biblischen Bericht heißt es ausdrücklich, dass das Volk dort kein Wasser hatte. Demnach gab es dort weder eine Oase mit Ansiedlungen von Stämmen, noch ansässige Amalekiter, deren Stammesgebiet eher im südlichen Negev zu suchen ist. Refidim war also vorher keine Oase, sie wurde es möglicherweise durch das Wasser, welches nun aus oder unterhalb des Felsens herausfloss durch Gottes Eingreifen. „Mose schrie zum HERRN und sprach: Was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Der HERR sprach zu ihm: Tritt hin vor das Volk und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel“ (2Mose 17,4-6). Dieser Felsen, aus dem Wasser hervosprudelte wird nun zu einem Hinweiss auf Christus, welcher im Neuen Testament als `η πετρα – der Fels` bezeichnet wird, auf dem er seine Gemeinde baut und der schon damals das Volk in der Wüste geleitete (Mt 7,24; 16,18; 1Kor 10,4). In Refidim geschah noch etwas sehr Einschneidendes für Israel. Die Amalekiter verfolgten die Israeliten seit geraumer Zeit auf dem Weg durch die Wüste, wie Mose in seiner Erinnerung festhält: „Denke daran, was dir die Amalekiter taten auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zogt: wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler erschlugen, alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst, und wie sie Gott nicht fürchteten“ (5Mose 25,17-19). Aber erst in Refidim überfielen sie Israel in einem offenen Kampf welchen die Israeliten unter der Führung Josuas und dem Gottvertrauen des Mose letztlich gewannen (2Mose 17,13).
Geographisch gesehen ist Refidimmit seinem Felsen in mittelbarer Nähe des Horeb und bildetedie letzte Station vor ihrem Ziel. In Refidim lagerten die Israeliten wohl mehrere Tage, bevor sie sich zu ihrer letzten Wegstrecke aufmachten.
- „Von Refidim zogen sie aus und lagerten sich in der Wüste Sinai“ (4Mose 33,15).
Refidim muss sich also noch in der Wüste Sin befunden haben, während der Lagerplatz am Sinai sich eindeutig in der Wüste Sinai befand. Vorstellbar wäre, dass Refidim an einer Seite (eventuell Westseite) des Gebirges Horeb gelegen hatte und die Sinaiwüste auf der anderen Seite (Ostseite?), wo der Zugang zum Berg oder auf den Berg geeigneter war.
Dafür gibt es folgende Begründungen: Erstens kamen die Israeliten vom Westen her und zweitens blickte die spätere Stiftshütte und auch der Tempel mit dem Eingang nach Osten hin, so könnte man ableiten, dass Gott sich vom Berge Horeb zum Volk in Richtung Osten wendete. Unterhalb vom heutigen Jebel Musa (Mosesberg) in Richtung Osten gibt es keine flache Wüstenebene, wo das Volk hätte lagern können. Dort sind nur steile und unzugängliche Abhänge, die das Lagern eines so großen Volkes unmöglich gemacht hätten. Nur im Nordwesten etwa 2-3 km weit unterhalb des niedrigeren Berges Safsafe gibt es eine Flache von hohen Bergen umgebene Ebene in etwa 1500 m Höhe. In den Wintermonaten Januar/Februar können die Temperaturen bis unter den Gefrierpunkt fallen, was für eine Überwinterung von so vielen Menschen an diesem Ort nicht einfach gewesen wäre. Auch ist von dieser Ebene aus, der sogenannte Mosesberg in 2285 m Höhe, gar nicht zu sehen, was jedoch in den biblischen Berichten deutlich hervorgehoben wird (z.B. 4Mose 3,38).
- „Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Refidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der HERR rief ihm vom Berge zu und sprach“ (2Mose 19,1-3).
Auf den Tag genau sechs Wochen waren die Israeliten unterwegs bis zum Berg Horeb. Hier blieben sie nun fast ein ganzes Jahr und hier schloss Gott mit Israel den Bund. Hier wurde auf Befehl Gottes und nach genauen Anweisungen die Stiftshütte gebaut.
Lagerpätze der Israeliten während der zweiten Etappe
| Nach drei Tagen | Wüste Schur | Wüste (Etam?) | 2Mose 15,224Mose 33,8 |
| Mara | Mara | 2Mose 15,22; 4Mose 33,8 | |
| Oase Elim | Oase Elim | 2Mose 15,274Mose 33,9 | |
| Schilfmeer (Golf v. Agaba?) | 4Mose 33,10-11 | ||
| 15. Tag des zweiten Monats n. Auszug aus Äg. | Ankunft in der Wüste Sin | Wüste Sin | 2Mose 16,14Mose 33,11 |
| Dofka | 4Mose 33,12 | ||
| Alusch | 4Mose 33,13 | ||
| Refidim | Refidim | 2Mose 17,14Mose 33,14 | |
| Am 1. Tag des 3. Monats n. Auszug aus Ägypten | In der Wüste Sinai gegenüber dem Berge Horeb | Wüste Sinai | 2Mose 19,1-34Mose 33,15 |
[1] Die Annahme, dass mit dem Schilfmeer einer der Seen zwischen Suez und Port-Said gemeint wäre, macht bei der obigen Grenzbeschreibung aus 2Mose 23,31wenig Sinn, da es sich dort nur um einen kurzen Abschnitt handelt und auch in späterer Geschichte Israels niemals als Grenze zu Ägypten beschrieben wird.
5.3 Dritte Etappe: Berg Sinai – Kadesch Barnea
(4Mose 10,28-13,3; 1Kor 10,10-13)
In 4Mose 10,11-12 wird sozusagen der Ausgangspunkt und Endpunkt der Route vom Sinai bis Kadesch Barnea beschrieben:
- „Am zwanzigsten Tage im zweiten Monat des zweiten Jahres erhob sich die Wolke von der Wohnung des Gesetzes. Und die Israeliten brachen auf aus der Wüste Sinai und die Wolke machte Halt in der Wüste Paran.“
In 5Mose 33,2-3 beschreibt Mose gewissermaßen sprunghaft die Stationen der Gottesbegleitung vom Sinai bis Kadesch.
- „Er sprach: Der HERR ist vom Sinai gekommen und ist ihnen aufgeleuchtet von Seïr her. Er ist erschienen vom Berge Paran her und ist gezogen nach Meribat-Kadesch; in seiner Rechten ist ein feuriges Gesetz für sie.“
Eine weitere Kurzfassung dieser Reiseetappe wird wie folgt besschrieben:
- „Da brachen wir auf vom Horeb und zogen durch die ganze Wüste, die groß und furchtbar ist, wie ihr gesehen habt, auf der Straße zum Gebirge der Amoriter, wie uns der HERR, unser Gott, geboten hatte, und kamen bis nach Kadesch-Barnea“ (5Mose 1,19).
Und in 4Mose 33 wird diese Wanderung mit der Nennung einiger weiterer Stationen und Ereignisse beschrieben:
- „Von der Wüste Sinai zogen sie aus und lagerten sich bei den Lustgräbern“ (4Mose 33,16).
- “So zogen sie von dem Berge des HERRN drei Tagereisen weit, und die Lade des Bundes des HERRN zog vor ihnen her die drei Tagereisen, um ihnen zu zeigen, wo sie ruhen sollten. Und die Wolke des HERRN war bei Tage über ihnen, wenn sie aus dem Lager zogen“ (4Mose 10,33-34).
Nach drei Tagen machten sie Halt, weil unter dem Volk einige anfingen zu murren, dass es ihnen so schlecht ginge. Gott versorgte sie mit Fleisch (Wachteln) und strafte sie, so dass viele vom Volk starben.
- „Daher heißt die Stätte »Lustgräber«, weil man dort das lüsterne Volk begrub. Von den »Lustgräbern« aber zog das Volk weiter nach Hazerot und sie blieben in Hazerot“ (4Mose 11,34-35; 4Mose 33,17).
In Hazerot machten Miriam und Aaron einen Aufstand gegen Mose mit der Folge, dass Miriam aussätzig wurde. Da blieb die Gemeinde Israel mindestens sieben Tage, bis Miriam wieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden konnte.
- „So wurde Mirjam sieben Tage abgesondert außerhalb des Lagers. Und das Volk zog nicht weiter, bis Mirjam wieder aufgenommen wurde.“
- „Von Hazerot zogen sie aus und lagerten sich in Ritma“ (4Mose 33,18).
- Danach brach das Volk von Hazerot auf und lagerte sich in der Wüste Paran“ (4Mose 33,18; 4Mose 12,15-16).
Auf dem Weg nach Kadesch durchzogen oder umgingen die Israeliten Edom, denn so wird es angedeutet in 5Mose 33,2-3:
- „Er sprach: Der HERR ist vom Sinai gekommen und ist ihnen aufgeleuchtet von Seïr her. Er ist erschienen vom Berge Paran her und ist gezogen nach Meribat-Kadesch“.
Das heißt, dass zwischen Sinai und Kadesch lagen auf ihrer Wanderroute das Gebirge Seir, danach der Berg Paran (in der Wüste Paran) danach kamen sie nach Kadesch. Kadesch Barnea lag wahrscheinlich am nördlichen Rand der Wüste Paran.
Nach 4Mose 13,20 sandte Mose die Kundschafter aus zur Zeit der frühen Weinlese.
- „Es war aber eben um die Zeit der ersten Weintrauben“.
Somit lässt sich eine ungefähre Wanderzeit der Israeliten vom Horeb bis Kadesch Barnea ausrechnen. Aufbruch vom Horeb am zwanzigsten Tag des zweiten Monats (av Mitte Mai) Beginn der frühen Traubenernte etwa Mitte Juli, das ergäbe eine Wanderzeit von etwa acht Wochen (sechsundfünfzig Tage) einschließlich der Aufenthalte.
Von hier sandte Mose auf Anordnung Gottes zwölf Kundschafter aus, um das Land Kanaan zu erkunden.
Tabelle der Lagerplätze während der dritten Etappe
| 20. Tag des 2. Monats im 2. Jahr n. Ausz. aus Äg. | Aufbruch vom Horeb | Nach Kadesch Barnea | 5Mose 33,2-3 |
| Drei Tagereisen in der Wüste Sinai | 4Mose 10,33-34 | ||
| Tabeera – Feuer bricht aus | 4Mose 11,3 | ||
| Lustgräber – das Volk murrt, die Strafe-folgt | Lustgräber | 4Mose 11,4-344Mose 33,16 | |
| 7 Tage Aufenthalt | HazerotMiriam wird aussätzig | Hazerot | 4Mose 11,34-354Mose 33,17 |
| Gebirge Seir | 5Mose 33,2-3 | ||
| Wüste Paran | 4Mose 12,164Mose 33,18 | ||
| Berg Paran | 5Mose 33,2-3 | ||
| Zur Zeit der frühen Traubenernte – ab Mitte Juli | Meribat-Kadesch | Ritma | 5Mose 33,2-34Mose 33,18 |
| Aufenthalt in Kadesch etwa 2 Monate | Aussendung der Kundschafter |
Fragen:
- Wann brachen die Israeliten vom Berg Horeb auf?
- Wie lange dauerte die Wanderung der Israeliten vom Horeb bis nach Kadesch Barnea?
- Welche beiden Berge oder Bergregionen werden auf dieser Reiseetappe ausdrücklich erwähnt?
- Wie wird die große Wüste, welche die Israeliten durchquerten charakterisiert?
- Welche Ereignisse werden uns auf dieser Etappe beschrieben und mit welchen Konsegquenzen/Folgen?
- Wo lag der Ort, oder die Gegend von Kadesch Barnea?
- Warum hat Kadesch eine so große Bedeutung in der Geschichte Israels?
4Mose 13,1-33 -5Aussendung und Rückkehr der Kundschafter
1 1Und der HERR redete mit Mose und sprach:
2 Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will, aus jedem Stamm ihrer Väter je einen Mann, lauter Älteste.
3 Da entsandte Mose aus der Wüste Paran nach dem Wort des HERRN lauter Männer, die Häupter waren unter den Israeliten.
4 Und sie hießen: Schammua, der Sohn Sakkurs, vom Stamme Ruben;
5 Schafat, der Sohn Horis, vom Stamme Simeon;
6 Kaleb, der Sohn Jefunnes, vom Stamme Juda;
7 Jigal, der Sohn Josefs, vom Stamme Issachar;
8 Hoschea, der Sohn Nuns, vom Stamme Ephraim;
9 Palti, der Sohn Rafus, vom Stamme Benjamin;
10 Gaddiël, der Sohn Sodis, vom Stamme Sebulon;
11 Gaddi, der Sohn Susis, vom Stamme Josef, von Manasse;
12 Ammiël, der Sohn Gemallis, vom Stamme Dan;
13 Setur, der Sohn Michaels, vom Stamme Asser;
14 Nachbi, der Sohn Wofsis, vom Stamme Naftali;
15 Gëuël, der Sohn Machis, vom Stamme Gad.
16 Das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, um das Land zu erkunden. Aber Hoschea, den Sohn Nuns, nannte Mose Josua.
17 Als sie nun Mose aussandte, das Land Kanaan zu erkunden, sprach er zu ihnen: Zieht da hinauf ins Südland und geht auf das Gebirge
18 und seht euch das Land an, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, ob’s stark oder schwach, wenig oder viel ist;
19 und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob’s gut oder schlecht ist; und was es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder festen Städten wohnen;
20 und wie der Boden ist, ob fett oder mager, und ob Bäume da sind oder nicht. Seid mutig und bringt mit von den Früchten des Landes. Es war aber eben um die Zeit der ersten Weintrauben.
21 Und sie gingen hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis nach Rehob, von wo man nach Hamat geht.
22 Sie gingen hinauf ins Südland und kamen bis nach Hebron; da lebten Ahiman, Scheschai und Talmai, die Söhne Anaks. Hebron aber war erbaut worden sieben Jahre vor Zoan in Ägypten.
23 Und sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab mit „einer“ Weintraube und trugen sie zu zweien auf einer Stange, dazu auch Granatäpfel und Feigen.
24 Der Ort heißt Bach Eschkol2 nach der Traube, die die Israeliten dort abgeschnitten hatten.
25 Und nach vierzig Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um,
26 gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesch und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen.
27 Und sie erzählten ihnen und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandtet; es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies sind seine Früchte.
28 Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß; und wir sahen dort auch Anaks Söhne.
29 Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hetiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan.
30 Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte, und sprach: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen.
31 Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu stark.
32 Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge.
33 Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen, und wir waren in unsern Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen.
4Mose 14,1-45
Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht.
2 Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in dieser Wüste stürben!
3 Warum führt uns der HERR in dies Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist’s nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten?
4 Und einer sprach zu dem andern: Lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen!
5 Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten.
6 Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider
7 und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut.
8 Wenn der HERR uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt.
9 Fallt nur nicht ab vom HERRN und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der HERR aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen!
10 Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des HERRN über der Stiftshütte allen Israeliten.
11 Und der HERR sprach zu Mose: Wie lange lästert mich dies Volk? Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe?
12 Ich will sie mit der Pest schlagen und sie vertilgen und dich zu einem größeren und mächtigeren Volk machen als dieses.
13 Mose aber sprach zu dem HERRN: Dann werden’s die Ägypter hören; denn du hast dies Volk mit deiner Kraft aus ihrer Mitte herausgeführt.
14 Auch wird man es sagen zu den Bewohnern dieses Landes, die da gehört haben, dass du, HERR, unter diesem Volk bist, dass du von Angesicht gesehen wirst und deine Wolke über ihnen steht und dass du, HERR, vor ihnen hergehst in der Wolkensäule am Tage und in der Feuersäule bei Nacht.
15 Würdest du nun dies Volk töten wie „einen“ Mann, so würden die Völker, die solch ein Gerücht über dich hören, sagen:
16 Der HERR vermochte es nicht, dies Volk in das Land zu bringen, das er ihnen zu geben geschworen hatte; darum hat er sie hingeschlachtet in der Wüste.
17 So lass nun deine Kraft, o Herr, groß werden, wie du gesagt hast:
18 »Der HERR ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat und Übertretung, aber er lässt niemand ungestraft, sondern sucht heim die Missetat der Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied.«
19 So vergib nun die Missetat dieses Volks nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher.
20 Und der HERR sprach: Ich habe vergeben, wie du es erbeten hast.
21 Aber so wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des HERRN voll werden soll:
22 Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste, und mich nun zehnmal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben,
23 von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe; auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat.
24 Nur meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen,
25 während die Amalekiter und Kanaaniter in der Ebene wohnen bleiben. Morgen wendet euch und zieht in die Wüste auf dem Wege zum Schilfmeer!
26 Und der HERR redete mit Mose und Aaron und sprach:
27 Wie lange murrt diese böse Gemeinde gegen mich? Ich habe das Murren der Israeliten, womit sie gegen mich gemurrt haben, gehört.
28 Darum sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht der HERR: ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt.
29 Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid von zwanzig Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt,
30 wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jefunnes, und Josua, dem Sohn Nuns.
31 Eure Kinder aber, von denen ihr sagtet: Sie werden ein Raub sein, die will ich hineinbringen, dass sie das Land kennen lernen, das ihr verwerft.
32 Aber eure eigenen Leiber sollen in dieser Wüste verfallen.
33 Und eure Kinder sollen Hirten sein in der Wüste vierzig Jahre und eure Untreue tragen, bis eure Leiber aufgerieben sind in der Wüste.
34 Nach der Zahl der vierzig Tage, in denen ihr das Land erkundet habt – je ein Tag soll ein Jahr gelten -, sollt ihr vierzig Jahre eure Schuld tragen, auf dass ihr innewerdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe.
35 Ich, der HERR, habe es gesagt und wahrlich, das will ich auch tun mit dieser ganzen bösen Gemeinde, die sich gegen mich empört hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden und dort sterben.
36 So starben vor dem HERRN durch eine Plage alle die Männer, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden, und die zurückgekommen waren und die ganze Gemeinde gegen ihn zum Murren verleitet hatten,
37 dadurch dass sie über das Land ein böses Gerücht aufbrachten.
38 Aber Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, blieben am Leben von den Männern, die gegangen waren, um das Land zu erkunden.
39 Als Mose diese Worte allen Israeliten sagte, da trauerte das Volk sehr.
40 Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen auf die Höhe des Gebirges und sprachen: Hier sind wir und wollen hinaufziehen in das Land, von dem der HERR geredet hat; denn wir haben gesündigt.
41 Mose aber sprach: Warum wollt ihr das Wort des HERRN übertreten? Es wird euch nicht gelingen.
42 Zieht nicht hinauf – denn der HERR ist nicht unter euch -, dass ihr nicht geschlagen werdet vor euren Feinden.
43 Denn die Amalekiter und Kanaaniter stehen euch dort gegenüber und ihr werdet durchs Schwert fallen, weil ihr euch vom HERRN abgekehrt habt, und der HERR wird nicht mit euch sein.
44 Aber sie waren so vermessen und zogen hinauf auf die Höhe des Gebirges; aber die Lade des Bundes des HERRN und Mose wichen nicht aus dem Lager.
45 Da kamen die Amalekiter und Kanaaniter, die auf dem Gebirge wohnten, herab und schlugen und zersprengten sie bis nach Horma.
„Da kamen die Amalekiter und Kanaaniter, die auf dem Gebirge wohnten, herab und schlugen und zersprengten sie bis nach Horma“ (4Mose 14,45).
5.4 Vierte Etappe: Kadesch Barnea – Bach Sered
Bereits nach eineinviertel Jahr hätte Israel mit der Landnahme beginnen können, doch nun sind sie verurteilt weitere 38 Jahre in der Wüste umherziehen.
Folgende Stationen und Ereignisse sind in den Texten aufgeführt:
Zunächst ordnet Gott an, dass das Volk umkehren soll und sich in Richtung Schilfmeer ziehen.
- „Morgen wendet euch und zieht in die Wüste auf dem Wege zum Schilfmeer“ (4Mose 14,25).
Hier in diesem Zusammenhang ist das Schilfmeer – Golf von Agaba gemeint, denn es wäre höchst ungewöhnlich, würde Gott das Volk zurück an die ägyptische Grenze (Golf von Suez) lenken. „αὔριον ἐπιστράφητε ὑμεῖς καὶ ἀπάρατε εἰς τὴν ἔρημον ὁδὸν θάλασσαν ἐρυθράν
- „Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen auf die Höhe des Gebirges und sprachen: Hier sind wir und wollen hinaufziehen in das Land, von dem der HERR geredet hat; denn wir haben gesündigt“ (4Mose 14,40; Vgl. 5Mose 1,41-42)
- „Als ihr nun wiederkamt und vor dem HERRN weintet, wollte der HERR eure Stimme nicht hören und neigte seine Ohren nicht zu euch. So bliebt ihr in Kadesch eine lange Zeit“ (5Mose 1,45-46).
Demnach sind die Israeliten nicht am nächsten Morgen aufgebrochen, wie der Herr ihnen geboten hatte, sondern sind nach der Niederlage noch lange in Kadesch Barnea geblieben.
- „Von Ritma zogen sie aus und lagerten sich in Rimmon-Perez“ (4Mose 33,19).
Lagerplätze der Israeliten von Ritma – Gebirge der Moabiter
| Ritma | 4Mose 33,18 | ||
| Rimmon-Perez | 4Mose 33,19 | ||
| Libna | 4Mose 33,20 | ||
| Rissa | 4Mose 33,21 | ||
| Kehelata | 4Mose 33,22 | ||
| Gebirge Schefer | 4Mose 33,23 | ||
| Harada | 4Mose 33,24 | ||
| Makhelot | 4Mose 33,25 | ||
| Tahat | 4Mose 33,26 | ||
| Tarach | 4Mose 33,27 | ||
| Mitka | 4Mose 33,28 | ||
| Haschmona | 4Mose 33,29 | ||
| Moserot | 4Mose 33,30 | ||
| Bene-Jaakan | 4Mose 33,31 | Beerot-Bene-Jaakan | 5Mose 10,6 |
| Hor-Gidgad | 4Mose 33,32 | Moser (Aarons Tod) | 5Mose 10,6 |
| Gudgoda | 5Mose 10,7 | ||
| Jotbata | 4Mose 33,33 | Jotbata (Land mit vielen Wasserbächen) | 5Mose 10,7 |
| Abrona | 4Mose 33,34 | ||
| Ezjon-Geber“ | 4Mose 33,35 | ||
| Wüste Zin, das ist Kadesch | 4Mose 33,36 | Wüste Zin im ersten Monat (39 Jahres) Lagerplatz in KadeschMiriams Tod | 4Mose 20,1 |
| Berge HorAarons Tod | 4Mose 33,37-39 | Berg Hor[1]im 40. Jahr am ersten Tag des fünften Monats | 4Mose 20,22-29 |
| Zalmona | 4Mose 33,41 | ||
| Punon | 4Mose 33,42 | ||
| Obot | 4Mose 33,43 | 4Mose 21,10 | |
| Ije-Abarim, im Gebiet der Moabiter | 4Mose 33,44 | ||
- „Von Hor-Gidgad zogen sie aus und lagerten sich in Jotbata“ (4Mose 33,33).
- „Von Jotbata zogen sie aus und lagerten sich in Abrona“ (4Mose 33,34).
- „Von Abrona zogen sie aus und lagerten sich in Ezjon-Geber“ (4Mose 33,35; 1Kön 9,26; 1Kön 22,49).
- „Von Ezjon-Geber zogen sie aus und lagerten sich in der Wüste Zin, das ist Kadesch. (4Mo 20,1
36 Von Ezjon-Geber zogen sie aus und lagerten sich in der Wüste Zin, das ist Kadesch.
374Mose 33,36
- „Und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zin im ersten Monat und das Volk lagerte sich in Kadesch. Und Mirjam starb dort und wurde dort begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser, und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron“ (4Mose 20,1-2).
Nun sind sie zum zweitenmal schon in Kadesch (Barnea) Seit ihrem ersten Aufenthalt hier sind bereits 38 Jahre vergangen.
- „Von Kadesch zogen sie aus und lagerten sich an dem Berge Hor, an der Grenze des Landes Edom“ (4Mose 33,37; 4Mo 20,22; 5Mo 34,1).
22 Und die Israeliten brachen auf von Kadesch und kamen mit der ganzen Gemeinde an den Berg Hor.
23 Und der HERR redete mit Mose und Aaron am Berge Hor an der Grenze des Landes der Edomiter und sprach:
24 Aaron soll versammelt werden zu seinen Vätern; denn er soll nicht in das Land kommen, das ich den Israeliten gegeben habe, weil ihr meinem Munde ungehorsam gewesen seid bei dem Haderwasser.
25 Nimm aber Aaron und seinen Sohn Eleasar und führe sie auf den Berg Hor
26
- Da ging der Priester Aaron auf den Berg Hor nach dem Befehl des HERRN und starb dort im vierzigsten Jahr des Auszugs der Israeliten aus Ägyptenland am ersten Tag des fünften Monats als er hundertdreiundzwanzig Jahre alt war“ (4Mose 33,38-39),
4Mose 20,29 Und als die ganze Gemeinde sah, dass Aaron tot war, beweinten sie ihn dreißig Tage, das ganze Haus Israel.
40 Und der König der Kanaaniter zu Arad, der da wohnte im Süden des Landes Kanaan, hörte, dass die Israeliten kamen. (4Mo 21,1)
41 Und von dem Berge Hor zogen sie aus und lagerten sich in Zalmona.
42 Von Zalmona zogen sie aus und lagerten sich in Punon.
43 Von Punon zogen sie aus und lagerten sich in Obot. (4Mo 21,10)
44 Von Obot zogen sie aus und lagerten sich in Ije-Abarim, im Gebiet der Moabiter.
Richter 11,17-22
17 Da sandte Israel Boten zum König der Edomiter und sprach: Lass mich durch dein Land ziehen. Aber der König der Edomiter hörte nicht auf sie. Auch sandten sie zum König der Moabiter; der wollte auch nicht. So blieb Israel in Kadesch
18 und zog in der Wüste umher. Und sie umgingen das Land der Edomiter und Moabiter und kamen von Sonnenaufgang her an das Land der Moabiter und lagerten sich jenseits des Arnon, aber sie kamen nicht ins Gebiet der Moabiter; denn der Arnon ist die Grenze von Moab.
19 Und Israel sandte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter zu Heschbon, und ließ ihm sagen: Lass uns durch dein Land ziehen bis an unsern Ort.
20 Aber Sihon traute Israel nicht und ließ es nicht durch sein Gebiet ziehen, sondern versammelte sein ganzes Kriegsvolk und lagerte sich bei Jahaz und kämpfte mit Israel.
21 Der HERR aber, der Gott Israels, gab Sihon mit seinem ganzen Kriegsvolk in die Hände Israels und sie erschlugen sie. So nahm Israel das ganze Land der Amoriter ein, die in jenem Land wohnten.
22 Sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter ein vom Arnon bis an den Jabbok und von der Wüste bis an den Jordan.
45 Von Ije-Abarim zogen sie aus und lagerten sich in Dibon-Gad. (4Mo 32,34)
46 Von Dibon-Gad zogen sie aus und lagerten sich in Almon-Diblatajim.
47 Von Almon-Diblatajim zogen sie aus und lagerten sich in dem Gebirge Abarim östlich vom Nebo. (4Mo 21,20
Dies macht deutlich, dass die Israeliten in einem weiten Bogen das gebirge und Territorium von Edom umgingen und schließlich auf der Höhe des Gebirges NEbo ankamen.
48Von dem Gebirge Abarim zogen sie aus und lagerten sich im Jordantal der Moabiter gegenüber Jericho. (4Mo 22,1; 5Mo 32,49)
49 Sie lagerten sich aber am Jordan von Bet-Jeschimot bis Abel-Schittim im Jordantal der Moabiter. (4Mo 25,1)
[1] Der biblische Berg Hor (Gebel Harun 1336 m) auf dem Aaron starb, wird seit der Antike 3,5 km südwestlich der Nabatäischen Stadt Petra lokalisiert. Diese Lokalisierung ist jedoch zweifelhaft, da dieser Berg erstens sehr hoch ist für die damaligen Verhältnisse und zweitens, befand er sich im Kernland von Edom, wo die Israeliten bekanntlich keinen Zugang hatten.
d

Abbildung Blick hinab in das Jordantal der Moabiter, wo das Volk Israel nach 40- jähriger Wüstenwanderung lagerte, bevbor sie in das gelobte Lnd einzogen (Foto: April 1986).
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
dd
Veröffentlicht unter ISRAEL
Verschlagwortet mit 70 Palmen, Ägypten, Auszug, Oasen, Sandwüste, Sinai, Sinaitikus, Steinwüste
Schreib einen Kommentar