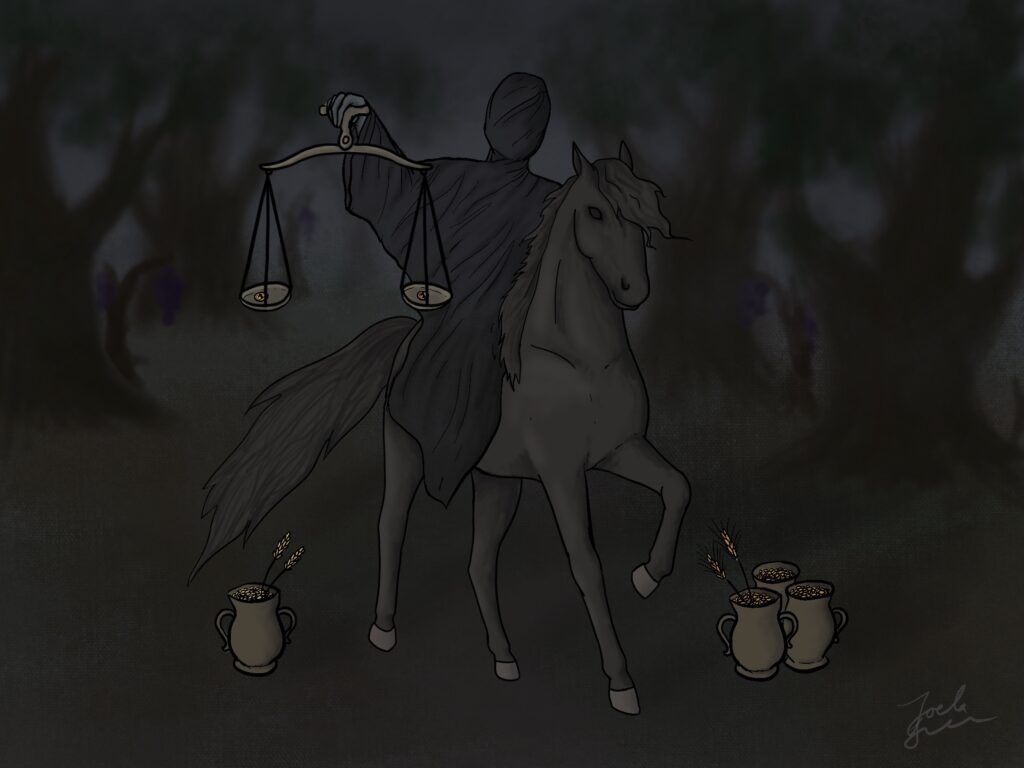Teil 2: Die Weltgeschichte im Überblick aus himmlischer Perspektive
Einleitung zum zweiten Teil
Der zweite Teil umfasst die Kapitel 4-7. Die darin beschriebenen Visionen beginnen im Himmel und enden wiederum im himmlischen Bereich, dann aber bereits in der Vollendung. Dazwischen werden dem Johannes aus himmlischer Perspektive Entwicklungen in dieser Welt gezeigt.
2.1 Der Blick in das himmlische Heiligtum
Nachdem Johannes den ersten großen Auftrag für die sieben Gemeinden erhalten hatte, wurde er erneut im Geist, diesmal in den himmlischen Bereich gerufen. So heißt es in Offb 4,1:
„Nach diesem sah ich: Und siehe, eine Tür, geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf! Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss.“ (Offb 4,1).
Die geöffnete Tür
Johannes sieht eine geöffnete Tür im Himmel. Das Bild von der Tür begleitet den Bibelleser von 1Mose bis zur Offenbarung. Etwa 67 Mal wird sie erwähnt und zwar sowohl im wörtlichen Sinne, als auch sinnbildlich, als geschlossen oder geöffnet. (einige Textstellen zur geöffneten Tür: Joh 10,1ff; Apg 14,27; 1Kor 16,9; Kol 4,3; Offb 3,8).
Die geöffnete Tür steht für freien Zugang, für Möglichkeiten. Für Johannes ist es das Betreten eines himmlischen Raumes, ein Einblick in das himmlische Heiligtum. Bereits vor ihm bekamen andere Diener Gottes Einblick in diesen himmlischen Bereich (Mose: 2Mose 33,18; Jesaja: Jes 6,1-10; Hesekiel: Hes 1,4-28; Stefanus: Apg 7,56; Paulus: 2Kor 12,1ff). Johannes bekommt vieles von dem zu sehen und zu hören, was bereits seine Abbildung im irdischen Heiligtum hatte und ihm aus den Propheten vertraut war. Doch er bekommt auch neue Perspektiven. Und erst von dort aus wird ihm der Ausblick gezeigt über das, was bis zur Vollendung geschehen muss.
Die erste Stimme
Die erste Stimme, ähnlich einer Posaune, erinnert an Kapitel 1,10. Dort ist es eindeutig die Stimme des Menschensohnes Jesus. So können wir annehmen, dass es auch hier dieselbe Stimme war. Es kann aber auch die Stimme des Engels gewesen sein, der beauftragt war die Offenbarung dem Johannes zu übermitteln (Offb 1,1; 19,10). Diese Stimme fordert Johannes auf heraufzusteigen, das heißt durch die geöffnete Tür in den himmlischen Bereich einzutreten. Anmerkung: Für die Gläubigen ist der Zugang zum Thron der Gnade bereits jetzt im Glauben immer frei (Eph 2,18; Hebr 4,16).
Die Aussage: „Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss“, baut auf das bereits gesagte und geschehene auf (Offb 1,20b). Es geht um Ereignisse, welche nach den Thronszenen (Offb 4-5) durch Bilder gezeigt werden und sich in Raum und Zeit vollziehen werden. Das nach diesem sollte jedoch nicht überbetont werden, so als ob es noch in der fernen Zukunft läge. Denn in den vom Lamm geöffneten Siegeln werden auch Ereignisse bildhaft dargestellt, die bereits vorher ihren Anfang nahmen und sich nun fortsetzen. Die bildhafte Darstellung in der Offenbarung umfasst die gesamte Zeitspanne zwischen der Menschwerdung Jesu, seinem Erlösungswerk, der Thronbesteigung und seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Es gibt sogar Aussagen, welche uns an Geschehnisse aus der Frühgeschichte der Menschheit erinnern (Offb 18,24; 1Mose 11,1ff).
2.1.1 Der Thron Gottes und seine Umgebung
Johannes berichtet von seinem Zustand und von dem was er sah und wahrnahm.
„Sogleich war ich im Geist: Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder, und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd.“ (Offb 4,2-3).
Johannes „war (ward) im Geist“, (vgl. Offb 4,2 mit 1,10.18). Dies könnte so verstanden werden, dass er nicht körperlich / physisch dort war, sondern im Heiligen Geist. Siehe auch die Parallelen dazu (Jes 6,1-8; Hes 1,1-28; Dan 7,9-14; Apg 7,56; 2Kor 12,1-5). Und nach Empfang der Offenbarung ist er wieder zurück, sozusagen im physisch-geistigen Zustand.
Johannes bekommt Einblick in den himmlischen und göttlichen Bereich, in die Schaltzentrale Gottes. Die bildhafte Beschreibung der Herrlichkeit des Thrones Gottes durch kostbare materielle Dinge stößt an ihre Grenzen. Die Beschreibung dessen, was Johannes sieht folgt einer bestimmten Abfolge.
Allein in der Offenbarung kommt der Thron (Gottes) 40 Mal vor: 1,4; 3,21; 4,2.3.4.5.9.10; 5,1.6.7.11.13; 6,16; 7,9.10.11.15.17; 8,3; 12,5; 14,3; 16,17; 19,4.5; 20,11.12; 21,3.5; 22,1.3; und in den übrigen Texten des NT mindestens weitere 9 Mal: Mt 5,34; 23,22; 25,31; Apg 2,30; 7,49; Hebr 1,8; 4,16; 8,1; 12,2. Es handelt sich um die Machtzentrale des gesamten Universums. Jes 40,22: „Er thront über dem Kreis der Erde, und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken; er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt“.
Johannes sieht keine Gestalt auf dem Thron, denn mindestens acht Mal wird in der Heiligen Schrift betont, dass Gott von niemandem jemals gesehen wurde (2Mose 33,20; Joh 1,18; 6,46; 14,9; Röm 1,20; 1Tim 6,15-16). Die schönsten und wertvollsten Edelsteine (Jaspis, Sarder) werden als Vergleiche benutzt, um die Herrlichkeit dessen zu beschreiben, der auf dem Thron ist. Ausdrücklich wird betont, dass er sitzt, nicht steht (vgl. mit Dan 7,9). Nun folgt eine Beschreibung von dem wer oder was den Thron umgibt und was von ihm ausgeht.
Erstens: Der Regenbogen rings um den Thron
ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd.
In 1Mose 9,13 sagte Gott zu Noah: „Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde.“ 1Mose 9,14: „Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken.“ 1Mose 9,16: „Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist.“ Der Prophet Hesekiel bekommt Einblick in den Thronbereich Gottes: „Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des HERRN anzusehen. Und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden.“ (Hes 1,28).
Der Regenbogen in den Wolken ist ein Abbild (eine Projektion) des himmlischen Regenbogens, der schon vorher den Thron Gottes umgab. Dieser wurde zum Zeichen seines Bundes nach der Sintflut mit Noah und seinen Nachkommen. Was für ein Gott, der an sich erinnern lässt (vgl. auch mit Sirach 43,12; 50,7). In der Offenbarung kommt das Bild des Regenbogens neben 4,3 auch noch in 10,1 vor. An beiden Stellen wird er mit dem gr. Begriff `iris` bezeichnet, kommt uns da etwas bekannt vor? Aus unserer Perspektive sehen wir den Regenbogen nur als Halbkreis, daher auch die Verwendung des Wortes `Bogen`.

Abbildung 1 Regenbogen (Foto von Joela Schüle).
Bei Gott umgibt er den Thron als geschlossener Kreis. Ähnlich kreisförmig kann der Regenbogen unter einem bestimmten Winkel vom Flugzeug aus, das sich über den Regenwolken befindet gesehen werden. Man kann daher sich vorstellen, dass Gott seine Schöpfung durch diesen ihn umgebenden `IRIS` des Bundes sieht.
Zweitens: Die vierundzwanzig Ältesten um den Thron
„Und rings um den Thron sah ich vierundzwanzig Throne, und auf den Thronen saßen vierundzwanzig Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze.“ (Offb 4,4).
Wer sind diese 24 Ältesten um den Thron Gottes und was ist ihre Bestimmung? Um zu einer begründeten Erklärung zu kommen, untersuchen wir zunächst alle Texte, in denen diese Ältesten als Gruppe oder als Einzelne beschrieben werden und in Aktion treten. Danach suchen wir nach Parallelen in den übrigen Schriften.
Die 24 Ältesten in der Offenbarung sieht Johannes zunächst sitzend auf 24 Thronen im Kreis um den Thron Gottes. Das hebt ihre besondere Stellung hervor. Sie sind zuerst und vor allem dem Thron Gottes zugewandt.
- Auf ihren Häuptern tragen sie goldene Siegeskränze. Ihre Beziehung zu Gott ist lauter / rein, sie sind geläutert, sie hielten Gott die Treue und sie haben ewiges Leben. Auch in Offb 14,14 ist ein Engel mit einem goldenen Siegeskranz geschmückt. Das Heer des Feindes dagegen trägt nur zum Schein goldene Siegeskränze (Offb 9,7).
- Sie sind bekleidet mit weißen Gewändern. Diese Bekleidung ziert nicht nur die Erlösten, sondern auch die Engel (Offb 3,4.5.18; 7,9.13; 15,6; 19,14; Lk 2,13; Mt 28,1-8; Mk16,2ff; Lk 24,4).
- Sie werfen sich und ihre Kränze nieder und beten den an der auf dem Thron sitzt. Diese Anbetungshaltung ist ein innerer und äußerer Ausdruck für Anerkennung der Hoheit, Würde und Macht Gottes. Ihm verdanken sie ihre Existenz und ihre hohe Stellung (Offb 4,10).
- Nun kommt es zu einer bewegenden Szene, bei der einer aus der Ältestenschaft dem weinenden Johannes Auskunft gibt (Offb 5,5). Einer der Ältesten vor dem Thron spricht zu Johannes dem Apostel, der auf diese Information angewiesen war (dazu auch Vers 6).
- In Offb 5,9-14 sind die Ältesten wieder in Aktion. Nachdem einer der Ältesten Johannes über das Bild des Löwen und des Lammes aufgeklärt hatte, steigen die anderen zusammen mit den vier lebendigen Wesen in einen Hymnus ein. Sie singen ein neues Lied. Dieses Lied hat zum Inhalt die Erlösung des Volkes Gottes durch das geschlachtete Lamm. Und die vierundzwanzig Ältesten schließen sich auch den Hymnus an vgl. dazu auch Phil 2,9-11). Die Schalen mit dem Räucherwerk in den Händen der Ältesten symbolisieren die Gebete der Heiligen. Hier scheint eine bestimmte Verbindung zur Gemeinde angedeutet zu sein (vgl. mit 8,3).
- In Offb 7,13 spricht ein Ältester von den Erlösten eindeutig in der 3. Person (auch bei Schlachter), d.h. er gehört nicht zu der Gruppe derer, welche erlöst wurden, doch er (und damit auch die anderen Ältesten) stehen in einer bestimmten Beziehung zu den Erlösten. Denn er klärt Johannes darüber auf, woher jene erlöste Schar gekommen ist (Offb 7,14).
- Eine weitere Szene mit Beteiligung der Ältesten wird in Offb 14,3.beschrieben. Auch hier scheint es eine deutliche Unterscheidung zu geben zwischen den 144000 als Erlösten von der Erde und den vier lebendigen Wesen samt den 24 Ältesten, die als himmlische Geistwesen der Erlösung nicht bedurften und trotzdem in einem engen Zusammenhang mit ihnen stehen.
Weitere Texte, in denen Älteste erwähnt werden: Offb 11,16; 19,4.
Wir schauen uns jetzt die Statusbezeichnung der Ältesten an. Der gr. Begriff dafür ist `presbyteroi`, sie sind in der biblischen Offenbarung:
- Vorstände der Stämme und Sippen (5Mose 29,9; 1Kön 8,1).
- Der Rat der Siebzig (4Mose 11,16-25).
- Stadtälteste (5Mose 21,6).
- Verantwortlich für das Gesetz, die Lehre (5Mose 31,9; 32,7).
- Gesamtleitung des Volkes Israels (Jos 8,33).
- Die Priesterschaft und der Rat der Ältesten (Mt 26,3).
Nach dem Weggang von Jesus oblag die Leitung des neutestamentlichen Volkes Gottes den Aposteln und Ältesten (Apg 1,2; 15,2ff; 15,22-23; 20,28; Phil 1,1; 1Petr 5,1-4).
Im Himmel gibt es eine reale geistliche Vorlage, ein Muster göttlicher Schöpfung für das, was Gott in dieser Welt entfaltet. Dabei ist Israel mit seinem Priestertum, Stiftshütte, Opferdienst und auch seinem Königtum als vorläufige Einrichtung zu sehen (Hebr 8,5 mit Bezug auf 2Mose 25,40). Damit müssen auch die Ältesten im Himmel ihre irdische Entsprechung haben.
Im 1. Chronikbuch 24,1-27 lesen wir von den 24 Abteilungen der Priester, die im Laufe des Jahres abwechselnd Dienst versahen am Hause des Herrn. Ebenso von den 24 Abteilungen der Sänger / Musiker aus den Leviten und 24 Abteilungen der Torhüter ebenfalls aus den Leviten. Die Initiative für die Einführung dieser 24 Abteilungen ging auf David zurück, der sie von der Anweisung Gottes für den Priesterdienst ableitete (2Chr 8,14; 1Chr 24,19). Diese 24 Abteilungen der Priester wurden nach dem Exil und beim Wiederaufbau des Tempels wieder eingesetzt (Esra 6,18). Sie waren noch im Dienst zur Zeit der Geburt von Johannes und Jesus (Lk 1,5).
Als himmlische Geistwesen repräsentieren die 24 Älteste durch ihre Zahl, ihren Status und Dienst vor Gott das gesamte Volk Gottes aller Zeiten, welches als ein Königreich von Priestern bezeichnet wird (1Petr 2,9 mit Bezug auf 2Mose 19,6). Dabei ist auch der Bezug zu den zwölf Stämmen und den zwölf Aposteln des Lammes erkennbar (Mt 19,28 und Lk 22,30 mit Offb 7,4-8 und 21,12-14).
Drittens: Blitze, Stimmen, Donner
„ Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner;“ (Offb 4,5).
Es erinnert an die Offenbarung Gottes am Sinai (2Mose 20,18. An die gewaltige Stimme Gottes aus der Höhe (Jer 25,30). „Und der HERR donnerte im Himmel, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen“ (Ps 18,14). „Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen.“ (Joh 12,29). Es sind Ausdrucksformen des Redens Gottes (Offb 8,5.13; 10,3.4; 11,15.19; 14,3; 16,18; 19,6). Dabei kommt etwas Konkretes in Bewegung, denn wenn er spricht, so geschieht`s (Ps 33,9).
Während Donner mit Stimmen die akustische Mitteilungsform Gottes darstellt, sind Blitze die sichtbare und wahrnehmbare Art der Mitteilung Gottes an die Menschen (Offb 8,5; 11,19; 16,18; 2Sam 22,15; Ps 144,6).
Viertens: Die sieben Feuerfackeln vor dem Thron
„und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind.“ (Offb 4,5).
Dieses Bild weist auf den Heiligen Geist Gottes hin und ist uns bereits aus Kapitel 1,4; 3,1; auch 5,6 bekannt. Es ist auch ein Hinweis auf die Allgegenwart des Heiligen Geistes, der alles durchleuchtet und durchdringt (Joh 16,8-11).
Die detaillierte Erklärung dazu kann im ersten Teil nachgelesen werden.
Fünftens: Das kristallene Meer um den Thron
„Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall.“ (Offb 4,6).
Das Bild vom gläsernen Meer kommt noch zweimal in Kapitel 15,2 vor. Dort wird es beschrieben als „mit Feuer vermengt“. Die Umschreibung mit `gläsern` weist auf seine Durchsichtigkeit und Reinheit hin, wie die zwei Stellen aus Offenbarung 21,18 und 21,21 erkennen lassen. Auch dafür gibt es eine Entsprechung im Bereich der Stiftshütte und zwar in dem kupfernen Waschbecken zwischen dem Brandopferaltar und dem Eingang in das Heilige. Es kann als ein Abbild des gläsernen Meeres gesehen werden (2Mose 38,8; 30,18-20). Für die Priester war Vorgeschrieben: „Wenn sie in die Stiftshütte gehen, sollen sie sich mit Wasser waschen, dann werden sie nicht sterben, so soll es auch sein, wenn sie an den Altar treten, um zu dienen und ein Feueropfer zu verbrennen für den HERRN.“ (2Mose 30,19-20).
Das dem Kristall ähnliche Meer erstreckt sich rund um den Thron. Das ist ein Hinweis dafür, wer dem Thron nahen will, muss durch dieses Meer hindurch, so wie der Priester, wenn er sich Gott im Heiligtum nahen wollte. Der Hebräerbriefschreiber greift diesen Gedanken auf: „gewaschen am Leib mit reinem Wasser“ (Hebr 10,22; ähnlich auch Eph 5,26: „gereinigt im Wasserbad des Wortes“; Tit 3,5 „durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung durch den Heiligen Geist“). Zu der grundsätzlichen Reinigung gehört aber auch die Reinigung von Sünden nach 1Joh 1,5-9 und 2,1-2; Mt 5,24; 6,12 um vor Gott mit reinem Gewissen treten zu können.
Sechstens: Die vier lebendigen Wesen rings um den Thron (zweiter Hymnus)
und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier, und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen, und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten, eines wie das andere, je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen, und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt!“ (Offb 4,6b-8).
Das Wesen und die Bestimmung dieser vier lebendigen Wesen zu verstehen ist ebenfalls eine Herausforderung. Wir beginnen auch hier mit den Hinweisen aus der Offenbarung und dann suchen wir nach Parallelen aus den übrigen Schriften.
Die gr. Bezeichnung für diese vier lebendigen Wesen ist `Zöa – Lebewesen` im Plural. Der Begriff wird für alle Lebewesen verwendet, in denen Odem / Hauch oder Geist des Lebens ist (1Mose 6,17; 7,15.22).
Doch diese vier lebendigen Wesen heben sich deutlich ab von allen irdischen Lebewesen. Sie werden in der Offenbarung als Gruppe oder als Einzelne insgesamt 21 Mal genannt (4,6.7.8.9; 5,6.8.14; 6,1.3.5.6.7; 7,11; 14,3; 15,7; 19,4). Was sie tun, zeugt von ihrem Wesen und Stand.
Der vorrangige Dienst der vier Lebewesen besteht in der ununterbrochenen Anbetung Gottes und des Lammes. So heißt es von ihnen: „und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt!“ (Offb 4,8; ähnlich auch in 4,9; 5,8.14; 7,11; 19,4). Unwillkürlich werden wir dabei an das drei Mal `heilig` aus Jesaja 6,3 erinnert. Der Herr, Gott ist der Allmächtige (Pantokrator – Allgewaltiger) der immer Seiende und der Kommende (1Mose 21,33; Röm 16,26; 1Tim 6,15-16; Offb 1,4).
Sie haben Augen vorne und hinten und je sechs Flügel. Diese Ausstattung ermöglicht ihnen den Blick sowohl zum Thron hin als auch in den Außenbereich. Die Flügel deuten auf ihre Bewegungsfreiheit und Schnelligkeit für ihren Dienst. Sie sind aufmerksame Wächter der Heiligkeit Gottes. Ungewöhnlich scheint, dass diese vier Lebewesen nicht nur um den Thron stehen, sondern sich auch in der Mitte des Thrones befinden. Sie haben demnach unmittelbaren Zugang zu Gott und sind mit besonderen Vollmachten ausgestattet. In Kapitel 6,1-8 und auch noch später treten sie in Aktion. Zur weiteren Identifizierung dieser Wesen suchen wir nach Parallelen in den Texten des AT. Beginnen wir ganz am Anfang der Geschichte.
- Nach der Vertreibung des Menschen aus dem Garten Eden, stellte Gott die Cherubim (im Plural) als Wächter vor den Eingang (1Mose 3,24). Ihr Auftrag war, dem Menschen in seinem Zustand den Zugang zum Baum des Lebens zu verhindern ().
- Auch der Bau der Stiftshütte wurde nach einem bestimmten Muster gefertigt (2Mose 26,30; 27,8; Hebr 8,5). Dabei geht es uns um die Details, welche sich im Innersten des Heiligtums befanden. Es war die Bundeslade mit dem Sühnedeckel darauf und die beiden Cherubime darüber (2Mose 25,18-22; 26,1.31; 37,7-9; 4Mose 7,89). Es ist ein Abbild für den Thron der Gnade Gottes, die durch Sühnung der Sünden wirksam wird (Eph 2,18; Hebr 4,16; 9,7). Die zwei Cherubime der Herrlichkeit mit den ausgebreiteten Flügeln, einander zugewandt, jedoch auf den Sühnedeckel blickend, sind ein Abbild von den himmlischen lebendigen Wesen (Hebr 9,5). Es ist die Gruppe der Engel, die ständig um den Thron Gottes sind, auch wenn ihre Anzahl in den verschiedenen Texten variiert. Bemerkenswert ist auch, dass sowohl die Teppiche über der Stiftshütte, als auch die Vorhänge am Eingang zahlreiche Muster von Cherubimen aufwiesen. Ähnliche Parallelen finden wir auch im Tempel Salomos (1Kön 6,23-32; 7,29-32; 8,6-7; 2Kön 19,15; Ps 99,1).
Weitere Parallelen zu den vier Lebewesen aus der Offenbarung finden wir auch in der Vision, die Gott dem Propheten Jesaja gegeben hatte (Jes 6,1-8). Auch hier ist der Herr (HERR) auf dem Thron umgeben von mindestens zwei `Serafimen` mit jeweils sechs Flügeln. Ihr Rufen: „Heilig, heilig, heilig ist der HERR Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll!“ lässt die Parallele zu Offb 4,8 deutlich erkennen (dazu auch Jes 37,16: Cherubim).
Ähnlichkeiten, aber auch Ergänzungen sehen wir in den Visionen des Propheten Hesekiel (Hes 1,1-28; 10,1-20; Hes 41,18). Dies alles lässt eine Kontinuität erkennen in Bezug auf den Auftrag dieser Gruppe himmlischer Geistwesen, welche den Zugang zum Thron Gottes bewachen.
Doch ihr Auftrag ist vielseitig, wie wir ab Kapitel 6 feststellen werden.
Die vergleichende Darstellung der himmlischen Lebewesen im Aussehen wie Löwe, Jungstier, Angesicht wie eines Menschen, fliegender Adler, weist auf die Schöpfung hin.
- Gleich einem Löwen, dieser kommt etwa 128 Mal in der Bibel vor. Wegen seiner besonderen Stellung unter den Tieren des Feldes und seiner Eigenschaften ist er Sinnbild für den Stamm Juda (1Mose 49,9-10; Offb 5,5). Für das Volk Israel (4Mose 23,24). Er ist bekannt für seine Unerschrockenheit (Jes 31,4). Sinnbild für den Herrn: „Der HERR wird brüllen aus der Höhe und seinen Donner hören lassen aus seiner heiligen Wohnung. Er wird brüllen über seine Fluren hin; wie einer, der die Kelter tritt, wird er seinen Ruf erschallen lassen über alle Bewohner der Erde hin“ (Jer 25,30). Er ist nicht zu überhören: „Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott der HERR redet, wer sollte nicht Prophet werden?“ (Am 3,8). Weitere Stellen: Hos 5,14; Mi 5,7). Der Kerngedanke hier ist die absolute Herrschaft, höchste Autorität (Amos 1,2; 2Mose 15,18).
- Gleich einem Jungstier. Der Stier kommt etwa 105 Mal vor. in den meisten Texten als Opfertier (2Mose 29,3-11; 3Mose 4,4- 22,27). „Auch sollst du täglich einen Stier zur Sühnung als Sündopfer darbringen und den Altar entsündigen, indem du Sühnung an ihm vollziehst, und du sollst ihn salben, um ihn zu heiligen.“ (2Mose 29,36). Der Kerngedanke ist hier Erlösung durch Sühnung (2Kor 5,19).
- Angesicht gleich einem Menschen. Der Mensch, Krone der Schöpfung Gottes wird etwa 931 Mal genannt. So lesen wir in 1Mose 1,26: „Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich!“ Weitere Stellen für die besondere Stellung des Menschen, besonders in der Person des Menschensohnes (Ps 8,5-10; Hebr 2,6-7; Offb 1,11).
- Gleich einem fliegenden Adler. Der Adler kommt in der Bibel etwa 29 Mal vor. Selbst Gott der Herr und die, welche auf Gott vertrauen, werden wegen seiner besonderen Eigenschaften mit dem Adler verglichen. 5Mose 32,11: „Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln.“ Ps 103,5 – vom Frommen; Jes 40,31: „aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.“ Weitere Textstellen zu Adler: Offb. 12,14; Offb 8,13; Hes 1,10 und 10,14. Die Kerngedanken sind: Erhabenheit, Weitblick, Schnelligkeit, Kraft, Fürsorge.
Damit stehen die vier lebendigen Geistwesen repräsentativ für die Schöpfung Gottes. In ihnen werden die zentralen schöpferischen und heilsgeschichtlichen Gedanken Gottes deutlich erkennbar.
„Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! Halleluja!“ (Ps 150,6).
2.1.2 Die Anbetung Gottes des Schöpfers (dritter Hymnus)
„Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die vierundzwanzig Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden.“ (Offb 4,9-11).
Die Anbetung Gottes ist die höchste Form des Gottesdienstes. Die grammatische Form zu Beginn des Hymnus lässt den Schluss zu, dass es sich zunächst um eine Ankündigung der noch folgenden Anbetung handelt. Dabei werden die vier lebendigen Wesen, welche sich in der unmittelbaren Nähe des Thrones befinden, den Anfang machen. Danach steigen die vierundzwanzig Älteste in die Anbetung mit ein. Die Reihenfolge wird sein: Herrlichkeit, Ehre, Danksagung, bzw. Herrlichkeit, Ehre und Macht. Es wird dem zugerufen, der alle Dinge geschaffen hat und durch dessen Willen alles besteht.
2.1.3 Das Lamm ist würdig die sieben Siegel zu lösen (vierter Hymnus)
„Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt.“ (Offb 5,1).
Es handelt sich um eine Schriftrolle (Buchrolle), die Buchform (Kodex) fand erst später ihre Verbreitung (Offb 6,14; Lk 4,17.20). Dass sie innen und außen beschrieben war, spricht für ihre Vollständigkeit. Diesem Inhalt wird nichts mehr hinzugefügt werden (Offb 22,18; Jes 34,4). Ungewöhnlich ist auch die siebenfache Versiegelung der Schriftrolle, was sowohl auf den verborgenen Inhalt hinweist, als auch die Unauflösbarkeit derselben durch unbefugte betont.
Grundsätzlich ist das Bild von einer Schriftrolle bereits aus den Propheten bekannt. Es geht darum, dass Gott seinen Willen durch Worte und zwar in schriftlicher Form den Menschen zukommen lässt (Jer 36,1-32). In Kapitel 10 werden wir noch auf die Schriftrolle eingehen.
„Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter (starker) Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen)? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde konnte das Buch öffnen noch es anblicken (reinschauen).“ (Offb 5,2-3).
Die Tatsache, dass niemand imstande war die Buchrolle zu öffnen und hineinzuschauen betont die Begrenztheit und die Ohnmacht der Geschöpfe (Engel, Menschen, Dämonen) den Plan Gottes von sich aus zu begreifen (Röm 11,33; Eph 3,9; 1Petr 1,12).
Der Löwe aus Juda, die Wurzel Davids
„Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen.“ (Offb 5,4-5).
Nun tritt einer der Ältesten in Aktion und tröstet Johannes mit den Worten: „es hat gesiegt der Löwe aus dem Stamm Juda“. Im himmlischen Bereich weiß man bereits seit der Auferstehung und Thronbesteigung des Menschensohnes, wer der Sieger ist. Mit dem für Johannes bekannten Bild – Löwe aus dem Stamm Juda – erkennt er seinen Herrn und König (1Mose 43,9; 49,9-10; Ps 78,68; Amos 1,2; 3,8; Micha 5,1; Mt 1,2; 2,6; Hebr 7,14).
Der Ausdruck „die Wurzel Davids“ kommt besonders häufig in den Propheten vor und deutet auf die menschliche Herkunft des Messias aus dem Hause Davids, bzw. Jesse, dem Vater von David hin (Offb 22,16; Jes 11,1.10; Röm 15,12; 2Sam 7,11-14a; Ps 2,1-12; Hosea 3,5; Jer 23,5; 30,9; Hes 37,24). Hier verstehen wir, warum im biblischen Kontext die sogenannten Stammbäume eine so wichtige Rolle gespielt haben (Mt 1,1-17; Lk 3,23-38; 1Chr 1-12). Sie bildeten den juristischen Nachweis für den erwarteten Messias aus dem Königshause Davids. Doch wie und wodurch siegte der Löwe aus Juda, der Nachkomme Davids?
„Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte; dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde.“ (Offb 5,6).
Nach der akustischen Information wird der Blick des Johannes wieder auf die Mitte des Thrones gelenkt. Er sieht ein Bild von einem Lamm, man stelle sich ein männliches einjähriges Schaf vor (2Mose 12,1-6). Es sieht aus wie geschlachtet, aber es steht (Tod und Auferstehung). Deutlicher kann es nicht ausgedrückt werden. Zu offensichtlich ist der Hinweis auf Jesus, das Lamm Gottes (Jes 53,4-12; Joh 1,29; Mk 10,45; 1Kor 5,7; Hebr 2,14; 1Petr 1,19; Offb 1,18). Löwe und Lamm vereint in einer Person. Auf zwei Besonderheiten bei seinem Aussehen fällt der Blick des Johannes. Das Lamm hat sieben Hörner, ein Ausdruck seiner Vollmacht und Kraft (1Sam 2,10). Es hat sieben Augen, Hinweis auf Allwissenheit, denn er sieht alles. Die sieben Augen (dazu auch die sieben Hörner) werden auch auf den Geist Gottes gedeutet, der von Jesus ausgeht und überall gegenwärtig wirksam ist (4Mose 23,22; 24,8; Ps 18,3; Ps 132,17; Offb 1,4.14; 3,1; 4,5). Nach der Thronbesteigung wird der Geist Gottes im Auftrag von Jesus in diese Welt gesandt (Mt 3,11-12; Joh 16,7; Lk 24,49; Apg 1,5; 2,33).
2.1.4 Die Anbetung des Lammes auf dem Thron (vierter Hymnus)
„Und es kam und nahm (das Buch) aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk; das sind die Gebete der Heiligen.“ (Offb 5,7-8).
Als Jesus noch auf Erden war, sagte er: „Alles, was der Vater hat, das ist mein“ (Joh 16,15). „Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen,“ (Joh 5,20). Dies hat sich erfüllt mit der Thronbesteigung.
Zum Zeichen der Anerkennung der Würde und Hoheit des Lammes fallen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten anbetend nieder vor dem Lamm. An dieser Stelle ist es wichtig die Bedeutung des Begriffes Anbetung zu erfassen. Der gr. Begriff `epesan – fielen nieder`, kommt auch bei Knechten gegenüber ihren Herren vor. Doch der Begriff `prosekyn¢san – anbeteten` ist im biblischen Kontext (von Ausnahmen abgesehen) der Anbetung Gottes vorbehalten.
Anmerkung: In der klassischen Literatur beschreibt dieser Begriff die Haltung eines Hundes mit vorgestreckten Vorderbeinen zu seinem Herrn hin.
Den umfassendsten Text zur Anbetung finden wir in Johannes 4,20-24. Im Gespräch mit der Samariterin wird der Anbetungsbegriff 10 Mal gebraucht. Dort ist die anzubetende Person Gott der Vater. In Matthäus 28,17 fallen die Jünger vor Jesus anbetend nieder. (Mt 2,11: die Weisen; Phil 2,9-11: Alle; Hebr 1,6: die Engel; Offb 5,8. 13-14; 7,10-11; 11,16; 19,4; nur Gott ist anbetungswürdig: Offb 19,10; 22,8-9). Es gibt jedoch auch Ausnahmen, wo dieser Begriff in einem anderen Bezug gebraucht wird (Offb 3,9). Und dort, wo Götzenbilder oder Menschen angebetet werden (Offb 9,20-21; 13,4.15; 16,2).
Für den bevorstehenden Lobgesang haben sie Harfen (kitara) und goldene Schalen voll Räucherwerk, ein bekanntes Bild für Gebet und Anbetung (Lk 1,9-21; 18,10; Apg 3,1; Offb 8,3-5).
„Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut (Menschen) für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen!“ (Offb 5,9-10).
In der Aussage: „du hast erkauft“ ist das gesamte Werk der Erlösung enthalten. Die Opfer während der aaronitischen Priesterordnung als hinweisende Einrichtung und dann das vollgültige Opfer Jesu am Kreuz. Und zu einem Königreich und zu Priestern gemacht (vergleiche die Kommentare zu Kapitel 1,5-6).
Anmerkung: Anstelle „Menschen“ übersetzen andere mit „uns“. Der Grund dafür liegt darin, dass es im Griechischen verschiedene Lesarten gibt. Dieser Text wird unterschiedlich übersetzt, je nach der griechischen Vorlage. Zum Beispiel die Schlachter Übersetzung stützt sich auf den Textus Receptus, die anderen auf Nestle Aland, welchem ältere Handschriften zugrunde liegen. In Letzteren spricht der Älteste in der 3. Person, d.h. er gehört nicht zu der Schar der Erkauften.
Ausdrücklich wird gesagt: aus jedem Stamm, jeder Sprache (Zunge) jedem Volk und jeder Nation werden Menschen in der Vollendung vor Gott und dem Lamm stehen (Offb 7,9; 14,1-5).
Es ist ein neues Lied, das zunächst die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten anstimmen. Sie singen einen Lobpreis auf das Lamm und dessen Sühneopfer. Damit bringen sie auch ihr Staunen zum Ausdruck (1Petr 1,12). Erst später stimmen die unübersehbare Menge der himmlischen Engel in den Lobpreis mit ein, dann zusammen mit allen übrigen Geschöpfen.
Der Auftrag: „Sie werden herrschen auf Erden oder über die Erde“ (1Mose 1,26) kann sich durchaus auf die neue Erde in der neuen Schöpfung beziehen. Doch die eigentlichen Besitzer dieser Erde sind Kinder Gottes, weil nur sie diese Schöpfung nach dem Willen Gottes und in rechter Beziehung zu ihm verwalten, nutzen, bewahren, jedoch nicht missbrauchen(Ps 8,1ff; Mt 5,7).
„Und ich sah: Und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten; und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, 12 die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. 13 Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit (Ewigkeiten im Plural) 14 Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen! Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.“ (Offb 5,11-14).
Welch ein Lobpreis auf das Lamm, bei dem sieben Strophen gesungen werden (vgl. dazu auch Phil 2,9-11). Näheres zu diesem Lobpreis in 2.3.3.
2.2 Die Weltgeschichte im Überblick
Nach dem Einblick in den himmlischen Bereich (Kapitel 4-5) bekommt Johannes gezeigt, was auf Erden geschehen wird. Die sieben Siegel bilden den Gesamtrahmen der Offenbarung. Der Textteil in Offb 6,1-8 enthält die Öffnung der ersten vier Siegel. Unter ihnen erscheinen die vier Reiter. Unter dem fünften Siegel (Offb 6,9-11) bekommt Johannes einen Einblick in das himmlische Heiligtum zu den Seelen der Zeugen Jesu. Da unter dem sechsten Siegel (Offb 6,12-17) bereits der Beginn des Weltgerichts und die Auflösung der materiellen Schöpfung gezeigt und beschrieben wird, kann der gesamte Abschnitt in Kapitel 6 als die Weltgeschichte im Überblick überschrieben werden.
Der Aufbau der ersten sechs Siegel ist 4+2 und umfasst die Kapitel 4-7. Unter dem siebten Siegel werden die Kapitel 8-22 mit all ihren Visionen dargestellt, welche die verschiedenen Perspektiven der Entwicklungen und Abläufe sowohl im Himmlischen als auch im irdischen Bereich zeigen. Damit stellen die ersten sechs Siegel einen Grundriss der Weltgeschichte im Buch der Offenbarung dar
Der Aufbau der sieben Posaunengerichte ist 4+3 und umfasst die Kapitel 8-11.
Die sieben Zornesgerichte umfassen nur Kapitel 16 und diese werden ausdrücklich als die letzten Plagen bezeichnet. Ihr Aufbau ist wie auch bei den Posaunen 4+3, dabei geht die vierte nahtlos in die fünfte Zornesschale über. Dem Inhalt nach ähneln diese beiden in manchen Details.
Besonders in den ersten vier Siegeln sind markante, parallel verlaufende, zum Teil ineinander verwobene Grundlinien von Ereignissen in der Entfaltung der Geschichte zu erkennen. Doch viele der in den sechs Siegeln genannten Aspekte werden unter dem siebten Siegel aufgegriffen und ergänzt.
Einige Details wurden bereits von Jesus in seinen Endzeitreden vorausgesagt. Vom Kontext der Offenbarung beginnen die geschilderten Ereignisse seit der Machtübergabe an den Sohn Gottes Jesus Christus (Mt 28,17-20) und seiner Thronbesteigung (Lk 24,51; Apg 1,9-11; Offb 1,1: „seinen Knechten zu zeigen, was schnell geschehen muss“). Da jedoch viel von dem Bildmaterial aus der vorchristlichen Zeit stammt, gibt es offensichtliche Parallelen zu Ereignissen aus der Frühgeschichte, die entsprechenden Vorbildcharakter haben.
Einleitung zu den ersten vier Pferden mit ihren Reitern
Das Bild des ersten Reiters bietet Raum für verschiedene Interpretationen. Bei den anderen drei Reitern überwiegen die Übereinstimmungen im Verständnis (der teilweise Entzug der Sicherheit, der Versorgung und Gesundheit ).
Bei den vier Rossen mit ihren Reitern besteht eine Ähnlichkeit zu den Bildern aus Sacharia 1,8-11 und 6,1-7. Dort geht es um Gespanne mit Angabe von Farben, Herkunft und Bestimmung.
- Die Reihenfolge in Offb 6,1-8: Weißes, feuriges, schwarzes, grünes (grün / gelb).
- Die Reihenfolge in Sacharia 6,1-7 ist: Feurige, schwarze, weiße, scheckige.
- In Sacharia 1,8: Feurige, hellrote, braune, weiße (bei dem zweiten und dritten Gespann sind die Farben wegen unterschiedlicher Übersetzungen nicht eindeutig und die Reihenfolge wechselt, dazu fehlt das Gespann mit den schwarzen Rossen. Diese Gespanne sind dem Herrn der ganzen Erde unterstellt und führen seine Befehle aus (Sach 1,10-11; 6,5). Sie werden mit den vier Winden des Himmels verglichen (vgl. dazu Jer 49,36).
Trotz der Ähnlichkeiten mit den Pferden in Offb 6,1-8 gibt es auch Unterschiede:
- In Sacharia sind es vier Gespanne, in Offb vier einzelne Rosse und zwar mit Reitern und deren Ausstattung.
- In Sacharia ist das vierte Gespann scheckig oder gefleckt, in Offb ist das vierte Pferd grün (grün / gelb).
- In Sacharia ziehen die Gespanne in die verschiedenen Himmelsrichtungen aus, In Offb wirken die vier Pferde mit Reitern global umfassend.
- In Sacharia stehen die vier Gespanne für die vier Winde des Himmels, handeln also eindeutig im Auftrag Gottes. In Offb 6,1-8 fehlt zwar dieser Hinweis, doch die Beteiligung der vier lebendigen Wesen kann als eine Entsprechung zu den vier Winden des Himmels angesehen werden. Und im Gegensatz zu der Ausgangsbasis des Drachen, der zwei Tiere und Babylon, handelt es sich hier um eine Initiative, die im himmlischen Bereich ihren Anfang nimmt. Denn die Anweisungen an die Reiter auf den vier Pferden kommen von den vier lebendigen Wesen, welche in unmittelbaren Gegenwart des Thrones Gottes stehen und in seinem Auftrag handeln (Offb 4,6ff; 6,1.3.5.7). Daher sollten die geschilderten Abläufe aus der Perspektive Gottes betrachtet und bewertet werden.
Die Visionen im Buch Sacharia wurden dem Propheten in nachexilischer Zeit gegeben (Sach 1,1; 7,1). Sie sprechen von dem Wiederaufbau des Tempels (520-516) und der Verheißung der Wiederherstellung Jerusalems und dem Ausblick auf das Kommen des messianischen Reiches (Sach 1,12ff; 9,9). In neutestamentlicher Zeit kommt die Errichtung des Reiches Gottes hinzu, bei dem der Bau des geistlichen Tempels (der Gemeinde) im Mittelpunkt steht (Sach 6,12; Mt 16,18). Und dieses geistliche Reich wird durch das Evangelium von Jesus Christus verkündigt (Mt 4,23; 9,35). Dieser zentrale Aspekt darf keinesfalls bei der Betrachtung der Offenbarungstexte zu kurz kommen. Ansonsten gibt es im Alten Testament zwar weitere Texte von Pferden und Gespannen aber ein offensichtlicher Bezug zu Offb 6,1-8 lässt sich durch jene nicht ohne weiteres ableiten. In den Evangelien und den Briefen der Apostel kommen Pferde (außer in Jak 3,3 mit Bezug auf Ps 32,9) nicht vor. Im Buch der Offenbarung kommen Pferde in zwei Texten vor. In Kapitel 9,7ff bilden sie ein Feindesheer (Heuschreckenheer gleich Pferden und in Kapitel 19,11-15 werden Christus und die ihm nachfolgenden himmlischen Heere auf weißen Pferden dargestellt.
2.2.1 Das Lamm öffnet das erste Siegel: Der Reiter auf dem weißen Pferd – was wird durch ihn dargestellt?
„Und ich sah, als das Lamm eins von den sieben Siegeln öffnete, und hörte eins von den vier lebendigen Wesen wie mit einer Donnerstimme sagen: Komm! Und ich sah: Und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen; und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend und um zu siegen.“ (Offb 6,1-2).
Johannes schaut zu, wie das Lamm eins (Zahlwort) von den sieben Siegeln öffnete. Dieses Siegel ist auch das erste von den sieben. Danach dringt an sein Ohr die donnerähnliche Stimme des ersten lebendigen Wesens mit dem Ruf: „komm“. Und nun fällt der Blick des Johannes auf ein weißes Pferd, dessen Reiter einen Bogen hatte, dazu wurde ihm ein Siegeskranz gegeben.
Eine erste Auffälligkeit, die zum Nachdenken anregt: im Vergleich zu den Posaunen und Zornesschalen, wird Das erste Siegel, welches das Lamm öffnete, mit dem Zahlwort `EINS` bezeichnet und die anderen sechs Siegel sind mit den Ordnungszahlen versehen. Ähnliches Muster zeichnet sich auch in der sieben Tage Woche ab, in welcher der erste Tag mit dem Zahlwort `eins` beziffert wird (1Mose 1,5; Mt 28,1; Mk 16,2; Lk 24,1; Joh 20,1.19; Apg 20,7; 1Kor 16,2). Somit wird im Tag EINS sowohl ein zeitlicher Rahmen festgelegt, als auch der Bezug zu Christus hergestellt, denn durch ihn ist die Welt geschaffen und durch dessen Auferstehung begann auch die neue Schöpfung (1Mose 1,1ff; Joh 1,1-3; Kol 1,15-18; 2Tim 1,10).
Weil in allen himmlischen Wesen der eine Geist Gottes wirkt, weiß jeder was er zu tun oder zu sagen hat. Die Stimme, welche Johannes hört ist nicht zu überhören. Der Ruf kommt von einem das heißt vom `ersten` der vier lebendigen Wesen ähnlich einem Löwen. Diese Stimme hört sich an wie die Stimme / Ton des Donners: „Komm“. Doch wem gilt der Ruf? Da Johannes bereits da ist, kann der Ruf nicht ihm gelten, sondern dem Reiter, durch den die von Gott vorgesehenen Ereignisse bildhaft dargestellt werden. Neben Offb 6,1.3.5.7 kommt das gr. Verb `erchou` noch in Mt 8,9; Lk 7,8; Offb 22,17+20 vor. Auch dort ist das „komm“ in der Ruf-Form verwendet, es schwingt aber auch der Akzent der Aufforderung und des Befehls mit. Daraufhin sieht Johannes das Bild von einem weißen Pferd `ippos leukos` mit seinem Reiter, wie im Text beschrieben.
Doch das „Siehe“ gilt besonders auch den Lesern, dass sie aufmerken sollen, was nun gezeigt wird. Bei diesem Bild konnten damals die Leser und Hörer durchaus zunächst an einen Heerführer denken, der nach seiner siegreichen Rückkehr gekrönt wurde. Diese Reihenfolge war auch fester Bestandteil bei den Sportkämpfen. Doch der Reiter auf dem weißen Pferd in Offb 6,1-2 kehrte nicht von einer Schlacht zurück, sondern er zieht aus und hatte bereits den Siegeskranz auf seinem Haupt. Es ist ein Detail, auf das zu achten ist.
In den biblischen Geschichten kommen Pferde / Rosse oder Gespanne nahezu 180 Mal vor. Sie werden als Kuriere eingesetzt, aber in den meisten Fällen als Kampfrosse oder Gespanne. (Ester 8,10; 2Mose 14,7-28; 2Kön 6,15). Ihre Schnelligkeit eignete sich hervorragend zur Überbrückung großer Distanzen (Jer 4,13).
Wir betrachten Texte in denen Bilder von weißen Pferden (Rossen) von Bogen und von Siegeskränzen vorkommen. Erst danach wagen wir eine Deutung dieses Bildes. Natürlich halten auch wir uns an das Auslegungsprinzip – die Schrift wird mit der Schrift ausgelegt. Und die unklaren Stellen werden im Licht der eindeutig klaren Texte gedeutet. Wir schauen uns zuerst Texte im Buch der Offenbarung an, Danach in den übrigen Schriften.
Das Bild des weißen Pferdes mit seinem Reiter und der ihm nachfolgenden Heere aus Offb 19,11-15 ist für uns die naheliegendste Quelle, in der ähnliche Aspekte zu Offb 6,1-2 enthalten sind.

Abbildung 1 Der Reiter auf dem weißen Pferd. Bewusst ist auf der Zeichnung das Gesicht des Reiters unkenntlich. Doch die gesamte Haltung strahlt Siegesgewissheit aus. (Zeichnung von Joela Schüle 28. März 2021).
Die weiße Farbe des Pferdes
In Kapitel 19,11-15 ist das weiße Pferd (Kampfross) dem gerechten Richter der Welt zugeordnet. Diesem folgen himmlische Heere, die ebenfalls auf weißen Rossen sitzen und mit reiner, weißer (leuchtender) Seide oder Leinen bekleidet sind. Dort lesen wir: „Und ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß: Treu und Wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen (Diademe); und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war, und sein Name ist: Das Wort Gottes. Und ihm folgten die Heere im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Seide. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage.“ Schauen wir uns die Bilder aus den Kapiteln 19,11-15 und 6,1-2 an und stellen die Übereinstimmungen, die Ähnlichkeiten aber auch Unterschiede fest:
- Auffallend ist in beiden Texten, dass dem Johannes zuerst Das Aussehen des Pferdes ins Auge fällt und erst danach der darauf Sitzende beschrieben wird. Und dies gilt auch für die Bilder in Offb 6,1-8.
- Die offensichtliche optische Übereinstimmung ist die weiße Farbe des Pferdes, bzw. der Pferde.
- Das `weiß` des Pferdes aus Kap. 19 steht in Übereinstimmung mit dem, der auf dem Pferd als gerechter Richter der Welt sitzt und mit der Wahrheit des Wortes Gottes kämpft (Joh 5,27; 12,48; Apg 17,31; Offb 20,11 mit Mt 25,31). Das weiß, die weiße Farbe wird in der Schrift bezogen auf Jesus immer mit positiven Aspekten in Verbindung gebracht: Weiße Kleider (Mt 17,2; Mk 9,3); weißes Haar (Offb 1,14); weißer Thron (Offb 20,11 mit Mt 25,31). Wir sehen, dass die Farbe des Pferdes in Offb 19 sowohl auf die Bestimmung als auch den Charakter des darauf Sitzenden hinweist. Das trifft auch auf die himmlischen Heere auf weißen Pferden zu. Wir können annehmen, dass zwischen der Farbe des Pferdes aus Offb 6,1-2 und seinem Reiter ebenfalls eine Beziehung oder gar Übereinstimmung von Charakter und Funktion besteht. Dies werden wir auch später bei den anderen drei Rossen mit ihren Reitern feststellen.
- Aus dem Munde des Weltrichters geht ein zweischneidiges Schwert hervor, es ist das lebendige aber auch richtende Wort Gottes (1Kor 1,18; 1Petr 1,23; Hebr 4,12; Joh 12,48). In Offb 6,2 hat der Reiter einen Bogen (als Waffe) doch wie dieser eingesetzt wird, ist auf den ersten Blick noch nicht erkennbar. Da es im NT dafür keine bildhafte Entsprechung gibt, sind wir auf das AT angewiesen. Später mehr dazu unter dem Stichwort `der Bogen`.
- Der Richter der Welt trägt auf seinem Haupt viele Kronen (Diademe), priesterliche und königliche Insignien (2Mose 29,6; 39,30; 2Sam 1,10; Jes 62,3; Sach 9,16). Dem Reiter auf dem weißen Pferd in Kap 6,2 wird bereits bei seinem Auszug ein Siegeskranz (Stefanos) gegeben. Doch beides sind herrliche und ehrenvolle Insignien sowohl der Macht als auch des Sieges.
- Der Richter der Welt kämpft, bzw. richtet mit Gerechtigkeit und siegt, der Reiter auf dem weißen Pferd zieht aus siegreich (kämpfend) und um zu siegen. Eine Niederlage ist bei beiden ausgeschlossen, was von den Herrschern und Heerführern dieser Welt nicht ohne weiteres gesagt werden kann.
Die Parallelen in diesen beiden Bildern und Texten sind zwar bemerkenswert, doch für eine eindeutige Deutung dieses Bildes reichen sie nicht aus. Da wundert es nicht, dass es gerade bei diesem Bild die kontrastvollsten Auslegungen gibt.
Wie bereits weiter oben angemerkt, kommen weiße Pferde nur noch in den Visionen des Propheten Sacharia vor. Inwieweit können diese Bilder unseren Text erhellen? Dort lesen wir: „Und ich hob meine Augen abermals auf und sah, und siehe, da waren vier Wagen, die kamen zwischen den zwei Bergen hervor; die Berge aber waren aus Kupfer. Am ersten Wagen waren rote (feurige) Rosse, am zweiten Wagen waren schwarze Rosse, am dritten Wagen waren weiße Rosse, am vierten Wagen waren scheckige Rosse, allesamt stark. Und ich hob an und sprach zum Engel, der mit mir redete: Mein Herr, wer sind diese? Der Engel antwortete und sprach zu mir: Es sind die vier Winde des Himmels, die hervorkommen, nachdem sie gestanden haben vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die schwarzen Rosse zogen in das Land des Nordens, die weißen zogen hinter ihnen her, und die scheckigen zogen in das Land des Südens. Diese starken Rosse also zogen aus und wollten sich aufmachen, um die Lande zu durchziehen. Und er sprach: Geht hin und durchzieht die Lande! Und sie durchzogen die Lande. Und er rief mich an und redete mit mir und sprach: Sieh, die in das Land des Nordens ziehen, lassen meinen Geist ruhen (Fußnote: „stillen meinen Zorn“) im Lande des Nordens.“ (Sach 6,1-8). Nach Sacharia 2,4 verstand man unter dem Land des Nordens auch die Länder im Zweistromland (ähnlich auch in Jes 14,31; Jer 16,15; 23,8; 25,9.26; 50,9; Dan 11,6). Denn wer von Israel aus nach Nordosten oder Osten ziehen wollte musste die Nordroute über Damaskus nehmen.
Auf den ersten Blick fällt die Vierer Gruppe der farbigen Gespanne auf, welche vom Text her von Gott in die vier Himmelsrichtungen ausgesandt werden. Auch in Offb 6,1-8 ist es eine farbige Vierergruppe, allerdings mit jeweils einem Pferd und dazu einem Reiter. Trotz optischer Ähnlichkeiten sollten die Gespanne zunächst im Kontext der heilsgeschichtlichen Periode jener Zeit gedeutet werden. Darin kann man folgendes erkennen: Diese vier Gespanne symbolisieren die vier Winde des Himmels (vgl. Sach 6,5 mit Hebr 1,7 mit Bezug auf Ps 104,4: Engel oder Gruppen von Geistwesen). Einige der himmlischen Boten sind zuständig, um Gottes Gerichte an den Völkern aber auch an Israel auszuführen (1Mose 19,22: Gericht über Sodom; Ps 78,49: an Ägypten; 1Chr 21,12 und 2Sam 24,17: an Israel wegen der Sünde von David; 2Kön 19,35: Gericht am Heer der Assyrer).
Die Gespanne aus Sacharia haben zunächst den Auftrag die Lande zu durchziehen, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Dann aber auch auf Befehl des Herrn in die Machtbereiche der Herrscher dieser Welt einzugreifen (Sach 1,8-11; 6,8). In diesen Texten wird jedoch nur das Ergebnis des Auftrages für die schwarzen und weißen Gespanne durch eine kurze Bemerkung kommentiert. Diese Eingriffe geschahen auch in der Zeit vor, während und nach dem babylonischen Exil (Visionen des Daniel (Kap. 9-12)und Sacharia etwa 520-516 v.Chr.). Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Wiederherstellung von Juda und Jerusalem samt dem Tempel, wie folgender Text deutlich macht: „Da hob der Engel des HERRN an und sprach: HERR Zebaoth, wie lange noch willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig gewesen bist diese siebzig Jahre? Und der HERR antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche Worte und tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Predige und sprich: So spricht der HERR Zebaoth: Ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer.“ (Sach 1,12-14).
Wenn wir die Symbole aus Sacharia für das Verständnis über Offb 6,1-8 heranziehen, dann dürfen wir das zentrale Thema `Gottes Reich und die Gemeinde` nicht aus dem Blickfeld verlieren. Gott ist auf Gerechtigkeit bedacht und er begann mit seinem Gericht damals an seinem Volk und seinem Haus um sie zur Umkehr zu bewegen. Dadurch sollte der Rest gerettet werden (Sach 3,8; 6,12; 8,11-12; 12,8-9; Jes 10,21; Hes 28,25-26). Danach wendet er sich mit seinen Gerichten den Völkern zu. Weil sie ihre Macht missbraucht haben, wird er sie zur Rechenschaft ziehen (Jer 51,11: Meder gegen Babel; Sach 2,10-13). Diese Vorgehensweise Gottes ist prinzipiell und könnte auch auf Offb 6,1-8 angewendet werden. Auf dem
Hintergrund der Bestimmung des Gespanns mit den weißen Rossen (Sach 6,6) die eindeutig im Dienst des Herrn stehen und in seinem Auftrag handeln, würde auch dem Reiter auf dem weißen Pferd (Offb 6,1-2) eine von Gott aufgetragene Funktion zukommen. Das könnte bedeuten, dass Gott sein Gericht (in Gerechtigkeit und Wahrheit) unter die Nationen bringt und zwar in neutestamentlicher Zeit durch das Evangelium von dem Reich Gottes, beginnend in Israel. Eine der zentralen und eindrucksvollsten Aussagen über den Inhalt des Evangeliums ist zweifellos in Johannes 3,15-19 festgehalten worden. Doch im gleichen Zusammenhang erklärt Jesus worin das Gericht besteht. So sagte er: „Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren Böse.“ (Joh 3,19). Und zum Ende seines Dienstes gibt er bekannt: „Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt; jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. 32 Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. 33 Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde.“ (Joh 12,31-33).
Weitere Stellen, die im Zusammenhang des Auftrages für den Messias als Retter und Richter stehen: Jes 42,1ff mit Mt 12,18-20; Jes 49,6 mit Apg 13,47; Amos 9,11 mit Apg 15,16-17; Mt 28,19-20 und Apg 1,8 mitMt 24,14.
Bis jetzt konnten wir feststellen, dass es (außer von Offb 6,1-2) nur zwei weitere bildhafte Darstellungen gibt, in denen weiße Rosse vorkommen und beide zeigen zentrale Aspekte des Handelns Gottes mit seinem Volk und den Nationen.
Der Bogen des Reiters
Der Reiter auf dem weißen Pferd hatte einen Bogen. Pfeil und Köcher werden in diesem kurzen Text nicht erwähnt. Natürlich sollte ihr Fehlen nicht unbeachtet gelassen werden, denn Bogen als Waffe ohne Pfeil wäre wirkungslos, es sei denn, dass es auf ein Ende des Kampfes hinweist, wie auch einige Ausleger vermerken mit dem Hinweis, dass der Pfeil (durch den einzigartigen Sieg Jesu) bereits abgeschossen wurde. Doch der Hinweis, dass der Reiter auszieht um zu siegen, setzt Kampf voraus. Dazu gibt es viele Textstellen in denen der Bogen als Waffe genannt ist ohne dass der Pfeil erwähnt wurde (Ps 21,13; Jes 13,18; Sach 10,3-6; Neh 4,7). Und oft ist von Pfeilen die Rede, ohne dass der Bogen erwähnt wird (Ps 45,6; Jes 49,2). Im NT kommt der Bogen als Waffe nur in Offb 6,2 vor, die Pfeile einmal und zwar als „feurigen Pfeile des Bösen“ (Eph 6,16). Dies wird gelegentlich als eine Begründung dafür angesehen, dass der Reiter auf dem weißen Pferd im Auftrag des Feindes kämpft. Und natürlich kann auch diese Sichtweise mit bestimmten Textaussagen begründet werden, wie zum Beispiel 2Kor 11,14-15.
Zum Nachdenken: Der erste Reiter hatte einen Bogen, aber der Siegeskranz wurde ihm gegeben. Vom zweiten Reiter heißt es zweimal, dass ihm gegeben wurde. Dem dritten Reiter wurde nichts gegeben, er hatte aber eine Waage. Bei dem vierten Reiter heißt es zusammenfassend: „ihnen wurde gegeben“.
Von den mehr als 70 Stellen im AT in denen der Bogen erwähnt wird (Pfeil mehr als 60 Mal), beschreiben viele von ihnen physische Kampfhandlungen und in anderen werden diese Gegenstände im übertragenen Sinne verwendet.
Zunächst jedoch zum Begriff selbst. Im Griechischen wird für Bogen das Wort `toxon` verwendet, auch für den Regenbogen (1Mose 9,13-17). In der Offenbarung wird der Regenbogen jedoch mit dem Begriff `iris` beschrieben (vgl. Hes 1,28; mit Offb 4,3; 10,1). Zu erklären ist der Unterschied damit, dass von unserer Perspektive aus der Regenbogen immer nur als Halbkreis zu sehen ist. Aus der himmlischen Perspektive gesehen ist er ein Vollkreis, so die Beobachtung aus dem Flugzeug unter einem bestimmten Winkel. Im Gegensatz zu Offb 4,3 und 10,1 handelt es sich in Offb 6,2 um den Bogen als Waffe. Die Frage ist nur, auf welche Weise und in welchem Sinne wurde und wird dieser Bogen eingesetzt?
Ursprünglich wurde mit Pfeil und Bogen Wild gejagt (1Mose 21,20: Ismael; 27,3; Esau). Doch wie bereits erwähnt, wurde (neben dem Schwert) Bogen und Pfeil für Eroberungen bei Kampfhandlungen eingesetzt (1Mose48,22; 2Sam 1,22; Jer 51,11). Es gibt jedoch auch mehrere Texte, in denen diese Waffe im Dienst Gottes steht, allerdings sinnbildlich (5Mose 32,23.42).
- Ps 21,13: „Denn du wirst machen, dass sie den Rücken kehren; mit deinem Bogen wirst du auf ihr Antlitz zielen.“
- Ps 38,3: „Denn deine Pfeile stecken in mir, denn deine Hand drückt mich.“ Und David erkennt, dass es geschieht wegen seiner Sünde und weil er dadurch zur Umkehr geführt wird.
- Und in Psalm 45 lesen wir vom Messias: „Du bist der Schönste unter den Menschenkindern, / holdselig sind deine Lippen; darum hat dich Gott gesegnet ewiglich. 4 Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, / und schmücke dich herrlich! 5 Es soll dir gelingen in deiner Herrlichkeit. Zieh einher für die Wahrheit / in Sanftmut und Gerechtigkeit, so wird deine rechte Hand Wunder vollbringen. 6 Scharf sind deine Pfeile, dass Völker vor dir fallen; sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Gott, dein Thron bleibt immer und ewig; das Zepter deines Reichs ist ein gerechtes Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hassest Frevel; darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl wie keinen deiner Gefährten.“ (vgl. mit Hebr 1,8 wo diese Prophetie auf den Sohn Gottes bezogen wird). Hier werden die Waffen Schwert und Pfeil dem Messias zugeordnet, die er natürlich in seinem Sinne einsetzen wird.
- In Jesaja 49,2 spricht der Messias von Gott in der 3. Person: „Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen (auserlesenem) Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt.“ Hier kann die bildhafte Anwendung des Schwertes und Pfeils im Köcher durch den Messias gesehen werden. Waffen, die er in seinem Sinne einsetzen wird, um seinen Auftrag (die Sammlung Israels und Licht und Rettung für die Nationen ) zu erfüllen (Jes 49,6; Lk 2,32-34; Joh 10,16).
- Und durch den Propheten Sacharia sagt der Herr: „Denn ich habe mir Juda zum Bogen gespannt und Ephraim darauf gelegt und will deine Söhne, Zion, aufbieten gegen deine Söhne, Griechenland, und will dich zum Schwert eines Helden machen.“ (Sach 9,13). Gott verwendet sein Volk (unter dem Bild von Bogen, Pfeil und Schwert) für den Kampf gegen die Feinde.
- Im Propheten Habakuk wird von Gott gesagt: „Du ziehst deinen Bogen hervor, legst die Pfeile auf deine Sehne. Du spaltest das Land, dass Ströme fließen.“ (Hab 3,9). Auch hier sind Bogen und Pfeile als eine spezifische Waffenart in Gottes Hand zweckbestimmt verwendet.
Diese Texte machen deutlich, dass Gott die Waffe Bogen und Pfeil (wie auch das Schwert) in seinem Sinne einsetzt. Und nur in der Hand des Herrn (und seiner auserwählten Zeugen) werden die genannten Waffen im richtigen Sinne und zweckmäßig eingesetzt. Da Jesus in seinem Dienst nie physische Waffen verwendete und auch in der Zukunft niemals verwenden wird, sind diese geistlich zu deuten, wie es mit dem Schwert des Geistes als dem Worte Gottes geschieht und zwar in neutestamentlicher Zeit (dazu auch Mt 10,34 mit Lk 12,51f).
Anmerkung: In Ps 64,4-5gibt es eine Erklärung darüber, was ein Pfeil im übertragenem aber negativen Sinne bedeutet: „die ihre Zunge schärfen wie ein Schwert, mit ihren giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen, 5 dass sie heimlich schießen auf den Frommen; plötzlich schießen sie auf ihn ohne alle Scheu.“ Und in Sprüche 25,18 lesen wir:
„Wer wider seinen Nächsten falsch Zeugnis redet, der ist wie ein Streithammer, Schwert und scharfer Pfeil.“ Wie treffend wird hier unter anderem auch das Schwert und der Pfeil im Sinne der Verletzung durch falsche Aussage, also Verleumdung beschrieben.
Beispiele für positive Verwendung der Worte der Wahrheit finden wir in Mt 22,46; 23,13ff; Lk 20,39; Joh 18,4-6: „als Jesus sagte: ich bin`s, fielen sie zu Boden“; Apg 2,37a: „es ging ihnen durchs Herz“ (stach sie ins Herz); 3,14; 5,4-10; 5,33; 7,52-54; 8,20ff; 9,3-4; 13,10; 22,7; 24,25).
Darum kann in Offb 6,2 der Bogen auch als geistliche Waffe gesehen werden, der für geistliche Eroberungen eingesetzt wird, ähnlich wie das Bild vom scharfen zweischneidigen Schwert (Offb 1,16; Jes 49,2 und Ps 45,4-6). Es bedeutet, dass dieser Bogen niemals zerbrechen wird und seine Pfeile treffsicher sind, sie verfehlen nie das Ziel, denn sie sind Wahrheit und entlarven jede Art von Lüge und Ungerechtigkeit.
Anmerkung: Auffallend ist der Vergleich der Pfeile mit Blitzen (plötzlich, unerwartet, schnell), so in 2Sam 22,15: „Er schoss seine Pfeile und zerstreute die Feinde, er sandte Blitze und erschreckte sie.“ (ähnlich auch Ps 38,3; 77,18; 144,6; Sach 9,14; 5Mose 32,23). Dies lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Aussagen in der Offenbarung, in denen Blitze von Gottes Thron ausgehen und Gerichte ankündigen oder einleiten (Offb 4,5; 8,5; 11,19; 16,18). Gott wendet diese Waffen als Werkzeuge auf seine Weise an.
Aufgrund dieser Textaussagen ließe sich bei dem Bild des Reiters mit dem Bogen der Einsatz im Auftrag Gottes begründen. Es bedeutet Rettung für die, welche mit Umkehr darauf reagieren und Gericht für die, welche sich seinem Wirken widersetzen (Joh 3,16-19).
Anmerkung: Auf der anderen Seite sagt Gott Entwaffnung voraus: „Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum andern und vom Strom bis an die Enden der Erde.“ (Sach 9,10; auch Ps 46,10; Hes 39,3; Hos 1,5). Ob diese Prophetien sich in buchstäblichem Sinne erfüllen werden, ist unwahrscheinlich. Eher bezieht sich diese Art von Abrüstung auf den Bereich des Reiches Gottes, in dem bereits seit Christus Frieden und Gerechtigkeit regieren (Jes 9,5-6; 11,1ff; Lk 2,14; Joh 14,27; Röm 14,17).
Der Kranz (Siegeskranz) auf dem Haupt des Reiters
Dem Reiter wurde ein Kranz (auf sein Haupt) gegeben. In der Offenbarung wird unterschieden zwischen Diadem – eine Art Stirnband mit goldenem Blattwerk oder Edelsteinen verziert und dem Stefanos – Siegeskranz aus Lorbeerblätter oder auch aus Gold angefertigt. In diesem Text wird der Begriff `stefanos – Siegeskranz` verwendet.
Anmerkung: Mit Siegeskränzen wurden weltliche Herrscher bekränzt. Ebenfalls auch siegreiche Heerführer, wenn diese von einem Kampf siegreich zurückkehrten. Dem Reiter aus Offb 6,1-2 wurde ein Siegeskranzgegeben bereits bei seinem Auszug in den Kampf. Und für solch einen Siegeszug geben biblische Texte wichtige Hinweise.
Zunächst betrachten wir Texte zum Siegeskranz in der Offenbarung:
- Als `goldene Kränze`, die 24 Ältesten tragen sie (Offb 4,4.10).
- Ebenso der himmlische Bote, gleich einem Menschensohn (Offb 14,14).
- Den Gläubigen der Gemeinde in Smyrna verheißt Jesus den Siegeskranz des Lebens (Offb 2,10).
- Und die Gläubigen in Philadelphia ermutigt Jesus festzuhalten was sie haben, damit niemand ihren Siegeskranz wegnimmt (Offb 3,11).
- Einmal werden goldene Siegeskränze ausdrücklich auf ein feindliches Heer bezogen, allerdings mit dem vergleichendem Zusatz `wie`. Zitat: „und auf ihren Köpfen (war es) wie Siegeskränze dem Gold gleich (ähnlich)“ (Offb 9,7). Diese Siegeskränze sind eine Fälschung, sie täuschen durch ihre äußere Erscheinung und daher werden sie durch den Wortlaut des Textes entlarvt.
Kränze (Siegeskränze) sind seit dem Altertum bekannt: Hiob 31,36; Spr 1,9; 4,9; Jes 28,5. In den Texten des NT wird der Kranz meistens mit einem Zusatz versehen:
- `Kranz aus Dornen` also `Dornenkranz` (Mk 15,17; Mt 27,29; Joh 19,2-5). Dieser wurde Jesus zur Verspottung und Entwürdigung aufgesetzt. Doch er wurde zum größten Sieger aller Zeiten, denn er gab den Kampf nicht auf bis in den Tod und siegte dadurch. Von ihm heißt es: „Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt; mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt; Wir sehen aber den, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, Jesus, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte.“ (Hebr 2,7 und 9 mit Bezug auf Ps 8,6). Dem „gekrönt“ (wörtlich: bekränzt) liegt im Griechischen und zwar in allen drei Texten der Siegeskranz der Ehre und Herrlichkeit zu Grunde. Durch seinen Sieg legte er den Grund für den wahren und unvergänglichen Siegeskranz für alle, die ihm vertrauen.
- Paulus entnahm das Bild vom Kranz aus dem Sportkampf der Athleten im Stadion. An die Korinther schreibt er: „Wisst ihr nicht: Die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge; jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen.“ (1Kor 9,24-25; dazu auch 2Tim 2,5).
- Als `Kranz der Gerechtigkeit` (2Tim 4,8). Dieser ist bereitet allen, die wie Paulus den guten Kampf bis zum Ende kämpfen.
- Als `Kranz des Lebens` (Jak 1,12). Der Kranz des Lebens ist das geistliche Leben aus Gott durch den Glauben an Jesus Christus (Joh 5,24-25).
- Als `unvergänglicher Kranz der Herrlichkeit` (1Petr 5,4; verheißen den treuen Hirten).
- Als `Ruhmeskranz` (1Thes 2,19; Phil 4,1).
- Einmalig als `Kranz aus 12 Sternen` (Offb 12,1). Die Frau mit der Sonne bekleidet (Bild für die Gemeinde) trägt diesen Ehrenkranz.
Kränze (Siegeskränze) werden in der Schrift mindesten zwanzig Mal erwähnt und nur einmal ausdrücklich als Fälschung bezogen auf ein feindliches Heer (Offb 9,7). Doch bei dem Siegeskranz aus Offb 6,2 können wir davon ausgehen, dass er dem Reiter von Gott verliehen wurde, um seinen Auftrag zu erfüllen oder gerade weil er seinen Auftrag siegreich erfüllen wird.
Wofür steht der siegende Reiter?
Von diesem Reiter wird gesagt, dass er auszog „siegend und um zu siegen“. Da ihm auch noch bei seinem Auszug der Siegeskranz gegeben wurde, ist eine Niederlage ausgeschlossen. Doch womit oder mit wem lässt sich dieser Sieger identifizieren? Unter den Auslegern sind die Positionen zum Teil gegensätzlich. Die Sichtweisen reichen von Christus (Joh 16,33) bis zum Antichristen, mit all den Pseudopropheten (Mt 24,4-5). Oder weltliche Herrscher durch ihre Eroberungen und triumphalen Krönungen (Offb 11,7; 13,1-7).
Seit dem Sündenfall scheint das Böse sich immer wieder durchzusetzen. Der Stärkere besiegt den Schwächeren (1Mose 4; 6; 10-11; 14; 19). Die Lügenpropheten hatten und haben ebenfalls in allen Kulturen und Epochen Hochkonjunktur. Die Gesetzlosigkeit nimmt hier und da immer mehr zu. Ja, der Drache und das Tier erringen unter dem Einfluss von Babylon und der Unterstützung des falschen Propheten anscheinend immer mehr Siege. So lesen wir in Offb 13,7-8: „Und es wurde ihm (dem Tier) gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden (besiegen); und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, (jeder) dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt.“ (ähnlich auch Offb 11,7). Aber ist das schon eine Begründung für den Sieg des Tieres und aller finsterer Mächte an allen Fronten? Kosten doch ihre Siege unzählige Menschenleben. Wurden nicht alle Sieger letztlich auch zu Besiegten? Dem scheinbaren Sieg der Mächte der Finsternis steht der Sieg des Christus gegenüber, beginnend in der Verheißung (1Mose 3,15) über seinen Sieg durch Tod und Auferstehung, so wie abschließend im Endgericht (Offb 17,14; 19,11-21; 20,10-15).
In dem Bild des Reiters auf dem weißen Pferd (Offb 6,1-2) sehen wir den siegreichen Beginn, die Entfaltung und Vollendung des Reiches Gottes in dieser Welt durch die Kraft des Evangeliums von Jesus Christus (Röm 1,16-17).
Anders als in Offb 19,11-15, wo Jesus als Weltrichter für alle sichtbar einher zieht, muss in dem Bild des Reiters aus Offb 6,2 Christus nicht zwingend als Person gesehen werden. Das ist auch verständlich, regiert er doch von seinem Thron aus, doch hier auf Erden hat er sein Volk, das geleitet und ausgestattet ist mit seinem Wort und dem Heiligen Geist (Joh 14-16; Apg 1,5.8; 2,1-4; 2Kor 10,4-5). Jesus legte die Grundlage für diesen siegeszug. Er sagte seinen Jüngern: „Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid getrost, ich habe die Welt besiegt.“ (Joh 16,33). Und in Offb 5,5 sagt einer der Ältesten zu Johannes: „Weine nicht! Siehe, es hat überwunden (gesiegt) der Löwe aus dem Stamm Juda“.
Das Bild des Reiters auf dem weißen Pferd beinhaltet auch den Siegeszug des Evangeliums (Mt 28,18-20; Lk 24,47; Apg 1,8; 2,37-41; 6,1-6; 13,28; Röm 1,17; 15,19; Mt 24,14). Für die Glaubenden dient es zur Rettung, für die, welche es ablehnen, zum Gericht. „Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.“ (Joh 3,18).
Der Reiter auf dem weißen Pferd kann auch für alle stehen, die durch den Glauben an Jesus Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes siegend voranschreiten im Kampf gegen Sünde und die finsteren Mächte des Satans. „Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt.“ (Eph 6,12). Johannes schreibt: „Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet (besiegt) die Welt; und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube.“ (1Joh 5,4). Oder: „Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist?“ (1Joh 5,5). Und in 1Kor 15,57 schreibt Paulus: „Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus!“ Und in Röm 8,37 steht: „Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat.“ (dazu auch 2Kor 2,14).
Seit Beginn des Kampfes zwischen Gott und dem Feind, dem Satan, dem Drachen, der alten Schlange (1Mose 3,15) steht der Sieg durch den Retter, König und Richter Jesus Christus fest. Und mit ihm siegen die Gläubigen aller Zeiten. Zu diesen zählen auch alle Überwinder und Blutzeugen seit Abel (Lk 11,51). Es ist die Schar der Überwinder, deren Namen im Buch des Lebens stehen und die das Tier nicht angebetet haben. „Und sie haben ihn (den Drachen) überwunden (besiegt) wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod!“ (Offb 12,11). Ja, die Verfolgungen und das Märtyrertum der Gläubigen ist in diesem Kampf und geistlichen Siegeszug eingeschlossen (Mt 5,11; 10,23; 23,34; Lk 21,12; Apg 8,1; 11,19; Offb 2,10; 3,10; 6,9-11; 11,7; 13,10; 20,4-5). Ja, der Kampf ist zwar noch nicht zu Ende, doch der Siegende (die Siegenden) stehen bei Gott bereits fest: „und das Lamm wird sie überwinden (besiegen); denn es ist der Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue.“ (Offb 17,14; ebenso 19,11-15). Somit ist die gesamte Heilsgeschichte von zwei ähnlichen Bildern (Offb 6,1-2 und 19,11-15) die einen Siegeszug darstellen, eingerahmt.
2.2.2 Das Lamm öffnet das zweite Siegel: Der Reiter auf dem feuerroten Pferd – was wird durch dieses Bild dargestellt?
„Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich das zweite Lebewesen sagen: Komm! Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben.“ (Offb 6,3-4).
Nach der Öffnung des zweiten Siegels durch das Lamm, tritt das zweite lebendige Wesen (ähnlich einem Stier) in Aktion und ruft: „Komm“. Und sogleich sieht Johannes ein zweites Pferd. Während das erste (weiße) Pferd durch eine eindeutige Farbbezeichnung beschrieben wird, wird das zweite Pferd als feurig charakterisiert. Die farbliche Komponente `rot, gr. `kokkino` kommt hier im Text nicht vor. Im griechischen steht hier `pyrros – feurig`, abgeleitet von `pyr – Feuer`. Beispiele für `feurig`: Offb 9,17: feurige Panzer; 12,3: feuriger Drache; 19,20 und 20,14: feuriger See; 4Mose 14,14: feurige Säule; 21,6 und 5Mose 8,15: feurige Schlangen; 2Kön 2,11: feuriger Wagen; 2Kön 6,17: feurige Rosse; Sach 1,8: feuriges Pferd; 2,9: feurige Mauer. Dass das Feuer verschiedene Rottöne zeigt, ist ein anderes Thema.

Abbildung 2 Der Reiter auf dem feurigen Pferd, mit einem großen Schwert in der Hand (Zeichnung von Joela Schüle am 25. April 2021).
Feuer kommt in der Bibel mehr als 400 Mal vor und zwar in verschiedenen Zusammenhängen und Bestimmungen.
- Feuer steht für Gott, seine Herrlichkeit und auch für seinen Zorn (2Mose 24,17; 5Mose 4,24mit Hebr 12,27; Jes 30,27; 33,14ff; Joel 2,3).
- Gottes Wort wird mit Feuer verglichen (Jer 5,13-14; 23,29).
- Feuer steht auch für Gericht (1Mose 19; mit Lk 17,29; Lk 3,17; Offb 20,9-10).
- Feuer steht aber auch gelegentlich für Läuterung (Jes 48,10).
Das feurige Pferd kann für etwas Bedrohliches stehen, Verzehrendes und Vernichtendes. Mit Feuer wurden Häuser, Städte und Getreidefelder verbrannt (1Mose 19,24; 2Mose 9,23; Ri 15,5; 18,27; Jes 1,7; Mt 22,7).
Das Aussehen des Pferdes lässt auf den Reiter und dessen Funktion schließen, denn wie auch bei den anderen Pferden mit ihren Reitern bilden diese sowohl eine charakterliche als auch funktionelle Einheit. Diesem Reiter wurde „Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten. und ihm wurde ein großes Schwert gegeben.“ Zweimal wird betont, dass ihm gegeben wurde.
Durch das große Schwert wird verdeutlicht, womit sie einander umbringen und dass auf diese Weise der Friede genommen wird. Aber von wem wurde diesem Reiter Macht verliehen? Die Frage nach der Macht erinnert uns an die grundsätzliche Aussage von Jesus an Pilatus: „Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre.“ (Joh 19,11). Gott verleiht oder gewährt Macht (Jes 46,11), doch er ist nicht der Urheber und Förderer der Ungerechtigkeit (vergleiche dazu auch: Hiob 1,8ff; 2,3ff; Dan 2,21; 7,25; Lk 22,53; Röm 13,1ff; Jak 1,13). Der Frieden wurde von der Erde genommen, die Ursachen dafür liegen in der verdorbenen Natur des Menschen (Jak 4,1; 1Joh 4,12). Neid, Habgier führt zum Streit und weil keiner nachgibt, kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Und dies geschah unter anderem durch den Einsatz der Waffe `Schwert` (gr. machaira). Betont wird, dass dem Reiter ein Großes Schwert gegeben wurde. Es gab verschiedene Arten, Formen und Größen dieser Waffenart.
Anmerkung: Anfang September 2023 wurde ein Fund bekannt gegeben. In einer Höhle bei En-Gedi entdeckten Forscher in einem Holzbeschlag vier noch gut erhaltene Schwerter aus der Zeit des Bar Kochba Aufstandes (135 n.Chr.). Drei davon waren in der Größe von 60-65 cm und eines war 45 cm lang.
Hier einige Stellen in denen diese Waffe im buchstäblichen Sinne gemeint ist und auch eingesetzt wurde: Offb 13,10.14; Hebr 11,34.37; Röm 13,4; 8,35; Apg 12,1-2; 16,27; Lk 22,36-38. 49-52; Mt 26,47.51-55.
Wenn das Schwert zum Einsatz kommt, ist es mit dem Frieden vorbei. Das Römische Reich rühmte sich mit ihrem `pax romana` (Apg 24,2). Doch der Blutzoll dafür war sehr hoch. Und die Geschichte spottet jener Bezeichnung.
Die gr. Formulierung `allelous sfaxousin` heißt eigentlich `einander schlachteten, abschlachteten. Das gr. Verb `sfaxousin ` wird häufig im liturgischen Bereich (schlachten der Opfertiere) verwendet (2Mose 12,6 u.a.m.) und auch bezogen auf das Lamm Gottes (Offb 5,6.12; 13,8; Jes 53,7; Apg 8,32). Der Begriff wird auch für das Abschlachten der Zeugen von Jesus verwendet (Offb 6,9). Der Tötungsbegriff `schlachten` wird auch bei Kriegshandlungen mit dem Einsatz von Schwert verwendet (Hes 21,15.20.33). In 2Sam 11,25 und Jer 12,12 wird vom Schwert gesagt, dass es frisst (gr. fagetai). Es handelt sich um die gleiche Wortwurzel wie auch in den oben genannten Stellen von Offb 6,4. Dazu heißt es, dass sie einander schlachteten, man kann sogar sagen, einander (mit dem Schwert) auffraßen (vgl. dazu Sach 8,10). Das dieses Verb sogar im Wort `sarkofagos – Fleischfresser` seinen Niederschlag fand, zeigt seine breite Verwendung.
Anmerkung: Doch wie steht es mit der Aussage von Jesus: „Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen Frieden zu bringen, sondern das Schwert.“ (Mt 10,34f; und Lukas ergänzt in 12,51f: Zwietracht, Enzweihung). Wir verstehen, dass es sich hier um eine ganz andere Ebene der Bedeutung von Schwert handelt trotz des ähnlichen Wortlauts. Diese Aussage hebt den geistlichen Kampf hervor, samt der Teilung in zwei Lager, welche mit der Verkündigung des Evangeliums im Zusammenhang steht. Während auf der Seite der Menschen das physische Schwert eingesetzt wird, kämpfen Christus und seine Nachfolger mit dem Schwert des Geistes, dem Wort Gottes
(Hebr 4,12; Eph 6,17). Für die Waffe Schwert gibt es auch eine andere Bezeichnung `romfaia`, welches unter anderem auch im übertragenen Sinne verwendet wird (Offb 1,16; 2,16; 19,15.21; Lk 2,35). Doch auch diese Schwertart ist ursprünglich als Waffe zum physischen töten geschaffen worden wie der Vergleich von Offb 6,4 mit 6,8 nahelegt. Hier wird noch mal deutlich wie wichtig es ist, den Kontext zu beachten. Und wie gefährlich es werden kann, wenn die Schrift nur buchstäblich ausgelegt wird.
Im Bild vom Reiter auf dem feurigen Pferd geht es um Kriege, Blutvergießen, Brände und Zerstörung aller Art, wie sie bereits seit Kain gab, in alter Zeit durch Eroberungen im großen Stil und wie sie Jesus vorausgesagt hat in seiner Ölbergrede (Jes 37,26; Jer 12,12; Mt 24,7-9; Mk 13; Lk 21). Damit geht einher, dass der natürliche Friede genommen wird sowohl im lokalen als auch im globalen Umfang.
Unter dem Bild der ersten Posaune werden Zerstörungen beschrieben, welche unter anderem auch durch Feuer entstehen (Offb 8,7).
Aus den Mäulern der Rosse aus Offb 9,17-18 ging Feuer, Rauch und Schwefel hervor, doch durch sie wird uns eine Perspektive gezeigt welche sich auf einer anderen, einer geistigen Ebene abspielt.
Obwohl durch das Bild des zweiten Reiters eindeutig zerstörerische, also negative Geschehnisse dargestellt werden, geschieht es unter der Zulassung und Kontrolle dessen, der auf dem Thron ist. Und was für uns heute nicht mehr im Blickfeld ist, dass Gott in der Geschichte Israels unter anderem selbst Kriege angeordnet hatte oder als Züchtigungsrute für sein Volk kommen ließ (Jos 1ff). Aber auch Gericht angekündigt hat im Falle von Ungehorsam: 3Mose 26,33; 5Mose 4,27; 7,15; 28,60-64; 32,35; Hab 1,5-8; Jes 45,7; 46,11).
Nun wenden wir uns den Texten aus dem Alten Testament zu, die auf irgend eine Weise das Bild in Offb 6,3-4 noch mehr erhellen könnten.
Unter den Gespannen in den Visionen des Propheten Sacharia kommen auch feurige Pferde vor. „Ich sah in dieser Nacht, und siehe, ein Mann saß auf einem roten (feurigen) Pferde, und er hielt zwischen den Myrten in der Tiefe, und hinter ihm waren rote (feurige) braune und weiße Pferde.“ (Sach 1,8 ähnlich auch in 6,2: feuriges Pferdegespann). Wie bereits in dem Abschnitt 2.2.1 beschrieben, stellen diese Gespanne bildhaft die vier Winde des Himmels (himmlische Geistwesen) dar, die vor dem Herrn der Erde stehen und in seinem Auftrag ausziehen. Der genaue Auftrag für das Pferdegespann mit den feurigen Rossen ist nicht beschrieben. Doch von den Engeln heißt es: „Er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen.“ (Hebr 1,7 mit Bezug auf Ps 104,4; dazu auch Offb 14,8: Engel, der die Macht über das Feuer hatte). Der Reiter auf dem einzelnen feurigen Pferd (Sach 1,8) hat eine besondere Funktion im Zusammenhang der vier Gespanne. Vom Gesamtkonzept des Buches Sacharia ist jedoch ersichtlich, dass der Herr durch Gericht und Gnade die Wiederherstellung Israels (Jerusalem, Tempel) im Auge hat, gleichzeitig aber die Völker durch Gericht zur Rechenschaft ziehen wird, um auch diese zur Umkehr zu rufen (Dan 3,26-31; Sach 1,13-17; 2,1-17; 8,20-22). Und diese Perspektive sollte im Bild des Reiters aus Offb 6,3-4 nicht aus dem Auge verloren gehen.
Aber da gibt es noch eine Geschichte, in der eine kriegerische Auseinandersetzung mit den Syrern beschrieben wird. So lesen wir im 2. Könige 6: „ Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. 15 Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus, und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr! Was sollen wir nun tun? 16 Er sprach: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind! 17 Und Elisa betete und sprach: HERR, öffne ihm die Augen, dass er sehe! Da öffnete der HERR dem Diener die Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. 18 Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach: HERR, schlage dies Volk mit Blindheit! Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas.“ (2Kön 6,14-18).
Durch diese Geschichte wird uns Einblick gewährt in die Welt hinter dem Vorhang der physisch/visuellen Wahrnehmung. Dies bedeutet, dass hinter menschlich feindlichen Unternehmungen auch eine größere göttliche oder stärkere Engel-Macht steht (Dan 10,13). Denken wir an die Aussage von Jesus an Petrus, wonach ihm 12 Legionen Engel zur Verfügung stünden, wenn er es nur wollte (Mt 26,53). In einer späteren Situation, bei der es Petrus nicht eingefallen wäre zum Schwert zu greifen, holte ein einziger Engel ihn aus dem Gefängnis heraus (Apg 12,1ff; Hebr 1,14).
Auch dieser Aspekt sollte in all den kriegerischen Auseinandersetzungen, welche durch das Bild des Reiters auf dem feurigen Pferd dargestellt werden, im Blick behalten werden.
Schauen wir uns auch noch Texte aus den Büchern Jeremia und Hesekiel an, denn sie werfen Licht auf die Bilder aus Offb 6,3-8.
Noch in der Zeit vor dem babylonischen Exil war der Tenor der von Gott berufenem Propheten Jeremia und Hesekiel, dass das Gericht über Jerusalem durch Schwert, Hunger und Pest (einschließlich durch wilde Tiere) bevorsteht. Mehr als 20 Mal werden diese ersten drei Gerichts Geiseln allein durch diese beiden Propheten für Juda und Jerusalem angekündigt, wobei sie sich auf frühere Prophezeiungen gründeten (3Mose 26,22ff; 5Mose 28,21ff; 32,22ff; Jer 14,11-17; 16,4; 21,6-9; 24,10; 27,8-10; 29,18; 32,24.36; 34,17; 38,2; 42,17.22; 44,13; Hes 5,12.17; 6,11-12; 7,15; 12,16; 14,14-21; 33,27ff). Dadurch wird klar, die Plage durch Schwert war damals zunächst gegen das sündige Israel gerichtet. Dass Viele Städte auch noch mit Feuer verbrannt wurden, ist Teil der Gerichte Gottes über sein Volk durch feindliche Heere (Jes 1,7; Jer 38,23; 52,13; Neh 1,3). Es ist geradezu auffallend, dass Jesus gleiches sagt wie die früheren Propheten wenn er über Jerusalem Krieg, Zerstörung, große Not einschließlich Gefangenschaft voraussagt (Mt 24,15: Gräuel der Verwüstung; Lk 19,41-44; 21,20-22; dazu auch die Voraussage in Dan 9,26). Und ebenso im globalen Ausmaß: „Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei; seht zu und erschreckt nicht. Denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere.“ (Mt 24,6-7).
Die Kette der Kriegerischen Auseinandersetzungen allein in den hinter uns liegenden zweitausend Jahren scheint nicht abzureißen und geht in die Tausende.
Unter dem Kaiser Hadrian (117-138) wurden die Eroberungskriege weitgehend gestoppt. Doch der jüdische Aufstand unter Bar-Kochba in den Jahren 132-135 kostete Hunderttausenden Menschen das Leben. Tausende gerieten in Gefangenschaft und wurden versklavt. Durch die Völkerwanderungen in den folgenden Jahrhunderten kam es zu unvorstellbar vielen und grausamen Kriegen, die jahrhundertelang nicht abzureißen schienen.
Und viele kriegerische Auseinandersetzungen wurden durch das sündige Verhalten der Kirchenführung mitverursacht. Die Kreuzzüge des Mittelalters zählen zu den schlimmsten, weil diese von und durch die Kirche gefördert wurden. Auch im Spätmittelalter sah es nicht besser aus, ganz zu schweigen von dem Blutgetränkten zwanzigsten Jahrhundert. Und dass Kriege in unserer Zeit seitens christlicher Führungen mitunterstützt werden ist offensichtlich – welch eine Verleugnung des Namens Jesu!.
Bereits hier erkennen wir eine Kontinuität, indem Gott aufgrund seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit in die Geschichte seines Volkes und der Nationen eingreift. Sein Zorn äußert sich in der Rache, das heißt in gerechter Vergeltung. Damit wird aber auch der Entfaltung des Bösen Einhalt geboten bis das Ziel durch das Evangelium vom Reich Gottes erreicht sein wird.
Diese Gerichte Gottes werden auf unterschiedliche Weise durchgeführt:
- Gott greift direkt ein (1Mose 6-8: Sintflut über die ganze Welt; 1Mose 19: Feuer und Schwefel über Sodom und Gomorra, Adma und Zeboim).
- Durch seine Engel (2Mose 12,23.29 mit Ps 78,49: Gericht über Ägypten; 2Sam 24,15 mit 1Chr 21,12: Gericht durch Pest in Israel wegen der Sünde von David; 2Kön 19,35: Gericht am assyrischen Heer ).
- Durch Weltherrscher (Jes 46,11; Jer 25,9: Gericht an Israel durch Nebukadnezar; Jes 44,28; 2Chr 36,22ff: Gericht an Babylon durch den Perserkönig Kyrus, der den Juden die Rückkehr erlaubte und den Wiederaufbau des Tempels förderte).
- Durch einen Herrscher, der nicht direkt von Gott gerufen wurde, den er aber gewähren ließ (Dan 9,26 mit Mt 24,15; Lk 21,20-22: Gericht über Jerusalem durch die Römer). Wenn Gott seine Gegenwart zurückzieht, ist ein Volk der Bosheit und Willkür von Menschen ausgeliefert. Dies gilt auch für den einzelnen Menschen (Röm 1,18ff).
Dass die wahren Kinder Gottes unter all diesen Umständen litten , ist Teil ihres treuen Zeugnisses für Christus (Offb 6,9-11; 13,5-8). Auch in diesem Kontext kann Offb 6,3-4 gesehen werden. Doch um des Reiches Gottes willen und der Verbreitung des Evangeliums, erlebten Gläubige auch besonderen Schutz. Beispiele: Durch die rechtzeitige Flucht aus Jerusalem und Judäa, entgingen viele von ihnen der notvollen Belagerung durch die Römer in den Jahren 68-70 n.Chr., der Hungersnot, dem physischen Tod oder der Gefangenschaft. Selbst Jesus mied in der Regel Gefahrenzonen (Joh 7,1). Ebenso seine Nachfolger (Apg 12,16; 17,20).
Mit dem Kommen des Reiches Gottes in diese Welt durch Jesus Christus kommt noch eine weitere Ebene des Gerichtes hinzu (Dan 7,13-14.27; Lk 1,31-33 mit 2Sam 7,11-13). Gegen dieses neue Reich Gottes stellten sich nicht nur die Könige der Erde, sondern auch die Führung Israels (Ps 2,1ff mit Apg 4,24ff). Diese Haltung hält bis heute an. In der Person von Jesus kam dieses himmlische Gottesreich auf die Erde. Bereits die Predigt des Evangeliums war Gericht für die Menschen (Joh 3,18-19).
Jesus ist demnach der Richter der Welt, der seine richterliche Funktion ausüben wird (Joh 5,27; 12,48). Und Petrus schreibt: „welcher ist zur Rechten Gottes, aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte.“ (1Petr 3,22). Dabei beginnt er wie damals so auch heute an seinem Volk und in seiner Gemeinde (Jer 25,29; 1Petr 4,17; Offb 2,16; 2,23). Und damit verbunden steht immer die Reinigung und Heiligung durch Läuterung seines Volkes im Vordergrund (Offb 3,19).
Aber Gottes übergeordnetes Ziel ist, durch seine Gerichte auch die Völker zur Umkehr zu bewegen. Dies ist auch einer der Grundtöne in der Offenbarung und wird bestätigt durch das Evangelium von Jesus Christus (Offb 10,11; 11,3ff; 14,8; Dan 3,26-31).
Schlussfolgerung: Durch das Bild des Reiters mit dem großen Schwert auf dem feurigen Ross wird auf dramatische Weise gezeigt, dass den Menschen ein wesentlicher Bestandteil für ihre Existenz und zwar die Sicherheit für Leib und Leben entzogen wird. Und wie wir feststellen werden, wird unter den folgenden Bildern der Entzug der Versorgung und Gesundheit weggenommen allerdings nur zum vierten Teil.
2.2.3 Das Lamm öffnet das dritte Siegel: Das schwarze Pferd mit seinem Reiter – was wird durch ihn dargestellt?
„Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen: Komm! Und ich sah: Und siehe, ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte: Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar! Und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu! (Ofb 6,5-6).
Das Lamm auf dem Thron öffnet das dritte Siegel und gibt damit einen weiteren Einblick in den Verlauf der Menschheitsgeschichte. Nun kommt das dritte lebendige Wesen (dessen Antlitz wie ein Mensch aussah) zum Einsatz und ruft „komm“. Da erscheint vor den Augen des Johannes ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß hatte eine Waage in seiner Hand.
Die gr. Bezeichnung für die Farbe schwarz ist `melas`. In einigen Texten ist die Farbe schwarz neutral:
- 1Mose 30,33-35: schwarzhaarige Schafe oder Ziegen;
- 3Mose 13,31.37: schwarzes Haar als Zeichen der Genesung;
- Hl 5,11 und Mt 5,36: schwarzes Haar;
- 2Joh 1,12: schwarze (gemeint ist Tinte).
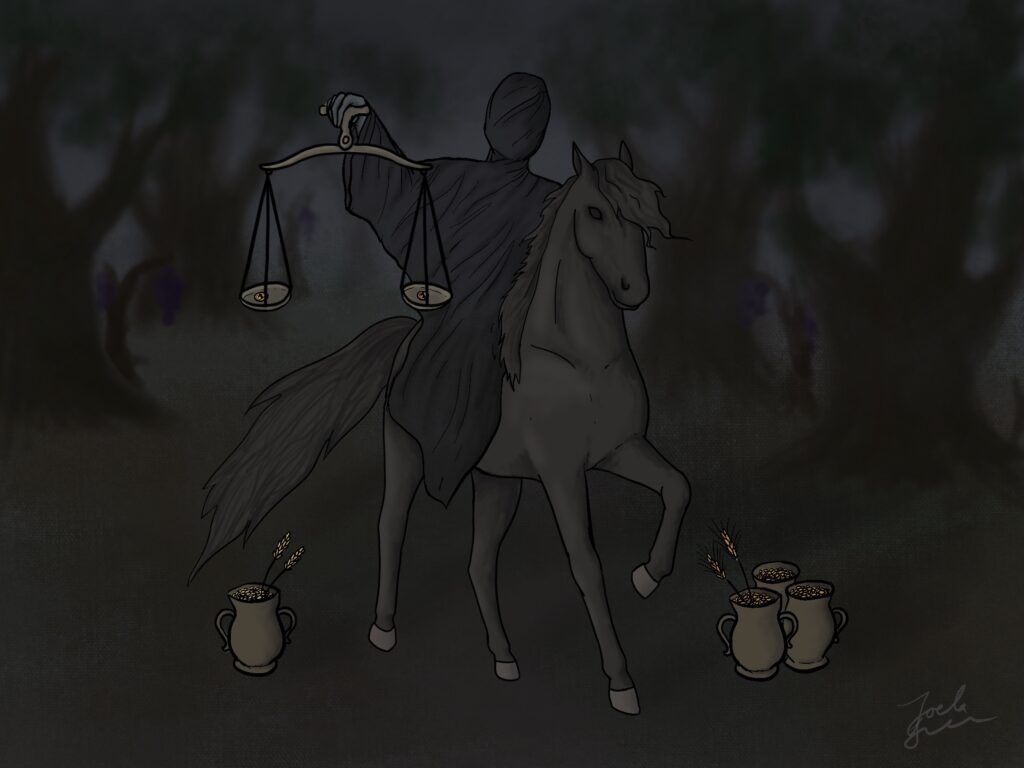
Abbildung 3 Schwarzes Pferd und sein Reiter mit der Waage in der Hand. (Zeichnung: Joela Schüle 24. Oktober 2021).
In anderen Texten weist das schwarze auf etwas Unheilbringendes hin:
- Offb 6,12: die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack.
- Joel 2,1ff: finsterer, dunkler Tag.
Für das Bild mit dem Reiter auf dem schwarzen Pferd gibt es auch eine Vorlage in Sacharia 6,6-8: „Die schwarzen Rosse zogen in das Land des Nordens, die weißen zogen hinter ihnen her, und die scheckigen zogen in das Land des Südens. 7 Diese starken Rosse also zogen aus und wollten sich aufmachen, um die Lande zu durchziehen. Und er sprach: Geht hin und durchzieht die Lande! Und sie durchzogen die Lande. 8 Und er rief mich an und redete mit mir und sprach: Sieh, die in das Land des Nordens ziehen, lassen meinen Geist ruhen (Schlachter Üs.: lassen meinen Zorn nieder) im Lande des Nordens.“ Im Kontext jener Zeit kann der Zug des schwarzen Gespannes mit einer Vergeltungsaktion gegen die, welche sich im Übermaß von Gewalt gegen das Volk Israel versündigten gesehen werden (Sach 1,15 und in der Voraussage Jes 47,6ff). Der Bezug zu Offb 6,5 ist in gewissem Sinne gegeben und es ist neben Sach 1,8-11 der einzige Text, der von schwarzen Rossen spricht.
Der eindrucksvollste Text jedoch stammt aus dem wenig bekannten Buch der Klagelieder Jeremias. Dort lesen wir: „Dem Säugling klebt seine Zunge an seinem Gaumen vor Durst; die kleinen Kinder verlangen nach Brot und niemand ist da, der’s ihnen bricht. 5 Die früher leckere Speisen aßen, verschmachten jetzt auf den Gassen; die früher auf Purpur getragen wurden, die müssen jetzt im Schmutz liegen. 6 Die Missetat der Tochter meines Volks ist größer als die Sünde Sodoms, das plötzlich unterging und keine Hand kam zu Hilfe. 7 Ihre Fürsten waren reiner als der Schnee und weißer als Milch; ihr Leib war rötlicher als Korallen, ihr Aussehen war wie Saphir. 8 Nun aber ist ihre Gestalt so dunkel vor Schwärze, dass man sie auf den Gassen nicht erkennt; ihre Haut hängt an den Knochen, und sie sind so dürr wie ein Holzscheit. 9 Den durchs Schwert Erschlagenen ging es besser als denen, die vor Hunger starben, die verschmachteten und umkamen aus Mangel an Früchten des Ackers. 10 Es haben die barmherzigsten Frauen ihre Kinder selbst kochen müssen, damit sie zu essen hatten in dem Jammer der Tochter meines Volks. 11 Der HERR hat seinen Grimm austoben lassen, er hat seinen grimmigen Zorn ausgeschüttet; er hat in Zion ein Feuer angesteckt, das auch ihre Grundfesten verzehrt hat. 12 Es hätten’s die Könige auf Erden nicht geglaubt noch alle Leute in der Welt, dass der Widersacher und Feind zum Tor Jerusalems einziehen könnte. 13 Es ist aber geschehen wegen der Sünden ihrer Propheten und wegen der Missetaten ihrer Priester, die dort der Gerechten Blut vergossen haben.“ (Klag 4,4-13).
In diesem Text wird die Dramatik der Hungersnot in der belagerten Stadt Jerusalem in aller Schwärze beschrieben. Somit weißt das Aussehen dieses Pferdes auf das Thema hin, welches unter diesem Siegel behandelt wird. Was Israel an Hungersnot erlebte, wird sich auch in neutestamentlicher Zeit im christlich/kirchlichen Bereich ereignen und es kommt auch auf die Völker zu: „Denn siehe, bei der Stadt, welche nach meinem Namen genannt ist fange ich mit dem Unheil an und ihr sollt ungestraft bleiben? Ihr sollt nicht ungestraft bleiben, denn ich rufe das Schwert über alle herbei, die auf Erden wohnen, spricht der HERR Zebaoth.“ (Jer 25,29).
Der Reiter mit der Waage ist der Einzige von den vier Reitern, bei dem nicht gesagt wurde, „ihm wurde gegeben“. Durch dieses Bild wird sozusagen ein Sachverhalt bildhaft und anschaulich dargestellt. Demnach ist er nicht der aktiv Eingreifende oder Verursachende einer Entwicklung, wie sein Vorgänger es war. Er zeigt durch die Waage in seiner Hand lediglich die Dramatik der entstandenen Situation an, denn Hunger ist häufig Folge kriegerischer Auseinandersetzungen, wenn auch andere Phänomene wie Erdbeben, Vulkanausbrüche und klimatische Unregelmäßigkeiten dazu beitragen.
Die gr. Bezeichnung für Waage ist `zygon`. Dieses Wort kommt im Substantiv ungefähr 77 Mal vor, 19 Mal als Waage und 58 Mal als Joch.
- Als Waage: 1Mose 23,16; 3Mose 19,36; Jes 46,6; Jer 32,9-10: „Und ich schrieb einen Kaufbrief und versiegelte ihn und nahm Zeugen dazu und wog das Geld dar auf der Waage.“
- Als Joch: 1Mose 27,40; 4Mose 19,2. In den Texten des NT jedoch wird der Begriff (außer von Offb 6,5) durchweg mit Joch übersetzt: Mt 11,29+30; Apg 15,10; Gal 5,1; 2Kor 6,14; 1Tim 6,1.
Dass den beiden Gegenständen dasselbe griechische Wort zugrunde liegt, hat wohl mit deren Beschaffenheit und Bestimmung zu tun. Wie bei einer Waage das Gewicht bestimmt wird, so kann auch bei einem Joch die Last gleich verteilt werden. Im jeweiligen Kontext wird klar, was gemeint ist. Da es in Offenbarung 6,5-6 um Verkauf und Kauf von Nahrungsmitteln geht (Weizen und Gerste) ist es verständlich, dass `zygon` mit Waage übersetzt wird.
Anscheinend wurde im Altertum nicht das Getreide, sondern nur das Geld (Gold, Silber, Kupfer) mit der Waage abgewogen (1Mose 23,16; Jes 46,6; Jer 32,10). Das Getreide jedoch wurde mit einem Hohlmaß gemessen. Der Verkauf von alltäglichen, notwendigen Lebensmitteln zum hohen Preis (1 Maß Weizen und 3 Maß Gerste = 1 Denar = Tageslohn) ist ein Hinweis für Mangel an diesen wichtigen Grundnahrungsmitteln. Der Begriff für die Maßeinheit im Text ist `choinix`, er kommt nur an dieser Stelle des NT vor. Dieses Hohlmaß variiert je nach Landschaft und Periode. Das (kleinste) Choinix = etwa 1 Liter, wäre ein realistischer Anhaltspunkt. Einige Ausleger nehmen an, dass es sich dabei um eine achtfache (oder mehr) Verteuerung dieser Grundnahrungsmittel handeln könnte.
Die Geschichte aus 2Kön 7,1 bei der man für einen Scheckel etwa 7 (13) Liter Hohlmaß (gr. metron) feinstes Weizenmehl kaufen konnte spricht dagegen für Überfluss.
Die äußeren Ursachen für den Mangel an den genannten Grundnahrungsmitteln sind neben Kriegen auch Dürre, Heuschreckenplagen, Hagel, Feuerbrände (1Mose 12,10; 26,1; 41-47; 2Mose 9,25; 2Sam 21,1; 1Kön 18,2; 2Kön 6,25; Hes 14,13; Apg 11,28). Aber die eigentlichen Gründe für Hunger liegen tiefer, wie folgende Textstellen nahe legen (Ri 6,1-6; 1Chr 21,12; Jer 12,9; 14,11-17; 16,4; 21,6-9; 24,10; 27,8-10; 29,18; 32,24.36; 34,17; 38,2; 42,17.22; 44,13; Hes 2,14; 4,16-17; 5,12.17; 6,11-12; 7,15; 12,16; 14,14.21; 33,27ff; 34,28).
Hungersnöte waren neben Kriegen häufig Auslöser für Völkerwanderungen und dies nicht nur in der Antike, sondern auch im 19. Und 20. Jahrhundert. Und auch in unserer Zeit sind Millionen Menschen auf der Flucht und der Suche nach besseren Lebensbedingungen.
Mit dem Begriff `limoi` (im Plural) sagt Jesus in seinen Endzeitreden Hungersnöte voraus (Mt 24,7; Mk 13,8; Lk 21,11). Unter dem Kaiser Klaudius (41-54 n.Chr.) traf eine große Hungersnot ein (Apg 11,28). Diese traf auch die Gläubigen in Judäa und Jerusalem. Wie Jesus, so ermutigt auch Paulus zur Furchtlosigkeit in solchen Zeiten aber auch zur Unterstützung der Notleidenden Geschwister (Mt 24,6; Röm 8,35; Apg 11,28ff; Gal 2,10; 2Kor 9-10).
Dem Öl und dem Wein soll kein Schaden zugefügt werden. Diese sind von der Teuerung ausgespart. Diese beiden Produkte wurden unter anderem auch im medizinischen Bereich verwendet. Einige Ausleger sehen in ihnen Luxusprodukte, welche in erster Linie den Reichen zugänglich waren.
Doch Ölbäume und die Reben wachsen dauerhaft und ohne besondere Pflege, sie sind auch nicht derart auf das Wetter (Frühregen und Spätregen) angewiesen wie es das Getreide war, welches immer wieder neu ausgesät werden musste. Auch in den Dürreperioden tragen sie Früchte. Was das bedeuten kann? Gott nimmt nicht alles weg. Bis zum Endgericht ist in den Zwischengerichten immer auch noch die Barmherzigkeit Gottes erkennbar. Während durch das vorangegangene Bild gezeigt wird, wie den Menschen teilweise die Sicherheit für Leib und Leben entzogen wird, erleben Menschen durch dieses Bild einen deutlichen Einschnitt in der Versorgung durch Nahrungsmittel.
Gottes Ziel ist, dass die Menschen sich ihm zuwenden. Dass die Gläubigen vor solchen Notzeiten verschont bleiben, hat Jesus nicht versprochen. Doch sie lernen dabei mit Wenigem auszukommen und noch mit anderen zu teilen (Mt 25,35; Apg 11,28; 2Kor 9-10). Wo geschieht dies auch in unserer Zeit.
Welche Hungersnöte sind uns aus den letzten 2 Jahrhunderten bekannt und welche Ursachen waren dafür verantwortlich? Wie schätzen wir die gegenwärtige Situation was die Hungersnöte betrifft in der Welt ein und wo sind die Gläubigen herausgefordert Not zu lindern?
2.2.4 Das Lamm öffnet das vierte Siegel – Das fahle Pferd und sein Reiter
„Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen: Komm! Und ich sah: Und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist Tod; und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde.“ (Offb 6,7-8).
Der Wortlaut zum Einstieg in die vierte Szene ist der gleiche wie auch bei den drei vorhergehenden, nur dass der Ruf `komm` jetzt vom vierten lebendigen Wesen (das einem fliegenden Adler ähnlich war) erschallt. Auch hier wird unsere Aufmerksamkeit zunächst auf das Pferd gelenkt. Das vierte Pferd wird in den meisten Übersetzungen als fahl bezeichnet, Der gr. Begriff im Text ist `chloros – grün`. Nach Wikipedia ist das Chlorophyll die grüne Substanz im Gras und `chloros` wird mit `gelblich-grün` übersetzt. Nach Offb 8,7; 9,4 und Mk 6,39; 1Mose 1,30; 2Mose 10,15 wird `chloros` mit grün übersetzt und zwar im Zusammenhang mit Gras. In Ps 37,2 werden die Gottlosen (Menschen) mit der Kurzlebigkeit des grünen Grases verglichen: „Denn wie das Gras werden sie bald (schnell) verdorren, und wie das grüne Kraut werden sie verwelken.“ (ähnlich auch 2Kön 19,26; Jes 37,27; Jer 14,6; und allgemein für die Vergänglichkeit des Menschen: Mt 6,30; Jak 1,11; 1Petr 1,24). Damit würde durch die optische Erscheinung des Pferdes die Anfälligkeit für Krankheiten, Kurzlebigkeit und Vergänglichkeit des Menschen zum Ausdruck gebracht. Die Farbe des Pferdes kann jedoch auch auf eine der schlimmsten Krankheiten `der Pest` hinweisen, welche besonders häufig durch Kriege und Hungersnöte ausbrechen. Es ist in gewissem Sinne eine Folgeerscheinung, die unter dem zweiten und dritten Siegel beschrieben wurde. Die Todespest wird aber auch als eine besonders harte und direkte Strafe Gottes beschrieben (2Mose 5,3; 9,3.15; 2Sam 24,13-15 mit 1Chr 21,12-14; Ps 78,50; Jer 21,6-7). Dies passt zu seinem Reiter, dem Tod und Feind des Lebens. Er reitet sozusagen auf dem anfälligem, kurzem und vergänglichem Leben des Menschen, denn der Übergang von grün zu gelb dauert oft nur kurze Zeit. Menschen, die von der Pest befallen wurden, starben oft innerhalb weniger Tage. Die Geschichtsschreiber schildern oft in dramatischen Beschreibungen die unsichtbare und doch so schrecklich verlaufende Krankheit.
- Denken wir an die sogenannte Justinianische Pest in den Jahren 542-550, die das Reich sehr geschwächt hatte und in den folgenden Jahrhunderten immer wieder aufgetreten war.
- oder die sogenannte Pest `der schwarze Tod` in den Jahren 1346-50, welcher etwa ein Drittel der Bevölkerung in Europa anheimgefallen war.
- Oder die sogenannte Spanische Grippe, die im Jahre 1918 in den USA ausgebrochen ist und nach Europa eingeführt wurde. Dieser fielen noch mehr Menschen zum Opfer als durch den 1. Weltkrieg bereits gefallen waren.

Abbildung 4 Der Reiter auf dem fahlen Pferd
Nahezu 300 Mal kommt der Begriff `Tod` in der Bibel vor, Er ist kein personelles Wesen, er ist sozusagen eine Machtgröße, ein Prinzip (Offb 2,10.11.23; 6,8; 9,6; 18,8; 20,6.13.14; 21,4.8; 1Kor 15,21.26.54). Sein Name ist Tod, doch über sein Aussehen wird nichts gesagt, nur das ihm der Hades (Totenreich) wie im Schlepptau folgt.
Bei dem ersten Reiter heißt es: „ihm wurde ein Siegeskranz gegeben“.
Bei dem zweiten Reiter heißt es zum einen: „ihm wurde gegeben den Frieden zu nehmen von der Erde“ und zum anderen: „ihm wurde ein großes Schwert gegeben, damit sie sich hinschlachteten“. Nicht der Reiter schlachtet, sondern er steht als Bild für Mord und Totschlag, an dem sich viele Beteiligen.
Bei dem dritten Reiter fehlt das „ihm wurde gegeben“. Doch durch ihn wird ein Sachverhalt deutlich gemacht. Es sind größtenteils Folgen, welche durch den zweiten Reiter oder durch gewaltige Naturereignisse entstehen.
Bei dem vierten Reiter dem der Hades folgte heißt es entsprechen den zwei genannten Machtgrößen: „ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde; zu töten mit dem Schwert, mit Hunger, mit dem Tod (Todespest) und durch die wilden Tiere der Erde“. Das „ihnen wurde Macht gegeben“ macht deutlich, dass es nicht in ihrem Ermessen liegt eigenmächtig zu handeln, denn Christus hat dem Tod die Macht genommen (2Tim 1,10; Offb 1,18). Wegen der Weigerung umzudenken, droht Jesus die Kinder der Isebel mit dem Tode zu schlagen (Offb 2,23).
Fällt uns da auf, dass die Waffe `Bogen` nicht erwähnt ist?
Anmerkung: Nach einer Auslegungsvariante wird das „ihnen wurde gegeben“ auf alle vier Reiter bezogen und die `wilden Tiere` dem Bild des ersten Reiters zugeordnet und zwar im übertragenen Sinne als Verführer (2Kor 11,14; Mt 24,4-5).
In der Tat vergleicht Jesus Verführer mit reisenden Wölfen (Mt 7,15). Auch bei Paulus finden wir diese Vergleiche (Apg 20,29). Diesen Vergleich gab es auch schon in Israel (Hes 22,27). Doch ist dieser Vergleich auch für Offb 6,2 und 6,8 anwendbar? Oder anders gefragt, kann man ohne weiteres die wilden Tiere aus Offb 6,8 mit dem weißen Pferd aus Vers 6,2 gleichsetzen? Pferde, Rosse oder Gespanne kommen in biblischen Texten etwa 167 Mal vor. Sie lassen sich zähmen und werden zu verschiedenen Zwecken eingesetzt. Aber werden sie auch als Bild für Verführungen verwendet? Und kann man ohne Weiteres das Schwert, den Hunger und die Todespest wörtlich nehmen, aber im gleichen Zug die wilden Tiere im übertragenen Sinne deuten?
Der Satzbau legt es eher nahe, dass sich das „ihnen wurde gegeben“ auf den Tod und den ihm nachfolgenden Hades bezieht. In Offb 1,18 und 20,13-14 werden Tod und Hades im Gespann als zwei Machtgrößen genannt. Auch vom Hadesch spricht Jesus als einer realen Machtgröße (Matthäus 16,18). Doch ihre Macht ist von einem Stärkeren begrenzt, in diesem Fall nur über den vierten Teil der Erde (vgl. auch mit Offb 9,17-20).
Noch einmal: Da jedoch im Text das Schwert, Hunger und tödliche Pest ausdrücklich zum physischen töten eingesetzt werden, warum nicht auch buchstäblich durch wilde Tiere? Auch diese sind für Menschen eine reale und lebensbedrohliche Gefahr. In der Natur ist dies zu beobachten. Jährlich sterben tausende Menschen durch Skorpione, Schlangenbisse und durch die verschiedenen wilden Tiere. Und die biblische Geschichte bestätigt, welche Gefahren von wilden und kriechenden Tieren ausgeht. Hier einige Beispiele:
- 1Mose 9,4-5: wilde Tiere stellen eine reale Gefahr für den Menschen dar, daher die Schutzmaßnahme Gottes.
- 2Mose 23,29: wilde Tiere bilden eine reale Gefahr für den Menschen besonders bei spärlicher Besiedelung.
- Zu den Gefahren durch wilde Tiere werden auch kriechende Tiere gezählt (3Mose 26,22; 5Mose 8,15; 32,24: Schlangen und Skorpione).
- Es gibt einige Geschichten, in denen wilde Tiere in Aktion beschrieben werden (Ri 14,5: ein Löwe greift Simson an; 1Sam 17,34: Bären und Löwen greifen die Schafherde von David an; 1Kön 13,24: ein Löwegreift einen Propheten an und tötet ihn; 2Kön 2,24: zwei Bären greifen 42 Kinder an und zerreißen sie; Jes 13,22: wilde Tiere bewohnen das entvölkerte Babylon; 31,4: der furchtlose Löwe über seinem Raub erschreckt nicht vor den Hirten.
Neben den realen Gefahren durch wilde Tiere, werden in der Geschichte Israels auch noch weitere drei Plagen genannt, welche in engem Zusammenhang unseres Textes stehen:
- Hes 5,12-17: Pest, Hunger, Schwert; böse Tiere.
- Hes14,14-21: „Denn so spricht Gott der HERR: Wenn ich meine vier schweren Strafen, Schwert, Hunger, wilde Tiere und Pest, über Jerusalem schicken werde, um darin auszurotten Menschen und Vieh.“ Dies sind genau die vier Plagen (Bogen nicht erwähnt), die auch in Offb 6,3-8 eingesetzt werden. Hier jedoch nur den vierten Teil aller Bewohner der Erde betreffend.
In anderen Texten werden diese Plagen im Einzelnen genannt oder zum Teil unterschiedlich kombiniert. Hier eine Auflistung:
- 2Mose 9,15: tödliche Pest gegen Pharao in Ägypten und sein Volk.
- 4Mose 21,6: Tödliche Plage durch Schlangen, welche das murrende Volk bissen.
- 5Mose 32,24-25: Angedrohte Plagen durch das Schwert und Feuer bei Ungehorsam.
- 1Kön 8,37ff: Hungersnot, Getreidebrand, Krankheit, Heuschrecken.
- 1Chr 21,12: 7 Jahre Hunger oder drei Monate Schwert oder 3 Tage Pest. David wählte 3 Tage Pest, obwohl diese Plage die schlimmste war, denn er sagte: lieber in die Hände Gottes fallen als in die Hände der Feinde.
- Jer 14,15-16: Schwert, Hunger; Jer 16,4: böse Krankheiten, Schwert, Hunger;
- Schwert, Hunger, Pest: Jer 21,6-9; 24,10; 27,8-10; 29,18; 32,24.36; 34,17; 38,2; 42,17.22; 44,13; Hes 6,11-12; 7,15; 12,16.
- Hes 33,27: „So sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr: So wahr ich lebe, sollen alle, die in den Trümmern wohnen, durchs Schwert fallen, und die auf freiem Felde sind, will ich den Tieren zum Fraß geben, und die in den Festungen und Höhlen sind, sollen an der Pest sterben.“
Wenn Gott sich gegenüber seinem Volk in solch einer Strenge verhielt mit dem Ziel sie zur Umkehr zu bewegen, wird er sich anders verhalten gegenüber den andere Nationen? Wie verliefen die hinter uns liegenden 20 Jahrhunderte? Jesus hat Plagen für diese Welt vorausgesagt:
- Mt 24,7: Kriege (Schwert) Hungersnöte, Erdbeben.
- Lk 21,9-11: Schwert (Kriege, Aufstände) große Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen.
- Lk 21,20-22: Große Not, Schwert, Gefangenschaft.
Unübersehbar scheinen diese Aussagen die Texte von Offb 6,3-8 zu erhellen.
Doch gegenüber den letzten drei Reitern steht das weiße Pferd in einem deutlichen Kontrast, aber auch seine Bestimmung kann durch Matthäus 24,14 begründet werden, nämlich Weltmission. Obwohl Jesus sie erst in Matthäus 24,14 nennt, steht sie immer am Anfang des Handelns Gottes (Mt 4,17; Lk 24,44ff; Mt 28,18-20; Apg 1,8).
Gott beginnt niemals mit seinem Gericht bevor er den Menschen über die Möglichkeit der Rettung informiert hatte. Und dies kann unter dem ersten Siegel gesehen werden.
Der Tod und das Totenreich machen reiche Beute durch die verschiedenen Werkzeuge, natürlich sind dabei auch immer Menschen beteiligt und betroffen. Diese Texte geben Einblick in das aktive, aber auch in das zulassende Handeln Gottes. Sein Ziel war es damals das Volk Israel durch Gerichte zur Umkehr zu bewegen und gleichzeitig seine Gerechtigkeit unter den Völkern zu offenbaren. Dies setzt er konsequent im Verlauf der Geschichte fort. Gott allein weiß genau, wie viele Menschen (auch Unschuldige und Zeugen Jesu) täglich, jährlich und im Laufe der Jahrtausende eines unnatürlichen, oft sehr frühen Todes gestorben sind, bzw. umgebracht wurden. Dabei handelt es sich (im Vergleich zu 1Mose 6-8) nur um den vierten Teil.
Durch diese vier Pferde mit ihren Reitern bekamen wir einen ersten Überblick über die Weltgeschichte bis zu Beginn der Wiederkunft Jesu und dem damit verbundenem Gerichtstag. Soweit die Bibelstudie zu Offb 6,1-8 nach dem aktuellen Erkenntnisstand.
Nun erwartet Johannes ein Blick in das himmlische Heiligtum.
2.2.5 Das Lamm öffnet das fünfte Siegel – Die Seelen der Zeugen unter dem Altar
„Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben; und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten.“ (Offb 6,9-11).
Nach der Öffnung des fünften Siegels sieht Johannes ein ungewöhnliches Bild. Es wird eine Szene gezeigt, die sich im Himmel in unmittelbarer Nähe Gottes abspielt. Was er sieht sind die Seelen derer, die um des Wortes Gottes und des Zeugnisses willen das sie hatten, umgebracht worden sind. Dieser Text stellt an uns mehrere Fragen, auf die wir nacheinander eingehen wollen.
Erste Frage: Wie ist die Bezeichnung Seelen zu verstehen?
Die deutsche Bezeichnung `Seele` ist nicht ganz einfach zu definieren. Der Grund liegt darin, weil durch das griechische Wort `psych¢` verschiedene Aspekte des menschlichen Wesens beschrieben werden.
- Mit `psych¢`, wird ein (lebendiges) Wesen, eine lebendige Person beschrieben (1Mose 2,7: der Mensch wurde zu einem lebendigen Wesen; 5Mose 10,22: „Siebzig Seelen gleich siebzig (lebendige) Menschen oder Personen; Apg 2,41: dreitausend Seelen, gemeint sind ,Menschen, Personen.
- Mit `psych¢` wird auch (physisches) Leben des Menschen beschrieben (1Mose 9,3f; und 3Mose 17,11: „denn im Blut ist das Leben“; Joh 10,11: „der gute Hirte gibt sein Leben hin“ (dazu auch Joh 10,17); Apg 20,24: ich achte mein Leben nicht wert“; Offb 12,11: „und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod“). Jesus sagte: „Wer sein Leben lieb hat, der verliert es; und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird’s bewahren zum ewigen Leben.“ Auf das physische und damit vergängliche Leben des Gläubigen folgt das geistliche, eben das ewige Leben. Damit sind mit `tas psychas` Menschen / Personen bezeichnet, denen Ihr physisches Leben auf der Erde genommen wurde.
- Die Begriffe Seele und Geist können bei Gläubigen auch noch nach ihrem physischen Tod in einem engen Zusammenhang gesehen werden. So sagte Jesus in Lk 23,46: „Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist“ (damit zitierte er Ps 31,6); Stephanus betete in Apg 7,59: „Herr Jesus, nimm meinen Geist auf“ Und in Hebr 12,23 wird gesagt: „wir sind gekommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten“. Die Seelen unter dem Altar sind eben auch die Geister der vollendeten Gerechten.
Zweite Frage: Wie endete ihr physisches Leben auf Erden?
Von diesen Seelen heißt es, dass sie geschlachtet wurden. Die Tötungsbezeichnung: `esfagmenön` (hier im Plural) ist die gleiche wie sie auch für Jesus, das Lamm Gottes verwendet wird (Offb 5,6.8; 13,8; Jes 53,7; Apg 8,32). Allerdings wird der Tötungsbegriff `schlachten` auch bei Kriegshandlungen mit dem Einsatz von Schwert verwendet (Hes 21,15.20.33; Offb 6,3-4). In 2Sam 11,25 und Jer 12,12 wird vom Schwert gesagt, dass es frisst (gr. fagetai), es handelt sich um die gleiche Wortwurzel wie auch in den oben genannten Stellen von Offb 6,4. Dazu heißt es, dass sie einander schlachteten, man kann sogar sagen einander (mit dem Schwert) auffraßen (vgl. dazu Sach 8,10). Das dieses Verb sogar im Wort `sarkofagos – Fleischfresser` seinen Niederschlag fand, zeigt seine breite Verwendung (Daher kommt auch das deutsche Wort Schlachtfeld). Auch hier entscheidet der Kontext über die Verwendung dieses Begriffes. Doch nach den Worten von Jesus werden nicht alle seine Nachfolger buchstäblich getötet. Denn das Martyrium kann auch andere Formen haben (Lk 11,49f).
Dritte Frage: Wo und in welchem Zustand befinden sich diese Seelen?
Von diesen Seelen wird gesagt, dass sie sich unter dem Altar befinden. Der Altar kommt in der Bibel mehr als 300 Mal vor, davon sieben Mal in der Offenbarung. In der Stiftshütte und dem Tempel gab es zwei Altäre – der mit Kupfer überzogene BrandopferAltar im Vorhof und der mit Gold überzogene Räucheropferaltar, welcher im Heiligtum stand und zwar vor dem Vorhang zum Allerheiligsten. In Offb 8,3-5 werden Details genannt, die eindeutig auf den goldenen Räucheraltar hinweisen. Dort heißt es: „Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß; und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks mit den Gebeten der Heiligen stieg von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde.“ Auch in Offb 9,13 heißt es: „ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gottes Thron“. Auch in Offb 14,18; 16,7 ist aufgrund des Textzusammenhangs derselbe Altar gemeint. Ebenso weist das Räucherwerk aus Offb 5,8 auf diesen Altar hin. Damit können wir davon ausgehen, dass auch in Offb 6,9-11 dieser goldene Altar gemeint ist. Dieser Altar ist nicht mehr durch einen Vorhang vom Thron Gottes im Allerheiligsten getrennt. Weitere Stellen zu dem goldenen Räucheraltar: Hebr 9,3: das Räuchergefäß; Lk 1,10-11: Räucheraltar; 2Mose 30,1.27; 31,8; 35,15; 37,24; 40,5; 3Mose 4,7). Der große kupferne Brandopferaltar wird zum jetzigen Zeitpunkt im (bzw. außerhalb des) himmlischen Heiligtums nicht erwähnt, denn Jesus hat durch sein einmaliges Opfer am Kreuz alle Sünden gesühnt ( Offb 1,5; 5,9; Hebr 10,10; 13,10).
Die Verortung der Seelen `unter` dem Räucheraltar, gr. `ypokatö – darunter`, ist nicht einfach nur eine räumliche, sondern eine dem jetzigen Zustand der Seelen entsprechende Beschreibung. Sie dürfen sich ausruhen von ihren physischen Leiden. Das gr. Verb `anapausontai – sie sollen ausruhen`, ist das gleiche wie auch in Offb 14,13: „sie ruhen aus von ihren Mühen“. Diese Art von Ruhe verspricht Jesus denen, die bereits hier zu ihm kommen (Mt 11,28-30). Dieses Ruhen ist jedoch kein unbewusster Zustand, denn sie nehmen wahr, was geschieht, bzw. fragen, warum etwas noch nicht geschieht. Jesus, der am besten Bescheid wusste sagte: „Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden; denn ihm leben sie alle“ (Lk 20,38). Was für eine Aussicht für jeden, der im Glauben an Jesus Christus aus dem physischen Leben in die Ewigkeit hinübergeht.
Vierte Frage: An wen wenden sich die Seelen mit dem Ruf nach Vergeltung?
Sie rufen (schreien) mit lauter Stimme indem sie sich an den wenden, der auf dem Thron ist und nennen ihn Herrscher gr. `despot¢s` „du Heiliger und Wahrhaftiger, bis wann richtest du nicht und rächst unser Blut an denen die auf Erden sind?“ Zunächst fällt uns die ungewöhnliche Anrede `despot¢s` auf, weil er in der Umgangssprache so negativ besetzt ist. Dieser Herrscherbegriff wird noch an folgenden Stellen verwendet und meistens auf Gott und auch den Herrn Jesus angewandt (Judas 1,4: „Herrn und Herrscher Jesus Christus“; 2Petr 2,1: „und verleugnen den Herrn, der sie losgekauft hat“; 2Tim 2,21: „der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt, für den Hausherrn brauchbar und zu allem guten Werk bereitet.“; Apg 4,24: „Herr, du hast Himmel und Erde gemacht“; Lk 2,29: „Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast“. Diese Herrschaftsbezeichnung wird aber auch auf Herren dieser Welt in ihrer Stellung gegenüber ihren Sklaven verwendet: 1Petr 2,18: „Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter“, so auch Tit 2,9; 1Tim 6,1-2). Diese Hoheitsbezeichnung unterstreicht auf besondere Weise den Stand des Herrschers gegenüber seinen Knechten / Sklaven) was in der Offenbarung deutlich zum Ausdruck kommt. Mit höchster Ehrerbietung und doch völlig angstfrei und vertrauensvoll wenden sich diese Seelen an ihren Herrn und Gebieter mit den Worten: „Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen?“
Auf die Formulierung: „die auf der Erde wohnen“ gehen wir im 3. Teil näher ein. Und dies ist die Antwort aus dem Thron: „Und jedem von ihnen wurde ein weißes Kleid gegeben.“ Die weiße `stol¢` ist ein sehr wertvolles, langes Festgewand, Festbekleidung (Lk 15,22; Mk 16,5). Das bedeutet doch, dass ihre durch den Glauben an Jesus Christus zugesprochene Gerechtigkeit bestätigt wurde (Offb 7,13; Offb 19,8).
Sie sollten ruhen eine kleine Zeit (mikron chronon). Anscheinend empfanden sie keine Zeit mehr, als ob die Zeit still steht. Nur Gott hat ein absolutes Bewusstsein für Zeitspannen, Zeiträume und deren Inhalte, bzw. Abläufe.
Immer wieder wird die Frage gestellt, ob der Ruf nach Vergeltung berechtigt ist? Man denkt dabei an die Grundaussage Gottes aus 5Mose 32,35 und die Zitate der Apostel: „Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben (5. Mose 32,35): »Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.« (Röm 12,19; so auch Hebr 10,30; ebenso Jesus in Mt 5,39).
Jene Gläubigen (Seelen) rächten sich nicht als sie auf Erden waren, genauso wie Jesus stellten sie es dem anheim „der da recht richtet“(1Petr 2,23). Weiter schreibt Paulus: „Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses angetan; der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken.“ (2Tim 4,14). Das Unrecht kann und soll genannt werden, doch Selbstjustiz kommt für Kinder Gottes nicht in Frage. Genau dies taten auch die Seelen unter dem Altar, eben nur in Form einer Frage. Der Ruf nach Vergeltung durch Gott war nichts Unrechtes. Denken wir an die Ermordung Abels. Gott sagte zu Kain: „Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde.“ (1Mose 4,10). Denn auch Abel befand sich unter dem Altar. Und Jesus sagte voraus: „auf dass über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, vom Blut Abels, des Gerechten, bis zum Blut Secharjas, des Sohnes Berechjas, den ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar.“ (Mt 23,35). Das Gott jedoch sein Gericht zurückhält spricht für seine Weisheit und Langmut, die alles menschliche bei weitem übertrifft (Röm 11,33; 2Petr 3,9).
Die Aussage: „die auch noch getötet werden sollen“ ist wahrscheinlich im allgemeinen Sinne gemeint, denn Jesus selbst sagte: „und etliche werden sie töten“, das heißt alle werden leiden müssen auf verschiedene Weise. Denn oft ist ein Leben in ständiger Verfolgung genauso ein Martyrium wie ein gewaltsamer aber schneller Tod. Denken wir auch an den Hass, der als Mord definiert wird (1Joh 3,15)
Fünfte Frage: Welche indirekte Botschaft wird den Gläubigen auf der Erde vermittelt?
Die Gläubigen hier auf Erden sollen sich auf eine von Leiden gezeichnete Existenz einstellen. So sagten Paulus und Barnabas den Gläubigen im Pisidischen Antiochia: „Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen.“ (Apg 14,22; Offb 7,13). Doch die Kinder Gottes sind nach ihrem physischen Tod in Gottes Umgebung in Sicherheit und werden getröstet (Lk 16,25; Offb 14,13).
Sechste Frage: Was meint Gott mit `noch eine kleine Zeit`?
Die Zeitangabe: `chronos mikron eös– Zeit kleine bis` kommt noch in Offb 20,3 vor, dort wird damit der Geschichtsabschnitt eingeschränkt, in dem der Satan noch einmal auf dieser Erde frei agieren kann (Offb 20,7-9). Hier bezieht sich diese Zeitangabe auf die Situation der Seelen im Himmel. Einerseits wird es nicht mehr lange dauern, andererseits dauert es noch so lange
„bis die anderen hinzugekommen sind, welche auch noch getötet werden sollen“. Damit erübrigt sich der Versuch einer zeitlichen Berechnung. Auf jeden Fall ist das Zeitempfinden in der Sphäre Gottes ein anderes als bei denen hier auf der Erde.
2.2.6 Das Lamm öffnet das sechste Siegel: Die erste Beschreibung des Weltgerichts
„Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete: Und es geschah ein großes Erdbeben; und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind, seine Feigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge; und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes! Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Und wer vermag zu bestehen?“ (Offb 6,12-17).
Johannes sieht wie das Lamm das sechste Siegel öffnet. Was ihm jetzt gezeigt wird, weist auf das Endgericht hin. Diese Details müssen ihm bereits aus den Endzeitreden von Jesus bekannt gewesen sein, denn dazu stellt er keine Fragen (Mt 24,24-33; Lk 21,25-28; 34-36; Mk 13,24-32). Wir werden sehen, dass im Buch der Offenbarung noch an weiteren Stellen das Endgericht beschrieben wird und dabei auch weitere Aspekte des Gerichtes gezeigt werden (Offb 11,15-19; 14,14-20; 19,15-21; 20,10-15). Und nun die einzelnen Details aus diesem Textabschnitt.
Zeichen auf der Erde: Ein großes Erdbeben
Das Erste was Johannes wahrnimmt ist ein großes Erdbeben. Wir dürfen uns durchaus vorstellen, dass die gewaltigen Naturereignisse Johannes in einer Art Audio-Videoformat gezeigt wurden. Die griechische Bezeichnung für Erdbeben ist `seismos`, daher das Fachwort Seismologie. In den biblischen Berichten werden Erdbeben mehr als zwanzig Mal erwähnt (1Kön 19,11-12; Hes 3,12-13; 38,19; Am 1,1; Sach 14,5; Mt 27, 51.54; 28,2; Mk 13,8; Apg 16,26). Und Jesus hat weitere Erdbeben vorausgesagt (Mt 24,7; Mk 13,8; Lk 21,11). Dieses Naturphänomen hat Menschen seit je her in Angst und Schrecken versetzt (Ps 68,9; 77,19; Mt 27,51,54). Viele Bauwerke und ganze Städte sind durch Erdbeben zerstört worden. Von 1900 bis 2015 sind mehr als 2 Millionen Menschen durch Erdbeben ums Leben gekommen.
Im Buch der Offenbarung sind Erdbeben Begleiterscheinungen sowohl der vorläufigen Gerichte Gottes als auch des Endgerichtes (Offb 6,12; 8,5; 11,13.19; 16,18; dazu auch Jes 13,13). Im Text wird betont, dass es ein großes (starkes) Erdbeben war mit globalen Auswirkungen. In unserer Zeit werden jährlich Hunderttausende kleinere und größere Erdbeben registriert. Häufig sind Erdbeben mit Vulkanausbrüchen verbunden. So faszinierend diese aus der Ferne aussehen, so verheerende Auswirkungen haben sie in ihrer unmittelbaren Umgebung. Sie machen die Ohnmacht des Menschen offensichtlich. Eines Tages wird die Neugier der Schaulustigen ein Ende haben. So lesen wir in Hebr 12,26-27: „Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert, jetzt aber verheißt er und spricht (Haggai 2,6): »Noch einmal will ich erschüttern nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel.« 27 Dieses »Noch einmal« aber zeigt an, dass das, was erschüttert wird, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, auf dass bleibe, was nicht erschüttert wird.“ Daher sollte jedes Erdbeben die Menschen an den Großen Tag des Gerichtes Gottes erinnern.
Zeichen am Himmel: An Sonne, Mond und Sternen
„und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind, seine Feigen abwirft.“ (Offb 6,12-13).
Diese Beschreibungen wecken in uns Erinnerungen an Geschichten aus der biblischen Offenbarung. Sie erinnern auch an Voraussagen in Bezug auf dramatische Phänomene an Himmelskörpern (Joel 3,1ff; Jes 13,10). Zunächst jedoch zu der einmaligen Formulierung „schwarz, wie ein härener Sack“. Bekannt ist, dass Teppiche für das Zelt des Zeugnisses aus Ziegenhaar hergestellt wurden (2Mose 31,20). Sehr wahrscheinlich wurden auch Mäntel und Säcke daraus gewoben (2Kön 1,8; Jes 20,2; Sach 13,4). Bis heute sind schwarzhaarige Ziegenherden im Orient ein häufiges Bild (1Mose 30,32-35). In solch grobes, aber auch stabiles Sacktuch hüllte man sich zum Zeichen der Trauer. Häufig setzte man sich dabei in Asche zum Zeichen der Demütigung und auch der Buße vor Gott (Est 4,1; Dan 9,3; Jona 3,6; 2Kön 19,1; 2Sam 3,31; Mt 11,21; Lk 10,13). Demnach wäre der Ausdruck: „schwarz, wie ein härener Sack“ ein passender Vergleich für die Verdunkelung der Sonne. Die Reaktion wird sein, große Trauer und Entsetzen, vorbei mit dem Leben in Luxus (Amos 8,10; Offb 18,10.17.19). Der Vergleich „und der ganze Mond wurde wie Blut“ kommt auch in anderen Texten vor und steht immer im Zusammenhang mit den Veränderungen an der Sonne.
Die erste Erwähnung einer partiellen Sonnenfinsternis während drei Tagen in Ägypten wirft zwar Fragen für die Astronomen auf, nicht aber für die Glaubenden an den Schöpfer Gott (2Mose 10,21-23). Auch während der letzten drei Lebensstunden von Jesus wurde es finster über dem ganzen Land, so alle drei synoptischen Evangelisten (Mt 27,45; Mk 15,33; Lk 23,44-45). Die Aussagen der Propheten über Verdunkelung der Sonne und des Mondes sind zahlreich. In der Regel werden Sonne, Mond und Sterne als die von Gott geschaffenen Lichter zusammen genannt.
- In Hiob 9,7 steht: „Er gebietet der Sonne, und sie geht nicht auf; er verschließt die Sterne mit einem Siegel.“
- Und in Jesaja 13,10 steht: „Ja, die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden nicht mehr glänzen; die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht leuchten lassen.“ Der Kontext weist auf das Gericht Gottes hin und zwar über den Erdkreis (Jes 13,11).
- Jesaja 24,23: „Da wird der Mond erröten und die Sonne schamrot werden; denn der HERR der Heerscharen herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem, und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit.“ Auch hier ist im Kontext vom Gericht über diese Erde die Rede und zwar mit dem Ausblick auf die neue Schöpfung (Jes 24,20ff).
- Joel 3,4: „die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des HERRN kommt.“ (so auch Joel 4,15; Apg 2,20; ähnlich auch Amos 8,9).
- Die eindrucksvollste Aussage stammt von Jesus selbst: „Bald (sofort) aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, und der Mond wird seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden.“ (Mt 24,29; Mk 13,24).
Ob es jemand aufgefallen war, dass im Text der Offb 6,13 die Sterne auf die Erde fallen und Jesus sagt lediglich, dass die Sterne vom Himmel fallen werden. Im Text der Offenbarung wird diese Aussage gemacht und dabei mit Feigen verglichen, die auf den Boden fallen, wenn der Baum von einem starken Wind geschüttelt wird. Es geht um einen Vergleich, denn nach den Worten von Jesus werden die Kräfte des Himmels ins Wanken geraten, also ihre Stellung oder ihre Bahnen verlassen. Und Petrus ergänzt, dass die Elemente vor Hitze zerschmelzen und aufgelöst werden.
Die Zusammenhänge zwischen den partiellen Naturereignissen mit der Sonne, dem Mond und den Sternen in der Geschichte als vorläufige Hinweise, dann auch die Voraussagen der Propheten und des Herrn Jesus Christus in Bezug auf das Endgericht, sind offensichtlich.
Der Himmel entschwand wie eine Schriftrolle
Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch (Schriftrolle), das zusammengerollt wird. (Offb 6,13).
Auch dafür gibt es bereits im Alten Testament Voraussagen:
- Jes 34,4: „Und alles Heer des Himmels wird dahinschwinden, und der Himmel wird zusammengerollt werden wie eine Buchrolle, und all sein Heer wird hinwelken, wie ein Blatt verwelkt am Weinstock und wie ein dürres Blatt am Feigenbaum.“ (dazu auch Ps 102,26-27; Hebr 1,10-11).
- Jesus bestätigte: „Himmel und Erde werden vergehen“ (Mt 24,35; Mk 13,31; Lk 21,33).
- Lk 21,26: „und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde; denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen.“
- Und Petrus präzisiert, wie sie vergehen werden: „Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb; dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein.“ (2Petr 3,10; Jes 65,17).
Wie bereits oben erwähnt, wird in der Offenbarung der Gerichtstag mindestens vier(5)mal beschrieben. Bei der letzten Beschreibung des Gerichtes lesen wir: „Und ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß; vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden.“ (Offb 20,10). Diese Beschreibung enthält ähnliche Aspekte wie auch in Offb 6,12-17 aber sie beschreibt auch die letzten Ereignisse des Gerichtstages.
Der Schrei nach Hilfe: Ihr Berge verbergt uns
„und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihren Orten. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge; 16 und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes! 17 Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns.“ (Offb 6,15-17a).
Nun werden einige Details im Ablauf dieses Gerichtstages beschrieben. Das Schreien nach Hilfe geht ins Leere, weil ihnen der scheinbare Schutz der Berge entzogen wird. Das große Erdbeben bringt auf der Erde alles aus den Fugen. Über diesen Ruf in der Verzweiflung gibt es auch Aussagen in den Propheten und von Jesus.
- Hosea 10,8: „Die Höhen des Frevels werden verwüstet, auf denen sich Israel versündigte; Dornen und Disteln wachsen auf ihren Altären. Dann werden sie sagen zu den Bergen: Bedeckt uns!, und zu den Hügeln: Fallt über uns!“ (vgl. dazu auch Jes 2,10.19.21).
- Jesus zitiert auszugsweise die Prophezeiung aus dem Propheten Hosea auf seinem Weg nach Golgatha und bestätigt deren Erfüllung in der Zukunft: „Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in der man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht genährt haben! Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen: Fallt über uns!, und zu den Hügeln: Bedeckt uns! Denn wenn man das tut am grünen (feuchten) Holz, was wird am dürren werden?“ (Lk 23,28-31). Auch wenn einige Aspekte dieser Voraussage sich zunächst auf die Zeit der Zerstörung Jerusalems bezogen werden können, so ist doch der Kern jener Prophetie auch auf die noch folgenden Tragödien anzuwenden.
In dieser ersten Darstellung des Gerichtstages wird nur die Situation und das Schicksal der Ungläubigen aus allen sozialen Schichten der Gesellschaft beschrieben. Was mit den Erlösten geschieht, wird in den Visionen von Offb 7,1-17 beschrieben. Bereits im 1. Kapitel Vers 7 lesen wir: „Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, Amen.“ (lies dazu auch Mt 24,30 wo Jesus ähnliches voraussagte).
Der Tag des Zornes Gottes und des Lammes
Dieses Thema und diese Realität werden oft ausgeblendet in der Verkündigung. Was wäre aber, wenn es keine gerechte Vergeltung geben würde? Der gr. Begriff `org¢ – Zorn` kommt in der Bibel mehr als dreihundert Mal vor, sowohl vom Menschen ausgehend als auch von Gott. Was für viele ungewöhnlich erscheint ist, dass auch der Sohn Gottes als das Lamm Zorn empfindet und entsprechend reagiert. Während seiner Dienstzeit zeigte Jesus nur einmal seinen Zorn, wobei er nicht mit Vergeltung reagierte (Mk 3,5). Doch nur Gott der Vater und der Sohn Gottes Jesus Christus sind imstande ihr Gerechtigkeitsempfinden angemessen auszudrücken und anzuwenden. Mit anderen Worten, der Zorn Gottes und des Lammes äußert sich in der gerechten Vergeltung an denen, die Unrecht tun.
- Zef 2,2: „ehe denn das Urteil ergeht – wie Spreu verfliegt der Tag –, ehe denn des HERRN grimmiger Zorn über euch kommt, ehe der Tag des Zorns des HERRN über euch kommt!“
- Lk 3,7: „Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet.“
- Röm 1,18: „Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten.“
- Röm 2,5: „Du aber, mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen, häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes.“
- 1Thes 1,10: „und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn.“ (Weitere Stellen: Offb 14,10; 15,1; 16,19; 18,25; 19,15-21).
Dies ist die erste visionäre Beschreibung des großen Tages Gottes, der als großer Tag des Zorns, d.h. der Vergeltung beschrieben wird. Das ist auch der Tag des Gerichtes Gottes durch den Menschensohn Jesus Christus.
Es folgen noch weitere vier ausführliche Beschreibungen dieses Tages in den Kapiteln 11; 14; 19 und 20. Dort werden einige Aspekte bezüglich des Gerichtstages wiederholt und weitere kommen hinzu. In der Wiederholung dieser Thematik erkennen wir auch die Konzeption des Buches, bei der die gesamte Entwicklung der Geschichte mehrmals aus verschiedenen Perspektiven bis zum Ende gezeigt wird.
Kapitel 6 endet mit der Frage: „Wer kann bestehen?“ Diese Frage wird in Offb 7,1-17 beantwortet.
2.3 Die Versiegelung der Knechte Gottes und die Vollendung der Erlösten
In den Visionen von Kapitel 7,1-17 bekommt Johannes Einblick in den Verlauf der Versiegelung der 144000 welche hier auf Erden an dem Glaubenden vorgenommen wird, so wie der unzählbaren Schar derer, welche das Ziel in der Vollendung erreichen werden. Solch ein Ausblick ist eine Ermutigung für die bedrängte und leidende Gemeinde auf Erden, sich in dieser Vision als das versiegelte und damit auch erlöste Volk Gottes bereits am Endziel zu sehen.
In diesen Visionen wird die Antwort gegeben, welche am Ende von Kapitel 6 gestellt wurde, nämlich: „und wer vermag zu bestehen“?
2.3.1 Die Einleitung zu den Visionen von den 144000 Versiegelten und der unzählbaren Schar vor dem Thron
„Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen; die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der Erde noch auf dem Meer noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte; und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sagte: Schadet nicht der Erde noch dem Meer noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben.“ (Offb 7,1-3).
Johannes beginnt mit den Worten: „Nach diesem sah ich“. Diese einleitenden Worte kommen mehrmals in den Visionen der Offenbarung vor (Offb 4,1; 7,1; 7,9; 15,5; 18,1). Natürlich sieht Johannes diese Visionen nacheinander, doch dies bedeutet nicht zwingend, dass sich das Geschaute immer chronologisch auf das vorhergehende aufbaut. Feststellen lässt sich dies immer nur im Kontext. Die Ereignisse in der Vision aus Kapitel 7,1-8 können nicht chronologisch nach dem Gericht stattfinden, welches bereits in Kapitel 6,12-17 geschaut wurde. Anders verhält es sich mit der Vision aus Kapitel 7,9-17. Diese baut in der Tat auf die vorhergehende Vision in (Offb 7,1-8 auf. In den beiden Visionen aus Kapitel sieben wird in symbolischen Zahlen zusammengefasst wer und wie viele Menschen im Laufe der Geschichte als Gottes Volk hier auf Erden versiegelt sein werden. Demnach wird diese Versiegelung bis zum Endgericht abgeschlossen sein. Bis dahin gilt die Anweisung an die vier Engel: „schadet der Erde und dem Meer nicht“. In Kapitel 7,9-17 sieht Johannes aus himmlischer Perspektive das gesamte Volk Gottes bereits in seinem vollendeten Zustand als am Ziel angekommen. Was für eine Ermutigung für die bedrängte und verfolgte Gemeinde in dieser Welt.
Doch nun zu den Details dieser ersten Vision. Wer sind die vier Engel, welche an den vier Ecken der Erde stehen? In Hebräer 1,7 lesen wir etwas Grundsätzliches über die Engel: „Und von den Engeln zwar spricht er: „Der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme.“ (vgl. mit Ps 104,4; Hebr 1,14). In Sacharia 1,8-11 und 6,1-8 stehen die vier Gespanne symbolisch für die vier Winde des Himmels. Sie sind ausgesandt für bestimmte Dienste, nachdem sie vor dem Herrn der ganzen Erde gestanden haben. Da jene vier Winde (Gespanne) bereits auf Erden in der Geschichte eingesetzt wurden, können sie nicht gleichgesetzt werden mit den vier Engeln aus Offb 7,1. Die Aussage „vier Enden (Ecken) der Erde“ kommt noch in Offenbarung 20,8 vor. An anderen Stellen der Bibel werden diese mit den jeweiligen Himmelsrichtungen beschrieben, so zum Beispiel in 1Mose 28,14, 4Mose 35,5; 5Mose 3,27; 1Chr 9,24; Ps 107,3; Jes 11,12; Lk 13,29. Diese vier Engel sind ausgestattet mit der Macht über Erde, Meer und Vegetation. Auffallend bei diesen Engeln ist, obwohl sie bereit sind, handelt keiner von ihnen eigenmächtig.
Und nun tritt ein anderer Engel vom Sonnenaufgang her auf, ausgestattet mit dem Siegel des lebendigen Gottes. Sonnenaufgang steht für den Tagesbeginn. Er zeigt aber auch eine segensvolle Zuwendung Gottes an (Mal 3,16-20). Die Anweisung an die vier Engel lautet: Die Erde, das Meer und die Bäume nicht zu beschädigen „bis wir versiegelt haben die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen.“. Mit dem „wir“ wird hervorgehoben, der Engel ist nicht allein bei der Ausführung der Versiegelung. Die Bezeichnung „Knechte Gottes“ für die Gläubigen ist typisch im Buch der Offenbarung (Offb 1,1; 2,20; 6,11; 10,7; 11,18; 19,2.5; 22,3.6). Seine Aussage erinnert uns auch
An eine ähnliche Handlung die in Hesekiel 9,3-6 beschrieben wird. „Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle des Tempels, und er rief dem, der das leinene Gewand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite. Und der HERR sprach zu ihm: Geh durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen. Zu den andern Männern aber sprach er, sodass ich es hörte: Geht ihm nach durch die Stadt und schlagt drein; eure Augen sollen ohne Mitleid blicken und nicht verschonen. “ Die Gerechten werden bewahrt bleiben und fallen nicht unter das Gericht zur Verdammnis.
- Aufschlussreich ist auch die Aussage von Jesus in Matthäus 13,27-30: „Da traten die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du also, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach: Nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte; und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne; aber den Weizen sammelt in meine Scheune.“
Weitere Stellen, welche von der Zurückhaltung des Gerichtes sprechen: Mk 13,27; Mt 28,14; Röm 11,25; 2Petr 3,7-9; Offb 6,11.
Vielleicht müssen wir unterscheiden zwischen den Gerichten Gottes im Laufe der Geschichte, die den Zweck haben Menschen zum Umdenken zu bewegen und der Endgerichtsphase, bei dem es keine Umkehr mehr geben wird. Mehr dazu im dritten Teil, in dem es unter anderem um die Posaunengerichte gehen wird.
Das Zeichen an der Stirn und Hand im Alten Testament
Die Stirn des Menschen wird gelegentlich mit seinem Herzen in Verbindung gebracht. Harte Stirn gleich verstocktes Herz (Hes 3,7; Jes 48,4). Hand steht in der Regel für das Handeln des Menschen, aber auch für das Handeln Gottes (1Mose 5,29; Ps 102,26; 128,2; 1Kor 4,12). Im AT finden wir einige Hinweise zu einem Zeichen an Hand und Stirn:
- 2Mose 39,30: „Sie machten auch das Stirnblatt, den heiligen Kronreif, aus feinem Gold und schrieben darauf wie in ein Siegel geschnitten: »Heilig dem HERRN«.“ Dem Herrn geweiht, den Herrn gehörend.
- 2Mose 13,9: „Darum soll es dir wie ein Zeichen sein auf deiner Hand und wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, damit des HERRN Gesetz in deinem Munde sei; denn der HERR hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt.“ (2Mose 13,16).
- 5Mose 6,4-8: „Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR ist einer. 5 Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. 6 Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen 7 und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. 8 Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein.“ (so auch in 5Mose 11,18).
Bedeutungen solcher Merkzeichen:
- Als Bekenntnis der Zugehörigkeit zu Gott.
- Als Gedächtnisstütze zur Erinnerung an den EINEN wahren Gott.
- Erinnerung an das erste und höchste Gebot.
- Erinnerung an die wunderbare Rettung und Erlösung aus ägyptischer Sklaverei.
- Als Zeichen und Zeugnis für die Kinder.
Dabei ist dieses äußere Zeichen nur ein Hilfsmittel um Gottes Wort im Herzen zu bewahren und bewegen = Stirn und anzuwenden = Hand.
Doch wenn diese äußeren Zeichen bei den Israeliten auch eingehalten wurden, so sind sie doch mit ihrem Herzen immer wieder von Gott abgefallen und anderen Göttern nachgelaufen. Zur Zeit des Propheten Hesekiel griff Gott hart durch. Er brachte Gericht über die Bewohner Jerusalems und die Priesterschaft (Hes 9,5-6). Doch einen gläubigen Rest verschonte er. So lesen wir: „Und der HERR sprach zu ihm: Geh durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen.“ (Hes 9,4).
Aber in jener Zeit verhieß Gott sein Gesetz in die Herzen zu schreiben. Dazu versprach er ein neues Herz und einen neuen Geist. „und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet; von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.“ (Hes 36,25-27). Und durch den Propheten Jeremia verhieß Gott einen Neuen Bund (Jer 31,31-34). Dieser wurde von Jesus gestiftet (Mt 26,26ff). Spätestens jetzt wird klar, dass mit der Stirn der unsichtbare, innere und doch so reale Geist des Menschen gemeint ist. Die Stirn, dahinter das Gehirn, als physisch materielles Werkzeug für den Geist. Das Herz, nicht als Blutpumpe, sondern als Schaltzentrale unseres Empfindens , Denkens und Willens. Dementsprechend werden auch die Handlungen sein.
Das Zeichen der Versiegelung im Neuen Testament
Jesus und die Apostel verwendeten die äußeren Zeichen an Stirn und Hand nicht, doch sie predigten Umkehr im Denken und Handeln (Mt 4,17; Lk 8,15; Apg 2,37-38; 3,19; Röm 12,1-2; Phil 2,5).
Es gibt einige Hinweise im Neuen Testament zur Versiegelung durch den Heiligen Geist. Bereits Johannes der Täufer sagte von dem Messias: „der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.“ (Mt 3,11). Jesus verhieß den Heiligen Geist seinen Jüngern (Joh 14-16). Und vor seiner Himmelfahrt sagte Jesus: „denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden.“ (Apg 1,5). Das erlebten die Jünger auch am Pfingsttag in Jerusalem und zwar in einem Privathaus. Damit begann die Versiegelung der Gläubigen im Rahmen des Neuen Bundes. Und nach ihnen auch etwa 3000 Menschen jüdischer Herkunft unter ihnen auch Proselyten (Apg 2,1-18; 37-41). Doch auch Menschen aus den Nationen wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und damit versiegelt (Apg 8: in Samaria; Apg 10-11: in Hause des Kornelius in Cesarea; Apg 19:in Ephesus; Gal 3,1-14: in Antiochien, Ikonium, Lystra und Derbe).
Paulus schreibt an die Gläubigen in Ephesus, einer Gemeinde, die sich aus Juden und Nichtjuden zusammensetzte: „In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung – in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist.“ (Eph 1,13). Oder: „Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung.“ (Eph 4,30; und in Römer 8,16 schreibt er: „Der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind.“ Es ist also auch ein Merkmal der Zugehörigkeit zu Gottes Familie. Übrigens ist auch den Gläubigen des AT ihre Zugehörigkeit zu Gott bezeugt worden (Hebr 11,1.4.39). Dies entspricht der Versiegelung der Knechte Gottes in Offenbarung 7,1-8. Diese Versiegelung wird an jedem Menschen vollzogen, der durch den Glauben an Jesus Christus Vergebung seiner Sünden empfängt, erlöst wird und dadurch die Wiedergeburt erlebt (Joh 3,3-7; 2Kor 3,3; Tit 3,5). Sie wird abgeschlossen sein, wenn das Evangelium vom Reich Gottes allen Völkern verkündigt sein wird (Mt 24,14; Mk 13,13). Weitere Stellen zu der Versiegelung und den Versiegelten:
- Offb 9,4: „Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden noch allem Grünen noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben an ihren Stirnen.“ Doch die Versiegelten stehen unter Gottes Schutz.
- Offb 3,12: „Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen.“
- Offb 14,1: „Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn.“
- Offb 22,4: „und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein.“ Was für eine Auszeichnung und Aussicht!
- Paulus ermutigt seinen Mitarbeiter Timotheus: „Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt.“ (2Tim 1,14)
2.3.2 Die Aufzählung der Versiegelten aus den 12 Stämmen der Kinder Israels
„Und ich hörte die Zahl der Versiegelten: 144 000 Versiegelte, aus jedem Stamm der Söhne Israels. Aus dem Stamm Juda 12 000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12 000, aus dem Stamm Gad 12 000, aus dem Stamm Asser 12 000, aus dem Stamm Naftali 12000, aus dem Stamm Manasse 12 000, aus dem Stamm Simeon 12 000, aus dem Stamm Levi 12 000, aus dem Stamm Issaschar 12 000, aus dem Stamm Sebulon 12 000, aus dem Stamm Josef 12 000, aus dem Stamm Benjamin 12 000 Versiegelte. (Offb 7,4-8).
Nun hört Johannes die Zahl der Versiegelten. Während die erste Vision (1-3) eine Video / Audio Botschaft war, ist diese zweite nur eine Audiobotschaft. Wir gehen davon aus, dass es sich bei diesen Zahlen um symbolische Zahlen handelt, denn jede Deutung im mathematisch / buchstäblichen Sinne, scheint weder logisch noch im Einklang des Neuen Testamentes zu sein. Bei der Zahl 12 handelt es sich zunächst um die zwölf Stämme (nicht um die Stammväter als einzelne Personen) der Kinder Israel, aber auch um die zwölf Apostel des Lammes. Die Zahl Tausend kommt sehr oft in der Bibel vor und an einigen Stellen geht es einfach um eine nicht buchstäblich zu nehmende große Zahl (5Mose 7,9; 1Chr 16,15; Ps 50,10; 105,8; Jes 60,22; Dan 7,10).
Die vorhandenen Namenslisten der Söhne Jakobs zeigen Unterschiede auf, die keineswegs willkürlich sind. Nach menschlichen Kriterien hatte der Erstgeborene, aber auch der Erstgenannte in der Regel Vorrang. Die Kinder der rechtmäßigen Frauen von Jakob hatten auch Vorrang vor den Kindern der Nebenfrauen. Anders ist es bei Gott, der nach seinen eigenen Kriterien bewertet, beurteilt und festlegt (siehe die 5. Spalte in der Tabelle).
1.Mose 29-30 1.Mose 49 2.Mose 1 1.Chr 2 Offb 7,4-8
1. Ruben (Lea) 1. Ruben 1. Ruben 1. Ruben 1. Juda
2. Simeon (Lea) 2. Simeon 2. Simeon 2. Simeon 2. Ruben
3. Levi (Lea) 3. Levi 3. Levi 3. Levi 3. Gad
4. Juda (Lea) 4. Juda 4. Juda 4. Juda 4. Asser
5. Dan (Bilha) 5. Dan 5. Isaschar 5. Isaschar 5. Naftali
6. Naftali (Bilha) 6. Naftali 6. Sebulon 6. Sebulon 6. Manasse
7. Isaschar (Lea) 7. Isaschar 7. Benjamin 7. Dan 7. Simeon
8. Sebulon (Lea) 8. Sebulon 8. Dan 8. Josef 8. Levi
9. Josef (Rahel) 9. Josef 9. Naftali 9. Benjamin 9. Isaschar
10. Gad (Silpa) 10. Gad 10. Gad 10. Naftali 10. Sebulon
11. Asser (Silpa) 11. Asser 11. Asser 11. Gad 11. Josef
12. Benjamin (Rahel) 12. Benjamin 12. Josef 12. Asser 12. Benjamin
Einige Beobachtungen zu den Stammeslisten und mögliche Schlussfolgerungen.
- Nicht Ruben der Erstgeborene, sondern Juda führt in Offenbarung 7,4-8 die Stammesliste an. Dies wurde bereits von Jakob in seiner Segnung vorausgesagt (1Mose 49,1-4; 8-12). Diese führende Aufgabe des Stammes Juda zeigte sich bereits während der Wüstenwanderung, ebenso bei der Landverteilung (4Mose 2,3; Jos 15). Aus dem Stamm Juda kam der König David von dem Gott sagte: „er soll meinen Willen tun“ (1Sam13,14) Diese führende Rolle des Stammes Juda mündet letztlich in der Person von Jesus als Messias / König (Mt 1; Lk 3; Hebr 7,14; Offb 5,5). In Betracht kommt noch der besondere Einsatz von Juda als Bürge für den jüngsten Sohn Benjamin. Auch Jesus ist Bürge geworden, allerdings bezahlte er mit seinem Leben für die Schuld aller Menschen (vgl. 1Mose 43,9; 44,32 mit Hebr 7,22).
- Der Stamm Ruben rückt auf den zweiten Platz. Wegen seiner gräulichen Tat wurde ihm die Führende Aufgabe in Israel entzogen (1Mose 49,1-3). So spielte dieser Stamm in der Geschichte Israels keine besondere Rolle.
- Die Stämme Gad und Asser, geboren von Silpa, Leas Magd, rücken in der letzten Liste nach oben (1Mose 49,19-20; 5Mose 33,20). Die Magd musste herhalten für den Ehrgeiz von Lea. Gott erhöht die Niedrigen. Auch ist der Stamm Asser im NT im Zusammenhang mit der Prophetin Hanna genannt (Lk 2,36).
- Es folgt der Stamm Naftali, geboren von Bilha, Rahels Magd. Auch er wird in der letzten Liste den leiblichen Söhnen Rahels vorgezogen (1Mose 49,21; Jes 8,23; Mt 4,15). Beachten wir, dass die beiden Mägde von Lea und Rahel nicht aus dem Familienklan Terachs stammten, doch in der letzten Liste werden sie von Jesus einigen Söhnen von Lea und beiden Söhnen von Rahel vorgezogen. Seit Jakob (dritte Generation) sind Frauen aus anderen Volksgruppen im israelitischen Familienkreis aufgenommen. Und in der vierten Generation nahmen elf Söhne Jakobs Frauen aus kanaanitischen Stämmen und Josef sogar eine Priestertochter aus Ägypten.
- Manasse ist der erstgeborene Sohn von Josef. Seine Mutter Asenat ist Priestertochter in Ägypten (1Mose 41,51; 48,5.15.20; Jos 17,7ff).
- Es folgen die beiden Söhne von Lea, Simeon und Levi (1Mose 34,25-30; 49,5-7). Simeon bekam sein Erbteil im südlichen Teil des Stammesgebiets von Juda (Jos 19,1; 21,4). Er war aber auch zerstreut in Israel (2Chr 15,9). Der Stamm Levi hatte in Israel kein Erbteil bekommen. Er sollte am Heiligtum Dienst versehen, anstelle aller Erstgeborener in Israel (1Mose 49,4-7; 5Mose 10,8; 18,1; 4Mose 3,12). Doch im Reiche Gottes bekommt er sein Erbteil. Auch er ist im NT im Hebräerbrief genannt (Hebr 7,14). Barnabas war Mitarbeiter des Paulus aus dem Stamm Levi (Apg 4,36).
- Isaschar und Sebulon, ebenfalls Söhne von Lea (1Mose 49,13-15; Jes 8,23; Mt 4,15).
- Die Liste wird von Josef und Benjamin, den beiden Söhnen von Rahel, der Lieblingsfrau von Jakob abgeschlossen (1Mose 49,22-26;. 27). Josef, dessen Leben viele Parallelen zu Jesus aufweist und auch er ist im NT erwähnt (Apg 7,9-22). Benjamin an letzter Stelle in den meisten Listen. Doch auch im NT ist der Stamm Benjamin in der Person des Ap. Paulus erwähnt (Phil 3,5). So wird diese in der Offenbarung von Jesus festgelegte Reihenfolge von den Stämmen Juda und Benjamin flankiert. Beide Stämme hatten ihre Stammesgebiete nebeneinander, Jerusalem und der Zionsberg verbanden die beiden miteinander.
Bei genauerem Hinsehen stellen wir fest, dass zwei Stämme fehlen. Efraim, der jüngere Sohn von Josef, wurde doch bei der Segnung durch Jakob seinem älterem Bruder Manasse vorgezogen (1Mose 48,18-19). Und warum fehlt er in der Liste in Offenbarung, was könnten die Gründe dafür sein? Ist es weil Gott gesagt hat: „Denn das Haupt von Aram ist Damaskus, und das Haupt von Damaskus ist Rezin – und in fünfundsechzig Jahren soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk seien“ (Jes 7,8)? Lag es an Jerobeam, der als erster König des Nordreiches den Götzendienst eingeführt hatte (1Kön 11-14)? Doch bereits in der Richterzeit wurde in diesem Stamm der Götzendienst eingeführt (Richter 17). Aber auch der König Salomo hat zum Götzendienst in Israel beigetragen und dies hatte Auswirkungen auf den Stamm Ephraim (Neh 13,26; 1Kön 11,1ff).
Und warum fehlt der Stamm Dan, der Sohn von Bilha, Rahels Magd? Hat es damit zu tun, wie Rahel zu diesem Sohn kam, was ging dem voraus (1Mose 30,1ff)? Was bekam er von Jakob mit auf seinen Lebensweg? Jakob sagte seinem Sohn Dan nichts Gutes voraus (1Mose 49,16-18). Als der Stamm Dan sein Erbteil ganz im Norden des Landes in Besitz nahm, führte er zeitgleich den Götzendienst ein und zwar lange vor der Reichsteilung (Richter 18,1-30). Dies bedeutet jedoch nicht, dass es in diesen beiden Stämmen niemand gab, der Gott die Treue gehalten hätte (2Mose 31,6; 35,34; Ri 13,2; 1Kön 18,4; Röm 11,4).
Doch wir erkennen, dass das Verhalten der Väter und Mütter Auswirkungen auf die nachfolgenden Generationen hatte. Sicher bezieht Gott alle diese menschlichen Schwachpunkte mit ein. Doch letztlich handelt er nicht nach Verdienst der Werke, sondern nach der Gnade dessen der beruft (2Tim 1,9). Unter diesen Gesichtspunkten kann die Stammesliste in Offb 7,4-8 gesehen werden. Sicher ist, dass die Versiegelten nicht nach menschlichen Kriterien (Fleisch und Blut) zu der auserwählten Schar gehören. Ebenso ist die Zahl nicht buchstäblich, sondern symbolisch zu deuten. Hatte doch Gott zu jeder Zeit seine 7000, welche ihre Knie nicht gebeugt hatten vor dem Baal. So klärt Gott den Propheten Elia darüber auf.
Und Paulus zitiert Gottes Worte in Röm 11,2-6: „Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia, wie er vor Gott tritt gegen Israel und spricht (1. Könige 19,10): 3 »Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre haben sie niedergerissen. Ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten mir nach dem Leben«? 4 Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? (1. Könige 19,18): »Ich habe mir übrig gelassen siebentausend Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal.« 5 So geht es auch jetzt zu dieser Zeit: Ein Rest ist geblieben, der erwählt ist aus Gnade. 6 Ist’s aber aus Gnade, so ist’s nicht aufgrund von Werken; sonst wäre Gnade nicht Gnade.“
Schlussfolgerungen
- Abraham ist Vater aller Glaubenden“ (Röm 4,1-17). Nach Röm 11,17-27 werden die Gläubigen aus den Nationen in den jüdischen Ölbaum eingepfropft und bilden am Ende zusammen mit den Gläubigen aus den Juden das ganze Israel (Röm 11,25-26). Vergleiche dazu auch Eph 2,11-21: „Christus hat aus zwei eins gemacht“; Eph 3,6: „ihr seid miteinverleibt und Teilhaber der Verheißung“; Gal 3,26-29: „da ist weder Jude noch Grieche …, sondern ihr seid einer in Christus. … Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben.“. Auch Petrus erinnert an Gottes Plan mit seinem Volk indem er aus 2Mose 19,6 zitiert: „Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums“ (1Petr 2,9). Denken wir daran, was Jesus in Johannes 10,16 gesagt hat: „Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden.“ Auf diese Weise wird erfüllt, was Gott durch seinen Messias verheißen hat (Jes 49,6: „er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde.“ Und in Mt 8,10-12 sagt Jesus: „Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch: Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden! 11 Aber ich sage euch: Viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen; 12 aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis; da wird sein Heulen und Zähneklappern.“
- Das Bild in Offb 14,1-5 zeigt die gleiche Schar der Versiegelten, wie auch in Kap. 7,3-8. Hier aber bereits auf dem Berg Zion: „144000 auf dem Berg Zion, die erkauft sind von den Menschen oder von der Erde“). Demnach steht die Zahl 144000 für die Vollständigkeit und Vollzähligkeit der Erlösten aus Israel und allen Nationen. Denn wenn es ein Israel nach dem Fleisch gibt, dann gibt es auch ein Israel nach dem Geist und zu diesem zählen auch alle Glaubenden aus den Nationen (Gal 6,16; Röm 3-4; 11,25).
- Schauen wir noch die Bilder an, welche diese Gemeinde in der Neuen Schöpfung aus Offb 21,10-17 zeigen. Die Heilige Stadt, das neue Jerusalem ist die Braut des Lammes. Sie besitzt höchste Qualität und hat bestimmte Maße. In ihr sind sowohl die 12 Stämme Israels (Tore) als auch die 12 Apostel des Lammes (Grundsteine) integriert. (Eph 2,19-21; Hebr 11,14-16).
2.3.3 Die unzählbare Schar der Erlösten vor dem Thron Gottes und des Lammes
Johannes schreibt: „Nach diesem sah ich: Und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen.“ (Offb 7,9).
Die einleitenden Worte: „Nach diesem sah ich“ sind uns bereits bekannt. Während die Versiegelung der Knechte Gottes hier auf Erden vollzogen wird, bekommt Johannes Einblick in den himmlischen Bereich und darf die erlöste Schar in ihrer Vollendung voraussehen. Diese Schar wird wie folgt beschrieben:
- Aufs allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Diese Auflistung ist typisch im Buch der Offenbarung, wenn auch die Reihenfolge variiert (Offb 5,9; 7,9; 11,9; 13,7; 17,15). Angedeutet ist es bereits im Alten Testament (1Mose 17,5; 22,18; Jes 49,6). Und es begann sich zu erfüllen zur Zeit der Apostel (Apg 15,17).
- Sie ist unzählbar, auch diese Beschreibung für das Volk Gottes ist bereits vorausgesagt worden (1Mose 15,5; 22,17-18; 26,4; 2Mose 32,13; 5Mose 10,22; Jes 40,26; Mt 8,11; Lk 13,29; Hebr 11,12).
- Sie standen (im Kreis) vor dem Thron und vor dem Lamm (vgl. auch mit Offb 14,1-5; 15,2-4).
- Sie waren bekleidet mit weißen Gewändern (Offb 7,13; dazu auch 3,4.18). Die Bedeutung dieser Bekleidung wird in Offb 19,8 mit „die Gerechtigkeit der Heiligen“ beschrieben (vgl. auch mit Jes 61,10; Röm 4,11ff; 5,1).
- In ihren Händen hielten sie Palmzweige. Auch dieses Bild ist bekannt als Verzierung im Heiligtum (4Mose 33,9; 3Mose 33,40; 1Kön 6,29; Hes 41,18). Dass Jesus als der König Israels beim Einzug in Jerusalem ebenfalls mit Palmwedeln begrüßt wurde, erklärt zusätzlich die Freude der Erlösten über ihren König und Erlöser (Joh 12,13; 1Petr 1,8).
Was macht diese unzählbare Schar?
„Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil (die Rettung) ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm!“ Das ist das Bekenntnis der erlösten Schar, denn sie haben diese Rettung erlebt.
Danach stimmen die um den Thron stehenden Engel ihren Hymnus der Anbetung Gottes an. „Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten: Amen Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit[ Amen.“ Diesen Hymnus mit seinen sieben Strophen sprechen die Engel in einer demütigen und ehrerbietenden Haltung aus.
- Die Lobpreisung, das gr. Wort `¢ eulogia`. Von Gott ausgesprochen ist es eine Segnung, von Menschen Gott zugerufen, ist es ein Lobpreis
- Die Herrlichkeit `¢ döxa` die Doxologie, eine konkrete Aussage oder Hymnus zur Verherrlichung Gottes.
- die Weisheit, `¢ sofia` Durch diesen Zuruf wird deutlich, dass wahrgenommen wird, wie Gott alles wunderbar durchdacht und geschaffen hat
- die Danksagung, `¢ eucharistia` Es ist ein Ausruf mit Bewunderung. Es ist eine Beschreibung oder Wertung, `die gute Gnadengabe`.
- die Ehre, `¢ tim¢`. Den Blick auf Gott gerichtet, das Gelingen, den Erfolg Gott zuschreiben.
- die Kraft,ὶ `¢ dynamis`. In diesem Wort liegt Dynamik,die Kraft, das Vermögen, welches nicht versiegt, nicht erlahmt. das unbegrenzte Ausmaß der Möglichkeiten.
- die Stärke, `ischys`. die Festigkeit und Stabilität, die Gott unbegrenzt zur Verfügung steht.
Alle sieben Attribute sind jeweils mit dem `und` verbunden und enden in der Zuordnung zu Gott. Er hat sie, er ist so und dies wird von den Engeln wahrgenommen und öffentlich anerkannt und ihm zugerufen (ähnlich auch in Kapitel 5,11-12). Welch eine himmlische Vorausschau für Johannes.
Doch nun wird er einbezogen mitzudenken durch die zwei Fragen eines der Ältesten. „Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir: Diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind – wer sind sie, und woher sind sie gekommen? Die Antwort des Johannes erstaunt einerseits, doch bereits vor ihm haben andere Propheten Engelboten auf diese Weise angeredet (Sach 1,9; Dan 10,19; 12,8). „Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes.“
Was ist mit der großen Bedrängnis gemeint?
Der griechische Begriff `thlypseös`, wird in den deutschen Übersetzungen mit Trübsal, Drangsal oder Bedrängnis wiedergegeben. Es handelt sich dabei um Druck von außen, der ganz unterschiedliche Formen annehmen kann und in unterschiedlicher Intensität erlebt wird. Sehr viele Texte sprechen von Bedrängnis, doch für die Antwort auf unsere Frage suchen wir zunächst nach Texten, welche wörtlich und inhaltlich von großer Bedrängnis des Volkes Gottes sprechen.
- In Daniel 12,1-2 wird gesagt: „Zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für dein Volk einsteht. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. 2 Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die andern zu ewiger Schmach und Schande.“ Aus dieser Prophezeiung geht hervor, dass die Generation, welche vor der allgemeinen Auferstehung noch hier auf Erden lebt durch diese große Bedrängnis hindurch gehen muss. Für diese hat diese Bedrängnis den Zweck der Prüfung, Reinigung und Läuterung (Dan 12,10).
- Und in Matthäus 24,21 lesen wir von Jesus: „Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. 22 Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch (kein Fleisch) gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt.“ Die Ähnlichkeit mit Daniel 12,1-2 scheint hier offensichtlich zu sein (so auch in Mk 13,19-24). Allerdings wird dort zunächst von der großen Bedrängnis gesagt, die im Zusammenhang der Zerstörung Jerusalems beschrieben wird. Lukas beschreibt dies mit „große Not und Zorn über dies Volk`“. Die Ergänzungen bei Lukas machen deutlich, dass diese große Bedrängnis sich zunächst auf die jüdischen Menschen in der Stadt Jerusalem aber auch auf das gesamte jüdische Volk bezieht. Dass Jesus diese Bedrängnis auch mit der Bedrängnis vor seinem Kommen verbindet ist auffällig: „Aber in jenen Tagen, nach jener Bedrängnis, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren.“ (Mt 24,29). Doch Jesus scheint zu unterscheiden zwischen Bedrängnissen, welche seine Nachfolger in der Zwischenzeit treffen werden und der oben genannten großen Bedrängnis, welche über Israel gehen soll und am Ende der Zeit das gesamte Volk Gottes treffen wird.
Die große Bedrängnis in Offenbarung 7,13 umfasst allerdings auch alle gläubigen aller Zeiten.
Nun schauen wir nach Texten, die von Bedrängnissen sprechen, welche Gottes Volk in der gesamten Zeit treffen werden:
- Mt 5,10-11: “Glückselig die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden“.
- Mt 10,22: „Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen.“
- Mt 24,9: „Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten; und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen.“ (Mk 13,13; Lk 21,12).
- Joh 15,20-21: „Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen.“
- Joh 16,2: „Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen; es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun.“
- Joh 16,33: „In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes ich habe die Welt besiegt.“
- Apg 8,1: „An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem“ (dazu auch 11,19).
- Röm 5,3: „Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt“ (dazu auch Röm 8,35; 12,12).
- 2Kor 1,4: „der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind.“ (2Kor 2,4; 4,17; 6,4).
- 2Thes 1,4-5: „sodass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet; 5 ⟨sie sind⟩ ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet.“
- Offb 1,9: „Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen.“
Offb 2,10: „Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst! Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir den Siegeskranz des Lebens geben.„ (dazu auch Offb 6,9-11; 12,11; 20,4-6).
Schlussfolgerung: Dies kann bedeuten, dass alle Gläubigen zu ihrer Zeit ein von Gott zugemessenes und begrenztes Maß an Bedrängnis erleiden werden. Die `große` Bedrängnis scheint demnach eine umfassende globale zu sein, welche am Ende der Weltzeit das gesamte noch lebende Volk Gottes treffen wird, ähnlich wie jene große Bedrängnis das gesamte jüdische Volk traf und sich über viele Jahrhunderte fortsetzte.
Sie haben ihre Gewänder hell gemacht im Blut des Lammes
Für diese Bekleidung steht im Griechischen das Wort `Stolas` (Offb 6,11; 7,9.13.14; 22,14). Eine Stola ist ein langes Festgewand. Auffallend ist die Wirkung des Blutes, es macht weiß.
So schreibt Johannes in seinem ersten Brief: „Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.“ (1Joh 1,7). Weitere Stellen: Eph 2,13; Hebr 9,13-14; 10,19; 13,12; Offb 1,6; 1Petr 1,2.
„Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel“ Eigentlich gibt es dort keinen Tag / Nachtwechsel. Der Dienst wird ununterbrochen ausgeübt. „und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen (zelten). 16 Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen noch irgendeine Glut; 17 denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen.“
Was erwartet dort die Überwinder und was gibt es dort nicht mehr?
- Tränen: Jes 25,8: „Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott der HERR wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen; denn der HERR hat’s gesagt“ (dazu auch Ps 126,5; Jes 25,8; Lk 7,38; Apg 20,19; Hebr 5,7).
- Wasserquellen: Jes 49,10: „Sie werden weder hungern noch dürsten, sie wird weder Hitze noch Sonne stechen; denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten.“ (Ps 23,1ff; Offb 21,6; 22,1.17).
- Manna: „Unsre Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht (Psalm 78,24): »Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen.« Joh 6,32: „Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel.“ (Ps 17,15; Offb 2,17).
- Keine Hitze: Jes 49,10: „Sie werden weder hungern noch dürsten, sie wird weder Hitze noch Sonne stechen; denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten.“ Jes 35,10: „Die Erlösten des HERRN werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen.“ (dazu auch Jes 4,6; Jer 17,8).
Welch eine Ermutigung für die bedrängte Gemeinde hier auf Erden! Damit schließt der zweite Teil dieser Bibelstudie über die Offenbarung. Der folgende dritte Teil erstreckt sich von Kapitel 8,1-11,19.
Aktualisiert am 01. Juli 24